|
| ||



Schon die Frage, was eigentlich unter unternehmerischem Denken und Handeln zu verstehen ist, kann einen ambitionierten Leser verwirren, finden sich doch bei diesem Thema so ziemlich alle Kompetenzen wieder, die man sich für einen in der Wirtschaft erfolgreich agierenden Menschen vorstellen kann. Genau dies ist es, was innerhalb der Forschung zur Entrepreneurship Education zunehmend Kopfzerbrechen bereitet. Eine Lösung sehe ich in der Abkehr vom Eigenschaftsansatz hin zum verhaltenstheoretischen Ansatz.
Da Untersuchungen zu den typischen Persönlichkeitsmerkmalen eines Unternehmers bisher keine befriedigenden Ergebnisse erzielten, ist man dazu übergegangen, verhaltenstheoretische Modelle heranzuziehen, um zu verstehen, was dazu führt, dass Menschen sich für eine Unternehmensgründung entscheiden (vgl. DELMAR 2000, 145). Maßgeblichen Einfluss hatten hier die `Theorie des geplanten Verhaltens´ von AJZEN und das Modell des `Entrepreneurial Events´ von SHAPERO. KRUEGER/ REILLY/ CARSRUD gelingt eine Zusammenführung der Modelle von AJZEN und SHAPERO. Die drei Autoren stellen hierzu fest, dass die beiden Modelle von AJZEN und SHAPERO in weiten Teilen Übereinstimmungen zeigen (vgl. KRUEGER/ REILLY/ CARSRUD 2000, 424).

Auch LINÁN (vgl. LINÁN 2004, 2) stellt in seiner Untersuchung zu intentionsbasierten Modellen der Entrepreneurship Education fest, dass die Modelle von SHAPERO und AJZEN signifikante Aussagen zu den Einflussfaktoren einer Handlungsintention machen. Er verbindet, ähnlich wie KRUEGER/ REILLY/ CARSRUD, die Modelle von SHAPERO und AJZEN, zu einem konvergierten Gesamtmodell. In einem nächsten Schritt stellt LINÁN einen Bezug zwischen Schulungsmodulen zur Entrepreneurship Education und den die Gründungsintention beeinflussenden Faktoren her. Er überprüfte in seiner Arbeit, welchen Einfluss bestimmte Kurstypen der Entrepreneurship Education auf die intentionsbestimmenden Faktoren haben. Betrachtet wurden dabei zwei verschiedene Kurstypen. Typ 1 ist ein klassischer Gründungskurs, der sich mit den praktischen Fragen bei der Gründung eines Unternehmens beschäftigt. Im Mittelpunkt steht hier der Business Plan. Typ 2 ist ein Sensibilisierungskurs. Hier geht es um die Rolle des Unternehmers und seine Bedeutung für die Gesellschaft. LINÁN (vgl. ebd., 12) kann mit seiner Studie signifikante Veränderungen des Machbarkeitsempfinden und der wahrgenommenen Wünschbarkeit hinsichtlich einer möglichen eigenen Unternehmensgründung bestätigen.
Kognitive Modelle zum unternehmerischen Verhalten, wie die zuvor genannten, beschreiben demnach ein aktuelles Verständnis darüber, wodurch eine bestimmte Gründungsintention bei Individuen beeinflusst wird. Auf Basis der genannten Modelle und unter Berücksichtigung der von KLANDT (vgl. KLANDT 1984, 315.) diskutierten Displazierung komme ich zu folgender Schlussfolgerung bezüglich einer möglichen Wirkungsweise von didaktischen Maßnahmen im Rahmen einer Entrepreneurship Education:
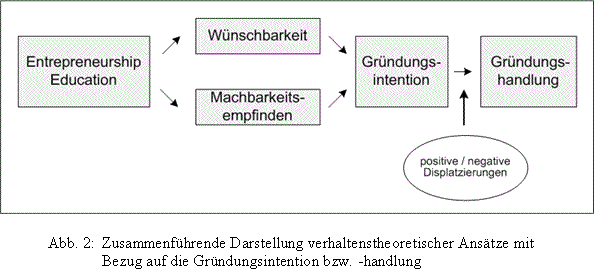
Aus didaktischer Perspektive stellt sich nun die Frage, wie genau mit Hilfe von Schulungsmaßnahmen optimal Einfluss auf die Bildung einer Gründungsintention, im Sinne einer Förderung des Machbarkeitsempfindens und der Förderung der Wünschbarkeit hinsichtlich einer eigenen zukünftigen Unternehmensgründung, genommen werden kann?
Bezogen auf das für eine Person Wünschenswerte verweist GOLLWITZER (1991) auf die der Person zugrunde liegenden Motive. Dabei versteht man unter einem Motiv die latente Bereitschaft, emotional auf Reize und Ereignisse zu reagieren, welche die Annäherung an eine definierbare Klasse von Zielzuständen signalisiert (vgl. PUCA/ LANGENS 2002, 240).
„Eine der Grundannahmen der Motivkonzeption lautet, dass Menschen recht konsistent auf Klassen von Zielzuständen reagieren, und zwar unabhängig davon, in welchen konkreten Situationen sich diese Zielzustände manifestieren. Diese Annahme ist empirisch überprüfbar und hat sich auch weitgehend bewährt, aber sie erinnert uns daran, dass Motive keine realen Entitäten, sondern lediglich hypothetische Konstrukte sind, die über eine sinnvolle Klassifikation von Zielzuständen eine ökonomische Vorhersage menschlichen Verhaltens erlauben“ (ebd., 240). Ohne Anspruch auf Vollständigkeit findet sich bei PUCA/ LANGENS eine Beschreibung verschiedener bio- und soziogener Motive (vgl. ebd., 244 ff.). Zu den biogenen Motiven zählen hier Hunger, Durst und Sexualität, zu den soziogenen Motiven zählt u. a. das Macht-, Leistungs- und Anschlussmotiv (vgl. ebd., 244-253). Für das Anschlussmotiv beispielsweise wird diese Klasse von Zielzuständen mit dem „Aufbauen und der Aufrechterhaltung positiver Beziehungen zu anderen Menschen“ umschrieben (ebd., 240).
Die Frage, ob Motive tatsächlich erlernbar sind oder nicht, wird von PUCA und LANGENS mit Bezug auf McCLELLAND wie folgt beantwortet. Ihrer Meinung nach legt „die genetische Ausstattung allein fest, dass Hunger, Durst, Sexualität, Anschluss, Macht und Leistung Themen (bzw. Motive B. H.) sind, die im Leben von allen Menschen eine Rolle spielen, nicht aber, wie viel Raum sie im Handeln einzelner Individuen einnehmen. Man geht davon aus, dass die Stärke eines Motivs durch affektive Lernerfahrungen determiniert wird. […] Das Motivprofil eines einzelnen Menschen ist also das Resultat einer Interaktion aus einer recht groben genetischen Prädisposition und einer langjährigen und flexiblen Adaption an die jeweilige soziale Umwelt“ (ebd., 241). Man kann demzufolge davon ausgehen, dass die Ausprägung eines Motivs, zumindest teilweise, erlernt wird.
Auf Grundlage der Forschungsergebnisse KLANDTs können innerhalb der Entrepreneurship Forschung „als relativ klar abgegrenzte Konzepte vor allen Dingen das Leistungsmotiv, das Machtstreben, das Gesellungsstreben, die Risikobereitschaft und das Unabhängigkeitsstreben angesehen werden, wobei das Leistungsmotiv sowohl von der theoretischen Konzeptionierung als auch vom empirischen Belegmaterial für seine Beziehung zur Gründungsaktivität und zum Gründungserfolg eine besondere Stellung einnimmt“ (KLANDT 1984, 183). Leistungsmotiv und Gründungsaktivität sind zudem klar positiv und linear korreliert. Hingegen ist die Beziehung zwischen Leistungsmotiv und Gründungserfolg zwar positiv korreliert, jedoch nicht eindeutig linearer Natur (vgl. ebd., 152).
Aus diesem Grunde scheint es m. E. sinnvoll, die Leistungsmotivation zu fördern, damit eine passende Motivgrundlage für den angestrebten Wunsch zur Gründung eines Unternehmens geschaffen wird. Neben dem Prinzip der Antizipation von Affektwechseln, in dem Motive als „Affektgeneratoren“ (PUCA/ LANGENS 2002, 240) verstanden werden, wird laut PUCA und LANGENS in der gegenwärtigen Diskussion zur Motivationspsychologie als zweites Prinzip das „Setzen und Verfolgen von Zielen, die als wichtig und erstrebenswert angesehen werden“ (ebd., 257), zugrunde gelegt. Dabei gilt, dass die thematische Struktur der Ziele, die Personen verfolgen, von der Ausprägung ihrer Motivprofile unabhängig ist. Nach PUCA und LANGENS, die sich auf SCHULTHEIß beziehen, können Motive und Ziele deshalb so leicht voneinander abweichen, weil sie unterschiedliche Repräsentationscodes verwenden. Motive teilen sich demnach vor allem über Affekte mit,. Ziele hingegen werden überwiegend sprachlich-symbolisch repräsentiert. Dies bedeutet, dass sie nicht notwendigerweise auch Informationen über die affektiven Qualitäten der Zielverfolgung oder -verwirklichungen enthalten müssen (vgl. ebd., 257 f.). Eine Übereinstimmung sollte jedoch angestrebt werden, da die Chance der Zielerreichung mit dem Grad der Übereinstimmung zwischen Zielen und Motiven zunimmt. „Die Verfolgung motivkongruenter Ziele (gelingt, B. H.) besser und ist meist auch erfolgreicher, weil eine ganze Reihe von Prozessen, welche die Zielverfolgung unterstützen – wie etwa Aufmerksamkeitsausrichtung, Energetisierung und Lernen – automatisch angeregt werden“ (ebd., 257). Dies bedeutet, dass neben der Motiventwicklung auch für eine entsprechende Zielentwicklung gesorgt werden muss.
Als Schlüssel zur Entwicklung von Zielen, die zu einer passenden `Ziel-Motiv-Kombination´ führen, wird von mir die Interessenbildung als besondere Form der intrinsischen Motivation im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie der Motivation (vgl. PRENZEL/ DRECHSEL 1996, 219 und KRAPP 1993, 200 ff.) gesehen. PRENZEL und DRECHSEL erweitern das Modell von DECI und RYAN (vgl. DECI/ RYAN 1993, 223-238) und definieren sechs Stadien der Lernmotivation. Das Stadium des `Interessiertseins´ wird dabei als Maximalform intrinsischer Motivation verstanden. Interesse wird durch drei Merkmale charakterisiert (vgl. SCHIEFELE/ PRENZEL 1991, 820):
• Durch die hohe kognitive Komplexität des Wissens über den Gegenstand und die Handlungsmöglichkeiten,
• durch die emotional positive Tönung des Gefühlserlebens beim Umgang mit dem Gegenstandsbereichs,
• durch die Wertorientierung auf die unmittelbaren Handlungsergebnisse (d.h. Interessen sind selbstintentional und nicht instrumentell) bzw. die Einordnung des Interessengegenstands und -handelns in eine herausgehobene Position in der individuellen Wertehierarchie.
Ausgehend von der Unterscheidung zwischen individuellem und situationalem Interesse wird mit dem hier sehr allgemein wiedergegebenen Rahmenmodell der Interessengenese der Ausgangspunkt für die `Münchener Interessentheorie´ gegeben (vgl. KRAPP 1998, 191).
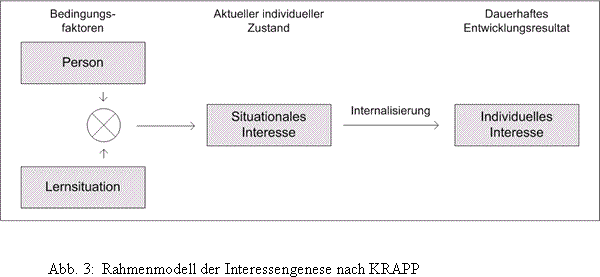
Nach SCHIEFELE beschreibt ein situationales Interesse eine initiale Zuwendung zu einem Sachverhalt, der dann Inhalt einer Handlung oder eines Lernprozesses wird. Es geht dabei um die erfahrene bzw. didaktisch geweckte Aufmerksamkeit gegenüber einem bestimmten Gegenstand. Einstiegsthematiken wie bspw. Abenteuer, Gefahr, Tod, Gewalt, persönliches Schicksal oder Variablen wie Neuheit, Überraschung, Unsicherheit und Widersprüchlichkeit lösen dieses situationale Interesse aus (vgl. SCHIEFELE 2000, 229). Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich aus dem situationalen Interesse, meist über einen mehrstufigen Prozess, ein dauerhaftes individuelles Interesse entwickeln, so dass eine „anhaltende Bereitschaft zur lernwirksamen Auseinandersetzung mit dem neuen Lerngegenstand“ (KRAPP 1998, 190) entsteht. Damit nun aus einem situationalen Interesse ein individuelles werden kann, bei der sich eine Person dauerhaft und aus innerer Neigung mit einem Gegenstandsbereich auseinandersetzt, verweist KRAPP darauf, dass die Person auf der Basis rationaler Überlegungen den Gegenstandsbereich als hinreichend bedeutsam einschätzen muss (wertbezogene Valenz) und während der gegenstandsbezogenen Auseinandersetzung (Lernhandlungen) eine insgesamt positive Bilanz bezüglich der emotionalen Erlebnisqualität ziehen muss (vgl. ebd., 193). Im Mittelpunkt einer förderlichen Beeinflussung der emotionalen Erlebnisqualität stehen dabei die innerhalb der Selbstbestimmungstheorie von DECI und RYAN (vgl. DECI/ RYAN, 1997, 229.) erarbeiteten drei grundlegenden psychischen Bedürfnisse nach Kompetenz, Selbstbestimmung und sozialer Eingebundenheit, die nachfolgend weiter vertieft werden.
Bei der Selbstbestimmung geht es darum, dass das Individuum aus eigenem Antrieb, frei von äußeren und inneren Zwängen, etwas tun möchte. Es geht um das vom Individuum selbst ausgehende Engagement. Das Handeln wird überwiegend durch die eigenen Erfahrungen und Vorstellungen bestimmt (vgl. KRAPP 1993, 200 sowie EULER/ HAHN 2004, 330). KRAPP et al. weisen darauf hin, dass Autonomie in diesem Kontext nicht mit dem Streben nach möglichst großer Freiheit, im Sinne einer Unabhängigkeit von Beeinflussung durch andere, missverstanden werden darf. Mit Bezug auf Lehr-Lern-Situationen „ist dieses Bedürfnis stets auf das jeweils erreichte Kompetenzniveau bezogen. Eine Person wünscht nur dort Handlungsfreiheit, wo sie glaubt, die anstehenden Aufgaben mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erfolgreich bewältigen oder die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten selbständig erwerben zu können“ (KRAPP 1998, 194). So gelingt die Kompetenzerfahrung optimal. An diesem Sachverhalt wird erneut deutlich, dass die einzelnen Bedürfnisse nicht unabhängig von einander zu betrachten sind, sondern sich gegenseitig bedingen (vgl. ebd., 194). Das Autonomieerleben wird dadurch unterstützt, dass für den Lernenden Möglichkeiten der selbstständigen, gestalterischen und schöpferischen Tätigkeit berücksichtigt werden und Aufgaben so gestaltet werden, dass sie als herausfordernd und sinnvoll angesehen werden.
Kompetent zu sein bedeutet, einer Sache gewachsen zu sein, zu wissen, dass der Erfolg in der eigenen Hand liegt und erreichbar ist. KRAPP et al. führen hierzu aus, dass sich das Individuum, mit dem Bestreben die eigene Kompetenz erleben zu wollen, als handlungsfähig und den gegebenen und absehbaren Anforderungen gegenüber als gewachsen erleben will. Damit erhöht sich das Vertrauen in die eigene Lern- und Entwicklungsfähigkeit. Mit Bezug auf WHITE stellen KRAPP et al. fest, dass das Erleben eigener Kompetenz eine eigenständige motivationale Kategorie darstellt, die WHITE mit `Wirksamkeitsmotivation´ (effectance motivation) bezeichnet. Diese Sichtweise ist eng mit dem Gefühl der Selbstwirksamkeit (feeling of efficacy) verbunden, die, ganz im Sinne der Alltagstheorie, davon ausgeht, dass man gerne das macht, was man auch kann. Mit dem Querverweis hin zu BANDURAS Theorie der Selbstwirksamkeit wird deutlich, dass der Kompetenzerwerb zugleich auch Auswirkung auf die Wünschbarkeit einer Person hat (vgl. ebd., 194). Beim Kompetenzerleben kommt es darauf an, Bezugspunkte zu schaffen, die dazu beitragen, dass man erkennt, dass durch eigenes Handeln die Kompetenz in Richtung des angestrebten Lernziels weiterentwickelt werden konnte.
Mit diesem Grundbedürfnis kommt zum Ausdruck, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, das sich zu einer Gruppe zugehörig fühlen will. Dabei werden die in den sozialen Bezugsgruppen für wichtig erachteten Werte, Ziele und Verhaltensnormen „auf dem Weg der Identifikation mehr oder weniger bewusst übernommen und allmählich in den Bestand des individuellen Selbst integriert“ (KRAPP 1993, 200). Darüber hinaus verweist KRAPP darauf, dass das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit im Hinblick auf die Entstehung und Weiterentwicklung motivationaler Dispositionen eine teilweise anders gelagerte Funktion besitzt. „Es bildet vor allem die Grundlage oder den Ausgangspunkt für die Bereitschaft, sich einem neuen, bislang wenig vertrauten und insofern eher aversiv besetzten Tätigkeits- oder Wissensgebiet zuzuwenden. Zugleich liefert es eine Erklärung, warum sich ein Individuum mit dem jeweils erreichten Entwicklungsstand nicht zufrieden gibt“ (KRAPP 1998, 194 f.).
Damit ist jedoch nur ein Rahmen geschaffen worden, der zu einer positiven emotionalen Erlebnisqualität beiträgt. Für das entscheidende Problem, wie Interesse an sich zu entwickeln ist, verweist KRAPP auf den Bereich der wertbezogenen Valenzen. Hier fragt er danach, wie „es gelingen (kann, B. H.), aktuelle Wertebezüge oder/und innerlich akzeptierte Zielvorstellungen der Schüler zu aktivieren und im Kontext des Unterrichts handlungswirksam werden zu lassen?“ (ebd., 198). Mit seiner Antwort verweist KRAPP auf konstruktivistische bzw. handlungsorientierte Methoden, die förderlich für die Interessenentwicklung sind (vgl. ebd., 198).
Mit der Feststellung KRAPPs, dass handlungsorientierter Unterricht und damit der Einsatz komplexer Lehr-Lernarrangements Einfluss auf die Interessengenese haben und somit wiederum zur Förderung der Wünschbarkeit beitragen, möchte ich an dieser Stelle den Übergang zur Methode der Juniorfirmen schaffen. Dieser Focus wird durch zwei Argumente gestärkt.
1) Im Rahmen der Diskussion zur Interessenförderung wurde deutlich, dass neben den Maßnahmen, die einer Förderung dienlich sind, auch der Interessengegenstand an sich bestimmt werden muss. In unserem Fall ist dies das Interesse an der Gründung eines Unternehmens und an der damit verbundenen Tätigkeit. Auf die Frage, was den Entrepreneur definiert, wurde festgestellt, dass aufgrund der Heterogenität der existierenden Entrepreneurs eine einheitliche Antwort nicht gegeben werden kann. Um die unternehmerischen Aktivitäten abzubilden, greife ich auf die von RIPSAS (vgl. RIPSAS 1998) herausgearbeiteten vier Unternehmerfunktionen zurück. Diese werden um die Inhalte, die im Rahmen einer Unternehmensgründung von Bedeutung sind und wie sie Klandt erarbeitet (vgl. KLANDT 1999, 49), erweitert.
• Übernahme von Risiko bzw. Ungewissheit
• Innovationen am Markt durchsetzen
• Entdeckung von Arbitragen
• Koordination von Ressourcen
• Gründen eines Unternehmens
Die mit Bezug auf RIPSAS identifizierten Unternehmerfunktionen stellen lediglich eine Teilantwort dar. Definiert wurde, dass ein Entrepreneur durch die Gründung eines Unternehmens Marktchancen nutzt. Genau dieser Gegenstandsbereich wird mit der Durchführung einer Juniorfirma aufgegriffen. Im nachfolgenden Betrieb der Juniorfirma werden die Schüler dann mit den identifizierten `Kerntätigkeiten´ des Unternehmers konfrontiert. Ziel einer Sensibilisierung ist demnach die Förderung des Interesses an einer eigenen Unternehmensgründung und Unternehmensführung, denn das mit der Entrepreneurship Education verbundene Ziel einer Förderung des Machbarkeitsempfindens und der Wünschbarkeit bezieht sich nicht nur auf die Unternehmensgründung an sich, sondern auch auf die mit der Unternehmensführung verbundenen Tätigkeiten.
2) Indem BANDURA, wie nachfolgend noch zu zeigen sein wird, die direkte Erfahrung (mastery experience) , die das eigene aktive Handeln und das Meistern schwieriger Aufgaben in den Mittelpunkt stellt, als beste Methode ausweist, wird mit dem Einsatz der handlungsorientierten Methode `Juniorfirma´, in der ich den Ansatz der direkten Erfahrung verwirklicht sehe, zugleich die Selbstwirksamkeit, also das Machbarkeitsempfinden gestärkt.
Problematisch in diesem Zusammenhang ist allerdings die geringe Datenlage bezüglich der Wirkung von Juniorfirmen im Rahmen der Entrepreneurship Education. So finden sich kaum Studien dazu, wie viele Schüler, die an einem Juniorfirmenprojekt teilnahmen, sich später auch selbstständig gemacht haben (vgl. HAUGUM 2005). Besonders problematisch ist der nicht berücksichtigte statistische Selbstselektionsfehler. Dadurch, dass die Schüler an den Juniorfirmen freiwillig teilgenommen haben und somit u. U. vorwiegend diejenigen Jugendlichen erreicht wurden, die ohnehin schon einer eigenen Unternehmensgründung aufgeschlossen gegenüberstanden, verbietet sich die Schlussfolgerung, dass durch die Teilnahme an einer Juniorfirma die Gründungsrate automatisch steigt. Dennoch kann auch ohne diese wünschenswerten Daten aufgrund der hier gemachten Überlegungen und aus Plausibilitätsgründen davon ausgegangen werden, dass ein entsprechendes Lehr-Lernarrangement zur Interessenförderung beitragen würde.
Interessenbildung konzentriert sich neben motivationalen Aspekten also auch auf kompetenzbildende Aspekte hinsichtlich eines Gegenstandsbereichs. Dadurch wird neben der Wünschbarkeit auch das Machbarkeitsempfinden, auf das bereits hingewiesen wurde, gefördert. Dies soll nachfolgend anhand des Modells der `wahrgenommenen Selbstwirksamkeit´ von BANDURA gezeigt werden.
Die Wurzel der von BANDURA im Rahmen seiner sozial-kognitiven Theorie der Selbstregulierung entwickelten `wahrgenommenen Selbstwirksamkeit´, geht auf das Konzept der `Kontrollüberzeugung´, auch bekannt als `locus of control´ oder `generelles Machbarkeitsempfinden´, zurück (vgl. DELMAR 2000, 148). „Selbstwirksamkeit ist die individuell unterschiedlich ausgeprägte Überzeugung, dass man in einer bestimmten Situation die angemessene Leistung erbringen kann. Dieses Gefühl einer Person bezüglich ihrer Fähigkeiten beeinflusst ihre Wahrnehmung, ihre Motivation und ihre Leistung auf vielerlei Weise“ (ZIMBARDO/ GERRIG 2003, 543). Im Gegensatz zum generellen Machbarkeitsempfinden ist jedoch die wahrgenommene Selbstwirksamkeit situationsabhängig. Es wird also nicht von einer stets gleichen, von der Situation unabhängigen Empfindung ausgegangen.
Fehlt einer Person diese Überzeugung, so wird sie eine bestimmte Handlung nicht in Angriff nehmen, obwohl sie objektiv die Fähigkeit dazu besitzt. BANDURA verwendet den Begriff Selbstvertrauen deshalb nicht, weil er die Gefahr einer zu starken Versimplifizierung darin sieht. Die Wahrnehmung des eigenen Könnens stelle man sich seiner Meinung nach als eine Menge spezifischer Einzelbewertungen vor, deren Komplexität man mit dem Begriff Selbstvertrauen oder Selbstachtung nicht gerecht würde (vgl. ebd., 543). Das Gefühl der Selbstwirksamkeit beeinflusst jedoch auch das Verhalten in einer bestimmten Situation. Die situationsspezifische, subjektiv wahrgenommene Selbstwirksamkeit hat also nicht nur Einfluss auf die Entwicklung einer bestimmten Absicht etwas zu tun (hier z. B. der Gründungsintention), sondern auch auf das Verhalten innerhalb der Handlung selbst. Die Ausdauer bei einer Handlung wird umso größer sein, je stärker die handelnde Person von der Durchführbarkeit eben dieser überzeugt ist. Personen, die in einer bestimmten Situation eine hohe Selbstwirksamkeit empfinden, betrachten schwierige Aufgaben als Herausforderung, die gemeistert werden kann und nicht als Problem, das es zu umgehen gilt. Genau wie beim Konzept des `locus of control´ tendieren sie dazu, Fehler als Resultat zu geringer Bemühung und zu geringen Wissens zu verstehen und diese nicht externen Umständen zuzuschreiben, auf die sie keinen Einfluss haben. Personen, die der Auffassung sind, in einer bestimmten Situation nur eine geringe Selbstwirksamkeit zu besitzen, streben verhältnismäßig niedrige Ziele an und geben diese zudem relativ schnell auf. Sie verlieren dadurch schnell das Vertrauen in ihre eigenen Leistungen. Formulierungen wie „Erfolg erzeugt Erfolg“ (DELMAR 2000, 150) greifen die Theorie der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit auf. Aber ebenso wie ein positiver Kreislauf entstehen kann, kann es auch zu einem negativen Verlauf kommen, bei dem Misserfolg weitere Misserfolge nährt (vgl. ebd., 150; vgl. auch BANDURA 1995, 3).
„Das Gefühl der Selbstwirksamkeit kann Verhalten in Situationen beeinflussen, die sich von denen, welchen es seine Entstehung verdankt, unterscheiden“ (ZIMBARDO/ GERRIG 2003, 543). D. h. positive Erwartungen können hinsichtlich der eigenen Selbstwirksamkeit auf neue Situationen übertragen werden. Auch wenn das Maß der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit im Wesentlichen von den persönlichen Erfahrungen der Person bestimmt wird, ist in erster Linie der Glaube daran ausschlaggebend, Handlungen, die zum Meistern einer bestimmten Situation notwendig sind, planen und ausführen zu können. Selbstwirksamkeitsglaube beeinflusst dabei, wie Menschen denken, fühlen, sich selbst motivieren und handeln (vgl. BANDURA 1995, 2). Die Beurteilung der eigenen Selbstwirksamkeit wird neben der Wahrnehmung der eigenen Leistungen (direkte Erfahrung) durch weitere Faktoren beeinflusst: durch die Beobachtung der Leistung anderer ( stellvertretende Erfahrung ), durch übernommene oder selbst erarbeitete Überzeugungen und durch die Beobachtung der eigenen emotionalen Zustände, während wir über eine Aufgabe nachdenken bzw. sie zu lösen versuchen (vgl. ZIMBARDO/ GERRIG 2003, 543). Dabei betrachtet BANDURA die direkte Erfahrung (mastery experience) , die das eigene aktive Handeln und das Meistern schwieriger Aufgaben in den Mittelpunkt stellt, als beste Methode: „The most effective way of creating a strong sense of efficacy is through mastery experiences“ (BANDURA 1995, 3).
Demnach liefern Juniorfirmen eine ideale Grundlage zur Förderung des Machbarkeitsempfindens, geht es doch hierbei explizit um die direkte Erfahrung im Sinne der `mastery experience´.
Zuvor wurde gezeigt, wie im Rahmen der Zielentwicklung durch Förderung des Interesses Einfluss auf die Wünschbarkeit und das Machbarkeitsempfinden genommen werden könnte. Ich hatte ebenfalls bereits auf das Problem der Motiv-Ziel-Kongruenz hingewiesen und in diesem Kontext die Leistungsmotivation in den Mittelpunkt meiner Betrachtung gestellt. Nun stellt sich die Frage, wie die Leistungsmotivation des Schülers erhöht werden kann. Hierzu nachfolgend einige Bemerkungen.
Das Leistungsmotiv gilt als eines der meist untersuchten Motive. 1953 griffen McCLELLAND et al. auf den `Thematischen Auffassungstest´ (TAT) zurück, der bereits 1938 von MURRAY zur Leistungsmotivationsforschung entwickelt wurde. Obwohl MURRAY zeitlich deutlich früher das Thema für sich entdeckt hatte, sind es doch McCLELLAND und ATKINSON, die als Urheber der Leistungsmotivationsforschung gelten. Mit ihrer empirisch-experimentellen Forschung, die neben Forschungsergebnissen von MURRAY auch an Ansätze von LEWIN und FREUD anknüpft, verhalfen sie der Leistungsmotivationsforschung zum Durchbruch (vgl. RHEINBERG, 2002, 61).
Unter der Leistungsmotivation ist nach McCLELLAND die Motivation zu verstehen, sich mit einem Gütemaßstab, den es zu erreichen oder zu übertreffen gilt, auseinanderzusetzen (vgl. McCLELLAND 1966, 21). Das konkrete Ziel dieses Konstrukts bleibt dabei jedoch unbestimmt. Eine der zentralen Fragen, die sich McCLELLAND stellt, ist die Frage nach der Veränderbarkeit der Leistungsmotivation. Akzeptiert McCLELLAND zunächst die Befunde von WINTERBOTTOM, der den Einfluss auf die Ausprägung des Leistungsmotivs – also der Höhe der Leistungsmotivation – allein in der kindlichen Erziehung sieht (vgl. WEINER, 1984, 167), entwickelte McCLELLAND im weiteren Verlauf seiner wissenschaftlichen Arbeit dennoch ein Trainingskonzept für Erwachsene zur Förderung der Leistungsmotivation. HECKHAUSEN postuliert, dass eine notwendige Vorbedingung für das Entstehen von Leistungsbedürfnissen die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstattribution ist. Diese bildet sich etwa im Alter von drei Jahren heraus ( vgl. WEINER 1984, 172). HECKHAUSEN entwickelt in den 70er Jahren das Selbstbewertungsmodell, das von RHEINBERG aufgegriffen wird und als dessen Grundlage dient. RHEINBERG et al. liefern neuere Untersuchungsergebnisse und gestalten erfolgreiche Unterrichtskonzepte zur Förderung der Leistungsmotivation bei Jugendlichen. RHEINBERG führt aus, dass allein die Förderung weniger Einzeldimensionen zu einer deutlichen Steigerung der Leistungsmotivation beiträgt (vgl. RHEINBERG 1999, 39 und 51). Daher ist eine Konzentration auf ausgewählte Einzeldimensionen aus Effizienzgründen zu befürworten, ohne in Abrede zu stellen, dass eine Ausweitung des Interventionsbereichs auf weitere Dimensionen, wie sie bei SCHULER zum Beispiel beschrieben werden (vgl. SCHULER 1998, 31), sinnvoll oder zweckmäßig ist.
Der Ansatz von RHEINBERG bezieht sich lediglich auf die beiden Dimensionen `Zielsetzung´ und `Attribution´.
Es gilt eine Entwicklungshaltung einzunehmen, welche die Zukunft als Chance zur eigenen Weiterentwicklung erkennt und nutzt. Zudem geht es um solche Reaktionsformen bei Zielerreichung, die zu einer Anspruchsniveauhebung nach der Erreichung des Ziels führen.
Bei der Förderung der Attribution geht es darum, Attributionsmuster einer Person zu verändern. Erwünschte Attributionsmuster sollen gezielt gefördert werden. Daraus ergeben sich verschiedene Attributionen bei Erfolg und Misserfolg.
RHEINBERG/ GÜNTHER ( 1999, 58) geben schließlich folgende Hinweise zur Realisierung eines Unterrichts, der die Zusammenhänge zwischen Zielsetzung, Ursachenerklärung und Selbstbewertung darstellt:
• Das Unterrichtsmaterial muss sich in Aufgaben transferieren lassen, die ein eindeutiges Ergebnis ermöglichen, das vom Schüler selbst ermittelt werden kann.
• Die Aufgaben sollen eine deutlich erkennbare Schwierigkeitsstaffelung besitzen oder klar abgegrenzte Grade der Ausführungsgüte/-menge besitzen.
• Erfolg oder Misserfolg sollen teilweise oder sogar gänzlich durch den Lernenden kontrollierbar sein. Beispielsweise durch Anstrengung, Konzentration oder Wahl der Arbeitsstrategie. Die Lösung der Aufgabe soll also nicht lediglich auf Fähigkeiten beruhen oder gar zufallsabhängig sein.
• Die Bearbeitung der Aufgaben darf nicht zu lange dauern, damit die Beziehung zwischen Zielsetzung, Arbeitseinsatz und Ergebnis als Einheit überschaubar und reflektierbar bleibt und häufiger durchlaufen werden kann.
• Den Schülern müssen die Aufgaben bereits so vertraut sein, dass sie Schwierigkeitsgrade für sich selbst einschätzen und die Aufgaben überhaupt selbstständig bearbeiten können.
Im Rahmen der Durchführung einer Juniorfirma sollten die beiden Dimensionen durch Gestaltung entsprechender Aufgaben stärker trainiert werden. Die Entwicklung derartiger Aufgaben ist Gegenstand meiner aktuellen Forschungsarbeit.
Ich möchte meine Ausführungen an dieser Stelle beenden und lediglich auf eine Grafik (vgl. HEKMAN 2006, 151) verweisen, die mir als theoretische Grundlage im Rahmen des Leonardo da Vinci Projekts DESIRE, einem Projekt zur Förderung der Gründungskompetenz bei KMU, diente. Anhand dieser Grafik soll deutlich werden, dass die zuvor dargelegten Überlegungen Bestandteil einer ganzheitlichen Betrachtung des Gründungsprozesses sind. Die hier formulierten Überlegungen zur Förderung der Wünschbarkeit und Machbarkeit beziehen sich in diesem Kontext auf die Phase der Sensibilisierung. Sie müssen aber für die übrigen vier angedeuteten Phasen ebenfalls beantwortet werden.

Als Basis dieses von mir entwickelten Modells (vgl. HEKMAN 2006, 122 ff.) diente u. a. das Rubikon-Modell von HECKHAUSEN (vgl. HECKHAUSEN 1989, 212) .
Weitere Überlegungen hierzu können jedoch an dieser Stelle und unter Berücksichtigung des gesetzten Rahmens, leider nicht mehr eingehend dargestellt werden. Gleichwohl konnte gezeigt werden, welche Rolle Juniorfirmen bei der Förderung des Interesses an unternehmerischem Denken und Handeln spielen, und dass diese Methode stärker auf die Förderung der Leistungsmotivation ausgerichtet werden sollte.
BANDURA , A. (1995): Self-efficacy in Changing Societies. Cambridge.
DECI, E. L./ RYAN, R. M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik, 39. Jg., 223-238.
DELMAR, F. (2000): The psychology of the entrepreneur. In: CARTER , S./ J ONES-EVANS , D. (Hrsg.): Enterprise and small Business. Principles, Practice and Policy. Essex., 132-154.
EULER , D./ HAHN , A. (2004): Wirtschaftsdidaktik. Bern.
GOLLWITZER , P. M. (1991): Bewußtseinslagen in verschiedenen Handlungsphasen. Göttingen.
HAUGUM , M. (2005): Ungdomsbedrifter og entreprenørskap. Undersøkelse om ungdomsbedrifter i videregående skole og etablererhyppighet. Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer.
HECKHAUSEN , H. (1989) : Motivation und Handeln. Berlin, Heidelberg, New York.
HEKMAN , B. (2006): Entrepreneurship Education in Europa. Entwicklung einer berufs- und wirtschaftspädagogischen Empfehlung zur Förderung von Gründungskompetenz im Handwerk mit dem Schwerpunkt Erstausbildung. Online: http://kups.ub.uni-koeln.de/volltexte/2006/1744 (31.05.2006).
KLANDT , H. (1984): Aktivität und Erfolg des Unternehmensgründers. Eine empirische Analyse unter Einbeziehung des mikrosozialen Umfeldes. Bergisch Gladbach.
KLANDT , H. (1999): Gründungsmanagement. Der integrierte Unternehmensplan. München, Wien.
KRAPP , A. (1993): Die Psychologie der Lernmotivation. Perspektiven der Forschung und Probleme ihrer pädagogischen Rezeption. In: Zeitschrift für Pädagogik, 39. Jg., 187-206.
KRAPP , A. (1998): Entwicklung und Förderung von Interessen im Unterricht. In: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 44. Jg., 185-201.
KRUEGER , N. F. Jr ./ REILLY , M. D./ CARSRUD , A. L . (2000): Competing Models of Entrepreneurial Intentions. In: Journal of Business Venturing, 15. Jg., 411-432.
LINÁN , F. (2004): Intention-Based Models of Entrepreneurship Education. In: Förderkreis Gründungsforschung e.V. (Hrsg.): 14th Annual IntEnt Conference, University of Napoli , 5-7 July, 1-15.
McCLELLAND , D. C. (1966): Die Leistungsgesellschaft. Stuttgart, Berlin, Köln.
PRENZEL , M./ DRECHSEL , B. (1996): Ein Jahr kaufmännische Erstausbildung. Veränderungen in Lernmotivation und Interesse. In: Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lernforschung, 3. Jg., 217-234.
PUCA , R. M. / LANGENS, T. A . (2002): Kapitel 2a: Motivation. In: Müsseler, J./ Prinz, W. (Hrsg.): Allgemeine Psychologie. Heidelberg, Berlin. 224-269.
RHEINBERG , F. (2002): Leistungsmotivation. In: SELG , H./ ULICH , D. (Hrsg.): Motivation. Stuttgart. 61-101.
RHEINBERG, F./ GÜNTHER , A. (1999) : Ein Unterrichtsbeispiel zum lehrplanbestimmten Einsatz individueller Bezugsnomen. In: RHEINBERG , F./ KRUG , S. (Hrsg.): Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung. Göttingen, Bern, Toronto u. a. 55-68.
RIPSAS , S. (1998): Elemente der Entrepreneurship Education. In: FALTIN , G./ RIPSAS , S./ ZIMMER , J. (Hrsg.): Entrepreneurship – Wie aus Ideen Unternehmen werden. München. 217-233.
SCHIEFELE , H./ PRENZEL , M. (1991): Motivation und Interesse. In: ROTH, L. (Hrsg.): Pädagogik. Handbuch für Studium und Praxis. München. 813-823.
SCHIEFELE, H. (2000): Befunde – Fortschritte – neue Fragen. In: SCHIEFELE, U./ WILD , K.-P. (Hrsg.): Interesse und Lernmotivation. Untersuchungen zu Entwicklung, Förderung und Wirkung. Münster, New York, München u. a. 227-341.
SCHULER , H. (1991): Der Funktionskreis "Leistungsförderung" - eine Skizze. In: SCHULER , H. (Hrsg.): Beurteilung und Förderung beruflicher Leistung. Stuttgart. 171-189.
SCHULER , H. (1998): Berufsbezogene Leistungsmotivation. Überlegungen zum Konstrukt und erste Ergebnisse einer Testentwicklung. In: ROSENSTIEL , L. v./ SCHULER , H. (Hrsg.): Person – Arbeit – Gesellschaft. Festschrift für Hermann Brandstätter. Augsburg.
WEINER , B. ( 1984): Motivationspsychologie. Weinheim.
ZIMBARDO , P. G ./ GERRIG , R. J. (2003): Psychologie. Berlin, Heidelberg.
Informationen zum Projekt DESIRE: www.desire-project.org