|
| ||



Im Bereich industrieller Produktionsstrukturen haben sich in den vergangenen Jahren weit reichende Entwicklungen vollzogen. Arbeitszusammenhänge und -organisationsformen veränderten sich besonders im Umfeld automatisierter Fertigungsprozesse, aber neuerdings auch in eher traditionell ausgerichteten Produktionen. Auf jeden Fall ist weiterhin ein fortlaufender Wandel der Facharbeit im Berufsfeld Metall zu erwarten. Somit sind Fragen zu beantworten, die sich sowohl auf die Art benötigter Qualifikationen, als auch auf innovative didaktisch-methodische Konzepte einer anspruchsvollen und zukunftsweisenden Erstausbildung beziehen. Für die berufliche Facharbeit werden sach- und persönlichkeitsbezogene Fähigkeiten verlangt, die das krasse Gegenteil dessen bedeuten, was bislang durch berufliche Arbeitsteilung praktiziert wurde. An Berufsschulen wird dieser Wandel mit der Einführung der Lernfelder zur Zeit konzeptionell und praktisch umgesetzt. Die sich im Laufe von Jahrzehnten verfestigten fachsystematisch orientierten Lehr- und Lernformen sind zwar nicht aus der Wirklichkeit verschwunden, haben aber im Lernfeldkonzept mit dem einhergehenden handlungsorientierten Unterricht eine neue strukturelle Orientierung erhalten. In den didaktischen Grundsätzen der neuen KMK-Rahmenlehrpläne wird ausdrücklich erwähnt, dass fach- und handlungssystematische Strukturen miteinander zu verschränken sind (vgl. KMK 2004, 5). Weiterhin wird festgestellt, dass Ausgangspunkt der didaktisch-methodischen Gestaltung der Lernsituationen der Geschäfts- und Arbeitsprozess des beruflichen Handlungsfeldes sein soll (vgl. KMK 2004, 7).
Die Frage ist nun, wie die Berufsschule mit den veränderten Bedingungen der beruflichen Facharbeit umgehen sollte. Eine reine Anpassung an den vermeintlich technischen Fortschritt kann nicht als Lösung angesehen werden, weil die Schule der technischen Entwicklung stets chancenlos hinterherlaufen würde. Die Berufsschule könnte ein deutlich zukunftsorientiertes Profil entwickeln, wenn sie einen eigenständigen Beitrag zur Verbesserung einer umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit zukünftiger Facharbeiter leisten würde. Aus einer solchen Forderung lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass hierfür solche Lernumgebungen notwendig sind, mit denen eine Orientierung an den aktuellen Strukturen der Facharbeit und den beruflichen Arbeitsprozessen gelingt. Wenn der Arbeitsprozess im Betrieb als Kernbereich der Facharbeit unter lernortspezifischer Perspektive betrachtet wird, kann die Berufsschule das hierin enthaltene berufswissenschaftliche Potenzial entsprechend nutzen und arbeitsprozessorientierte Lernsituationen gestalten.
Folgende Ausgangsthesen sollen diesen Standpunkt erhärten:
• Eine Ausbildung für industrielle berufliche Facharbeit verlangt heute von den Partnern des Dualen Systems eine Integration von Arbeiten und Lernen in produktionsprozessorientierten Zusammenhängen (z.B. durch einen Lernortverbund).
• Komplexe Lehr- und Lernsituationen sind sowohl objekt- als auch subjektbezogen in ganzheitlichen Zusammenhängen zu erschließen.
• Eine am Arbeits- und Geschäftsprozess orientierte Ausbildung erfordert vor allem berufsfeldübergreifende Bezüge.
Damit wird deutlich, dass arbeitsprozessorientiertes berufliches Lernen in einem Unterricht mit traditioneller Fächerstruktur nur schwer vorstellbar ist. Unterrichtsfächer sind inhaltlich durch die korrespondierenden Fachwissenschaften geprägt, was im technischen Unterricht mit den im Hintergrund präsenten Ingenieurwissenschaften belegt wird. Hierdurch werden aber keine beruflichen Arbeitsprozesse abgebildet bzw. zum Lerngegenstand gemacht. Um dieser Erkenntnis im Berufsschulunterricht zum Durchbruch zu verhelfen, sind andere didaktische Konzepte in Betracht zu ziehen. Im weiteren Sinne hat dies auch mit Schul- und Organisationsentwicklung zu tun.
Um die Position der beruflichen Facharbeit im Betriebsgefüge einordnen zu können, hilft ein Blick auf die Organisationsstruktur bzw. auf die netzwerkartigen Wirkungszusammenhänge in einem Fertigungsbetrieb, wie in Abb. 1 beispielhaft dargestellt ist. Hieran lässt sich auf einleuchtende Weise verdeutlichen, dass komplexe Systeme in ihrer Gesamtheit mit den vielschichtigen Zwischenbeziehungen nur schwer zu erfassen sind. Die gegenseitigen Beziehungen der miteinander verknüpften Elemente sind oftmals gar nicht erkennbar. Aufgrund unserer gewohnten Denkweise werden Ereignisse und Ursachen überwiegend in kausalen und linearen Zusammenhängen betrachtet. Der obere Teil in der Abb. 1 zeigt einen Ausschnitt eines typischen Organigramms. Im unteren Teil sind dieselben Funktionsbereiche in ihrem gegenseitigen Beziehungsgeflecht dargestellt. Diese zwei Arten der Darstellung haben also jeweils unterschiedliche Aussagekraft. Das vernetzte System aller Abteilungen und Bereiche kann in seiner Dynamik nur mit der systemischen Darstellungsweise erkannt werden.
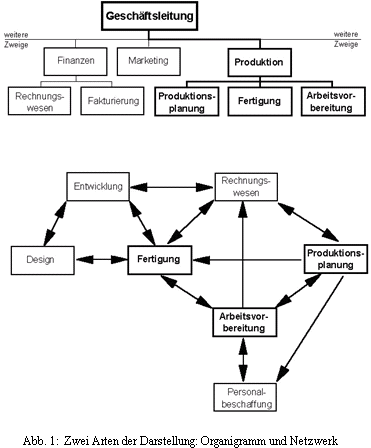
Im schulischen Lernen lässt sich eine Kongruenz zu den eben dargestellten Aspekten feststellen. Traditionelles lineares Denken erlaubt nur die isolierte, äußere Behandlung eines Problems und ermöglicht nicht den Blick auf darin verborgene Wechselwirkungen. Die Frage ist nun, ob sich komplexe Wirkungszusammenhänge in einer beruflichen Lernumgebung zwischen Berufsschule und Betrieb überhaupt darstellen lassen. Je konsequenter sich in einem simulierten Arbeits- und Produktionsprozess die Lernaufgaben und der betriebliche Organisationsgrad dem der Realität nähern, also je geringer der Unterschied zum realen Betrieb ausfällt, desto differenzierter wird die Gestaltung der Lernumgebung. In der Produktionsschul-Studie von GREINERT und WIEMANN (1992) ist mit dem Hinweis auf eine so genannte Lernfabrik allerdings deutlich geworden, dass sich ein derartig komplexes Simulationsmodell nicht gut unter dem Oberbegriff Produktionsschule subsumieren lässt - es ist wesentlich mehr. Ein höheres Maß an Komplexität entsteht allein dadurch, dass alle betrieblichen Funktionsabläufe in den Lernprozess mit einbezogen werden.
Im Folgenden wird das Strukturkonzept einer Lernfabrik als Lernobjekt skizziert. In dieser Lernfabrik werden die vernetzten Strukturen eines Betriebes mit seinen Subsystemen zu einer komplexen Lernumgebung gestaltet. Kernpunkt des Modells ist, dass mit betrieblichen Funktionen fächer- und berufsfeldübergreifende Lernsituationen ermöglicht werden. Berufsfeldübergreifend deshalb, weil betriebliche Auftragsdurchläufe von planerischen und steuernden Eingriffen beeinflusst werden, die sowohl in betriebswirtschaftlicher wie auch in fertigungstechnischer Hinsicht ausbildungsrelevant sind. Diese Mehrdimensionalität schafft Grundlagen für das Lernen und Arbeiten in komplexen Systemen.
Für das Lernumfeld ergeben sich vier didaktische Voraussetzungen:
(a) Problemorientierte Lehr- und Lernprozesse gestalten sich aus konkreten beruflichen Situationen.
(b) Problemlösungsfähigkeit muss in erfahrungsgeleiteten Arbeitssituationen entwickelt werden können.
(c) Arbeitsorganisation und Umgang mit Planungsstrategien wird zum Lernprinzip.
(d) Selbstorganisation und selbstverantwortliches Gruppenlernen bilden den Kerngedanken einer handlungsorientierten Lernumgebung, die Entscheidungs- und Reflexionsfähigkeit zum Ziel hat.
Auf das Lernobjekt bezogen sind drei technisch-prozessuale Kriterien zu erfüllen:
(a) Der Realitätsgrad einer Lernfabrik wird dargestellt durch das Vorhandensein oder den Mangel an bestimmten Maschinen, Anlagen und Geräten. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Vermittlung von Fachkenntnissen nach dem aktuellen Stand der Technik möglich.
(b) Unterschiedliche Kombinationen von Produktionsplanungen im Sinne von betrieblichen Fallbeispielen lassen sich darstellen.
(c) Analyse und Bewertung von Technik und Arbeitsorganisation sind unter der Voraussetzung möglich, dass Produkte mit unterschiedlichen Herstellungsverfahren und in unterschiedlichen Arbeitsorganisationen hergestellt werden können.
Unter den spezifischen Bedingungen des Lernens und Arbeitens an einem Realauftrag ist nicht nur das abzuliefernde Produkt zu verstehen, sondern vor allem der zum Ziel führende Weg, also der Produktionsprozess mit seinen Verknüpfungen und Abhängigkeiten. Dennoch muss dem Produkt als Herzstück des Produktionsprozesses besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Bei seiner Auswahl sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
• Ein Produkt ist dann geeignet, wenn es eine ausreichende technische Komplexität besitzt, ohne den Lerner zu überfordern.
• Es weist eine genügend große Teilevielfalt auf, damit einerseits technologische Planungsstrategien ermöglicht werden und andererseits schülerbezogene Differenzierungen vorgenommen werden können.
• Ein Produkt ist in seiner exemplarischen Funktion als Lernträger in mehreren Lerngebieten einsetzbar und enthält unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.
• Ein Realauftrag ist insgesamt auf seine didaktische Leistungsfähigkeit (Lernchancen) hin zu überprüfen (Analyse und Bewertung). Vom ganzheitlichen Ansatz her gesehen ist die Analyse eines Auftrags sogar Bestandteil der Lernaufgaben einer Lernfabrik. Bei den in der ersten Phase nötigen Entscheidungen sind die Lerner bereits mit einzubeziehen. Insgesamt stellen sich die Schritte einer Auftragsbearbeitung etwa folgendermaßen dar:
1. Schritt: Auftragsannahme
• Hinsichtlich der Losgröße und der Menge ist zu klären, ob möglicherweise die Gefahr der Routinisierung besteht.
• Welcher Zeitaufwand ist einzuplanen?
• Sind die technischen und verwaltungsbezogenen Ressourcen ausgelastet?
• Ist eine Kooperation zwischen den anderen beteiligten Bereichen möglich?
• Werden Materialien verwendet, die einen ökologisch unbedenklichen Umgang erlauben?
• Wenn sich technische Grenzen für die Durchführung abzeichnen, ist der Ausbildungsbetrieb bzw. die überbetriebliche Ausbildungswerkstatt mit einzubeziehen.
• Prüfung von Haftung und Gewährleistung.
• Gespräch bzw. Verhandlung mit dem Kunden.
2. Schritt: Planung
Die Planung wird zunächst durch eine „Ideenphase“ bestimmt. Hier ist besonders die Kreativität der Beteiligten gefordert. In einer nachfolgenden Phase befasst man sich mit den Arbeitsabläufen, wobei ein computergestütztes Produktionsplanungssystem (PPS) zur Anwendung kommt.
3. Schritt: Durchführung
Die Durchführung basiert idealerweise auf den geplanten Arbeitsschritten. Ganz entscheidend kommt es in dieser Phase darauf an, inwieweit dynamisch und flexibel auf sich einstellende Situationen und Ergebnisse reagiert werden kann. Lernchancen liegen gerade hier verborgen, indem den Beteiligten die Möglichkeit gegeben wird, aktiv einzugreifen, die Konsequenzen unmittelbar mit zu verfolgen und daraus mögliche Schlussfolgerungen ziehen zu können. Ein reflexives Erfahrungsfeld wird dadurch ermöglicht.
4. Schritt: Kontrolle und Korrekturen
Entsprechend der modernen Fertigungsphilosophie wird Qualität von vornherein produziert und nicht erst am Ende des Prozesses durch einen Überprüfungsvorgang ermittelt. Diese durchaus idealistische Vorstellung ist auf die Ausbildungsverhältnisse hin anzupassen. Im Falle von Korrekturen kann eine Rücksprache mit dem Auftraggeber möglicherweise zu konstruktiven Änderungen führen. Hier ist der Dialog aller Beteiligten unverzichtbar. Anpassungen und Modifikationen müssen auf ihre Konsequenzen hin bewertet werden.
5. Schritt: Übergabe
Hier fließt alles das zusammen, was während des gesamten Produktionsprozesses im Netzwerk der Daten- und Materialflüsse dynamisch beeinflussbar war. Das Ergebnis des ganzheitlichen Prozesses liegt nun vor. Im Vergleich zur Auftragsannahme befinden sich die Lerner jetzt allerdings auf einer anderen Erfahrungsebene.
6. Schritt: Auswertung
Auswertung und Reflexion sind pädagogisch unverzichtbare Elemente einer vollständigen Handlung. Lernpotenziale wurden während des Produktionsprozesses genutzt und haben damit zu einem veränderten Ausbildungs- und Entwicklungsstand geführt. Diese pädagogische Differenz ist von den Lehrkräften und Lernern gemeinsam herauszuarbeiten.
An dieser sechsstufigen Auftragsstruktur wird die Komplexität der Aufgabenstellung erkennbar, welche sich mit geeigneten Lern- und Arbeitsaufgaben (die einem vollständigen Handlungszyklus entsprechen) erschließen lässt.
In dem hier skizzierten Modell einer Lernfabrik sollen die betrieblichen Funktionsbereiche in erster Linie repräsentiert werden durch einen technischen Entwicklungs- und Fertigungsbereich und ferner durch einen kaufmännischen Verwaltungs- und Organisationsbereich. Diese Funktionsbereiche sind gleichzeitig Lernbereiche; sie sind einer gewerblichen Berufsschule, einer kaufmännischen Berufsschule und je nach Bedarf einem Ausbildungsbetrieb zugeordnet (siehe Abb. 2). Eine informationstechnische Verbindung der drei Lernorte bildet die technisch-funktionale Grundlage eines Lernortverbundes.
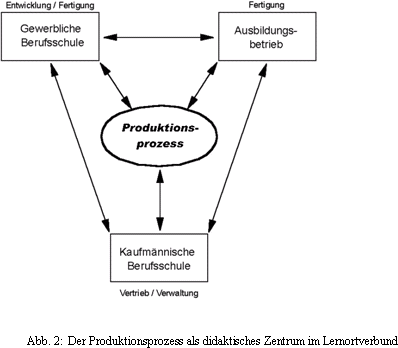
Ein Ausbildungsbetrieb oder eine überbetriebliche Ausbildungswerkstatt ist als dritter Partner für den Fall notwendig, dass z.B. die gewerbliche Berufsschule nicht über entsprechende technische Voraussetzungen (Werkzeugmaschinen, z. B. Bearbeitungszentrum) verfügen sollte.
In der Lernfabrik werden nicht die von vornherein festgelegten, ausbildungsbezogenen Bedingungen und Anforderungen durch Lehrpläne greifen, sondern die Inhalte werden situativ und bedarfsgerecht durch die Aufgabenstellung und den Ablaufprozess in der Produktion bestimmt; sie werden dann existent, wenn sie benötigt werden. In diesem Ansatz verbirgt sich durchaus das bekannte Spannungsverhältnis zwischen Ökonomie und Pädagogik, worauf im Rahmen der Produktionsschuldiskussion bereits mehrfach hingewiesen worden ist. Es kommt immer darauf an, dass die Lernchancen in einem Realauftrag entdeckt und genutzt werden. Die Komplexität einer Lernfabrik erfordert allerdings aus schulorganisatorischer Perspektive prinzipiell eine umfassende, ganzheitliche Denk- und Vorgehensweise. Mithin dürfte klar geworden sein, dass traditionelle Fächerstrukturen nicht mehr ins Bild passen.
In der Lernfabrik wird der rechnerintegrierte Produktionsprozess mit seinen Vernetzungen im Zentrum des Gesamtsystems betrachtet. Eine darauf abgestimmte Struktur von Lernbereichen muss deshalb drei Kriterien berücksichtigen:
• Die vier wichtigsten betrieblichen Funktionsbereiche Entwickeln, Fertigen, Vertreiben und Verwalten sollen verwirklicht werden. Mit diesen Arbeits- und Lernbereichen lassen sich die Vernetzungen in einem überschaubaren Maß darstellen.
• Anwendung von „CAx-Technologien“, wie CAD, CAP, CAD/CAM, CAQ ermöglichen eine rechnergestützte betriebliche Datenerfassung und -verarbeitung.
• Flexibilisierung in der Entwicklung, den Produktionsabläufen, den betriebswirtschaftlichen Prozessen und der Arbeitsorganisation ist durch Rechnerunterstützung (PPS) möglich.
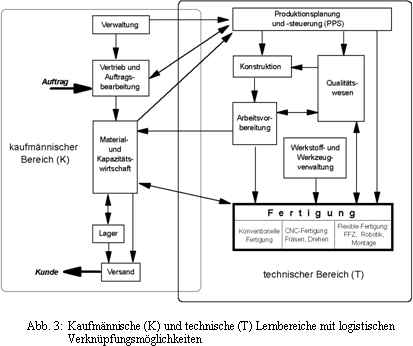
Der Lernbereich Fertigung ist das produktionstechnische Kernstück der Lernfabrik. Hier entsteht das Produkt und im Verlauf der Auftragsabwicklung wird die Prozesskette an dieser Stelle sinnlich erfassbar. In Abb. 3 sind nur solche Lernbereiche dargestellt, die unmittelbar zum Betriebsgeschehen gehören. Eine vollständige Lernumgebung umfasst darüber hinaus auch solche Bereiche, die nicht betriebstypischer Natur sind. Dazu zählen z.B. systematisch organisierte Lehrgänge oder Lehrgangsabschnitte mit solchen Inhalten fachspezifischer Grundlagen, die zum Betreiben der Gesamtanlage erforderlich sind (Steuerungstechnik, SPS, Pneumatik, Hydraulik, Programmierung). Diese Anteile werden je nach Bedarf zum gesamten Lernszenario des Produktionsprozesses als Lehrgänge dazugeschaltet. Aus den in Abb. 3 dargestellten logistischen Verknüpfungen entsteht jetzt unter Berücksichtigung aller Planungskriterien ein differenzierteres Aufgabenprofil.
Der Anspruch auf Lernen in komplexen Systemen führt zu einer besonderen didaktischen Herausforderung. Es handelt sich, wie schon erwähnt, um Komplexität in systemischen Zusammenhängen; die Lernumgebung wird also in ein System integriert sein. Die Lernbereiche eignen sich in der Weise, als sie mit ihren zusammenhängenden Regelkreisen selbst systemische Strukturen enthalten. In ihrer Gesamtheit repräsentieren sie auf jeder Lernebene und in jedem Ausschnitt jeweils ein Abbild des komplexen Systems eines Betriebes. Insofern wird auf Komplexität nicht verzichtet, sondern sie wird überschaubar erlebt. Um den systemischen Charakter des Produktionsprozesses in der Lernfabrik erfassen zu können, werden in den einzelnen Lernbereichen Handlungsstrukturen aus vollständigen Tätigkeiten aufgebaut. Vollständig sind sie aber nur, wenn ein rekursiver und reflexiver Durchlauf vom Planen bis zur Abrechnung stattfindet. Um dies sicherzustellen, werden die Tätigkeiten in sämtlichen Lernbereichen der Lernfabrik mit so genannten Handlungselementen beschrieben und in einer Gruppe zusammengefasst (siehe Abb. 4). Diese Vorgehensweise ist für die Fertigung nicht etwa „typischer“ als für die Konstruktion oder für die Verwaltung. Prinzipiell haben alle Handlungselemente die gleiche Bedeutung, wobei es durchaus zu Unterschieden in der Gewichtung kommen kann. Auf diese Weise wird es möglich, Vernetzungen quer über die Lernbereiche im Gesamtsystem zu erkennen und im Arbeitsprozess zu nutzen. Grundlage hierfür ist, dass immer mehrere Lernbereiche einbezogen werden.
Die höchste Komplexität wird erreicht, wenn alle Lernbereiche untereinander mit jedem Handlungselement verknüpft sind. Über die Herstellung von Querbeziehungen lässt sich eine didaktisch begründete Aussage über die Integration von Handlungsstrukturen innerhalb der Komplexität des Gesamtsystems gewinnen. Die Gesamtkomplexität der Lernfabrik kann somit in kontinuierlich zunehmender Erweiterung durch Bearbeitung aller Lernbereiche handlungspsychologisch erschlossen werden. In Abb. 4 sind drei verschiedene Erarbeitungszustände dargestellt:
• Das kleine Oval überstreicht einerseits die Lernbereiche Fertigung, Werkstoff- / Werkzeugverwaltung und Arbeitsvorbereitung sowie andererseits die Handlungselemente Planen, Entscheiden, Ausführen. Obwohl die hauptsächlichen Aktivitäten berücksichtigt werden, kann in diesem Fall noch nicht von vollständigen Tätigkeiten gesprochen werden. Die Pfeile deuten den rekursiven Durchlauf der Handlungselemente an.
• Das mittelgroße Oval überstreicht bereits sieben Lernbereiche und vier Handlungselemente. Hier sind wesentlich mehr gegenseitige Verknüpfungen zu bearbeiten, was einem Zuwachs an Komplexität entspricht.
• Mit dem großen Oval wird angedeutet, dass alle Lernbereiche mit allen Handlungselementen verschränkt sind. Die Komplexität hat somit den höchsten Grad erreicht.
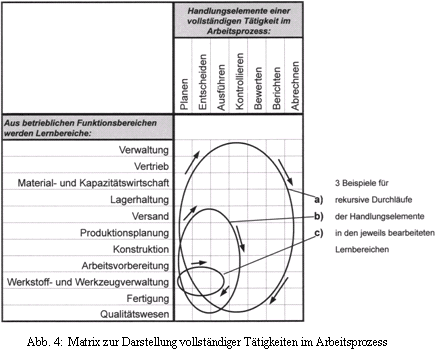
Die Lernfabrik erhält von einem Lehrmittelvertrieb einen Fertigungsauftrag. Es handelt sich um Einzelteile des in der Abbildung 5 dargestellten Kolbenkompressors einer Drucklufterzeugungsanlage (vgl. DIECKMANN 1996, 91 f.).
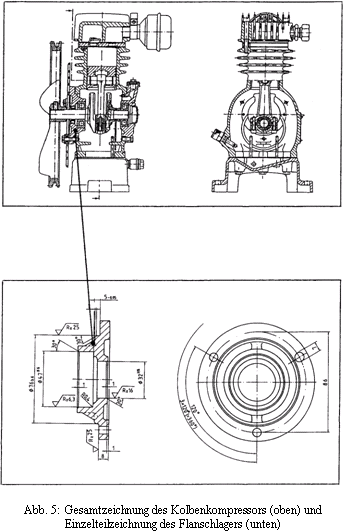
Von der kaufmännischen Berufsschule werden Auftragsverwaltung und Zukauf der vorgefertigten Komponenten übernommen. Die gewerbliche Berufsschule ist für die eigentliche Produktion zuständig; sie fertigt die Einzelteile und sorgt für die Zusammenstellung des Bausatzes. Der Ausbildungsbetrieb übernimmt die Fertigung derjenigen Teile, die aufgrund technischer Bedingungen von der Schule nicht geleistet werden können. Der Kolbenkompressor ist einerseits das herzustellende Objekt und fungiert andererseits im Herstellungsprozess als Lernträger in mehreren Lernfeldern des Ausbildungsberufes Industriemechaniker (KMK 2004, 8). Aber auch zu den bisherigen fachspezifischen Lernbereichen ergeben sich ausreichende, sogar fächerübergreifende Bezüge, wie z.B.:
• Wirtschafts- und Betriebslehre
• Technische Kommunikation
• Technische Mathematik
• Maschinen- und Gerätetechnik
• Fertigungs- und Prüftechnik
• Werkstofftechnologie
• Informationstechnik
Betrachtet wird in diesem Fall exemplarisch ein Ausschnitt aus der Herstellung. Es geht um einen Lagerflansch – ein Teil aus der Funktionsgruppe „Gehäuse“. Dieses Stück wird als rohes Gussteil angeliefert und soll in der Lernfabrik spanend feinbearbeitet werden. Es sind mehrere Bearbeitungsgänge (Bohren und Plandrehen) auszuführen. Hinsichtlich der Maßhaltigkeit und Oberflächengüte werden an den Flansch Qualitätsanforderungen gestellt, die als Ergebnis einer Facharbeit im Rahmen der Ausbildung von Industriemechanikern zu leisten sind. Aus didaktischen Gründen liegt den Berufsschülern keine Einzelteilzeichnung vor, sie erhalten lediglich eine Gesamtzeichnung des Kolbenkompressors und werden nur über die wichtigsten Rahmendaten informiert. Alle sich daraus ergebenden Einzelmaßnahmen müssen von den Schülern selbst geplant und durchgeführt werden: Erstellung von Fertigungszeichnung, Arbeits-, Ablauf- und Terminplänen sowie CNC-Programmen. Ferner ist der Informationsaustausch zwischen den technischen und kaufmännischen Lernbereichen aufzubauen. Durch Einspeisung der Betriebs- und Produktionsdaten wird die Dynamik des Netzwerkes realer Bestandteil der Lernfabrik. Damit sind Voraussetzungen für eine vollständige Auftragsbearbeitung gegeben.
Die Einfädelung in den Produktionsprozess beginnt in der Auftragsbearbeitung und wechselt von dort aus in den produktiven Bereich und zwar zunächst an die Informationsinsel , einer Zusammenfassung der Lernbereiche Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Produktionssteuerung. Das Inselprinzip besagt, dass dort anstelle eines einfachen Datenaustausches eine Datenintegration stattfinden soll. In den betroffenen Lernbereichen werden alle Lerner von vornherein im Team arbeiten, um bereits im Vorfeld Konstruktionsfehler zu vermeiden. Es gilt der Grundsatz, dass Fehler nicht erst bei der Arbeitsplanung unmittelbar vor der Fertigung erkannt werden sollen. Wenn der Auftrag freigegeben wird, geht er weiter an die Fertigungsinsel zur Komplettbearbeitung. In diesem Bereich befinden sich alle zur vollständigen Fertigung benötigten Fertigungseinrichtungen, unterstützt durch die Werkstoff- und Werkzeugverwaltung und das Qualitätswesen.
Nach der Herstellung wird das Produkt schließlich dem Lager zugeführt. Wenn in vergleichbarer Weise die Herstellteile aller anderen Funktionsgruppen den Produktionsprozess durchlaufen haben, kann der technische Teil des Auftrages abgeschlossen werden. Die restliche Abwicklung (Buchhaltung, Nachkalkulation, Auslieferung) der kompletten Bausätze des Kolbenkompressors wird von der kaufmännischen Berufsschule übernommen.
DIECKMANN, H. (1996): Technische Kommunikation für Metallberufe, Grundbildung. Bad Homburg vor der Höhe.
GREINERT, W.-D./ WIEMANN, G. (Hrsg.) (1992): Produktionsschulprinzip und Berufsbildungshilfe. Baden-Baden.
KULTUSMINISTERKONFERENZ (2004): Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/Industriemechanikerin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.03.2004).
LÜTJENS, J. (1999): Berufliche Erstausbildung in komplexen Lehr- und Lernsituationen. Die „Lernfabrik“ als produktions- und prozessorientiertes Qualifikationskonzept im Berufsfeld Metalltechnik. Bremen.