|
| ||





Die Förderung „unternehmerischen Denkens und Handelns“, die Ausbildung von „Unternehmergeist“ oder „Entrepreneurship“ sind unter dem Einfluss der aktuellen Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise in den Blickpunkt von Politik und Wirtschaft geraten. Der „Unternehmensgründer“, der oder die selbständige Mittelständler(in) sind die neuen Heroen einer „mittelstandsorientierten“ Wirtschaftspolitik. Entsprechend wird gefordert, materiell und ideell die Voraussetzungen für Unternehmensgründungen oder den Einstieg in das Unternehmertum in Form von Geschäftsübernahmen zu schaffen. Hierüber erhalten auch didaktische Ansätze neue Legitimation und entsprechenden Auftrieb, die dazu geeignet scheinen, solche Bildungsprozesse zu ermöglichen. Unter Bezeichnungen wie „Juniorenfirmen“, „Juniorenprojekte“, „Schülerfirmen“ oder „Junior-Live-Projekte“ hat sich eine breite Kultur von „Jungunternehmern“ nicht nur an berufsbildenden Schulen und in ausbildenden Betrieben sondern zunehmend auch an allgemeinbildenden Schulen etabliert und findet dort öffentliche Aufmerksamkeit und fördernde Unterstützung.
Im Vordergrund steht hierbei häufig die Idee, über den „Ernstcharakter“ dieser Projekte vor allem Einstellungen und Werthaltungen im Sinne einer „Kultur unternehmerischer Selbständigkeit“ beeinflussen zu können, und gerade aus dieser Haltung heraus wird häufig relativ scharfe Opposition zu breiter etablierten Formen komplexer Unternehmenssimulationen, wie der Lernbüro- oder Übungsfirmenarbeit eingenommen. Und auch dort, wo dies so pointiert nicht erfolgt, wird meist doch versäumt, diese verwandten Modelle genauer in Augenschein zu nehmen, um von deren Stärken und Schwächen für die Weiterentwicklung der eigenen Konzeption zu lernen.
Diese kritische Reflexion sollte schon bei der Zielsetzung „Förderung der Selbständigkeit“ ansetzen und diese weniger in bezug auf (kurzfristige) gesellschaftliche Trends interpretieren, sondern stärker aus pädagogisch-aufklärerischer Perspektive die personale Selbständigkeit in beruflichen Kontexten und darüber hinaus in den Blick nehmen. Sie sollte weiterhin den Blick auf die Besonderheiten des Lernens in simulativen Umwelten richten und nach den Bedingungen und Kriterien für handlungs- und problemorientiertes Lernen in Lernfirmen fragen. Und sie sollte schließlich die Potenziale und Grenzen der verschiedenen Modelle im Hinblick auf dieses normative Konzept der Lernfirma analysieren und schließlich auch unter dem Aspekt Ihrer Kombinierbarkeit betrachten.
Dies ist die Agenda des vorliegenden Beitrages.
„Förderung der Selbständigkeit“ – wie häufig bei solch schillernden Slogans fällt es schwer, zwischen Versprechen und Leistung, zwischen Propaganda und Realität zu unterscheiden. Schon auf der begrifflichen Ebene herrscht beträchtliche Verwirrung. Im Hinblick auf dieses Ziel kann zwischen vier Bedeutungsebenen unterschieden werden:
• Der Ebene “ unternehmerischer Selbständigkeit “, die mit wirtschaftlicher Selbständigkeit einhergeht. In diesem Sinne sind Selbständige solche Personen, „die ihr Einkommen am Markt und auf eigene Rechnung und Verantwortung und auch als Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter unter Risiko erzielen“ (GRUHLER 1996, 11). Selbständige auf dieser Ebene sind „Unternehmer“, „Existenzgründer“ und eben keine „Scheinselbständigen“. Entrepreneurship ist das Leitbild (vgl. z. B. FALTIN / RIPSAS/ ZIMMER 1998).
• Hiervon zu unterscheiden ist auf der nächsten Ebene die „ berufliche Selbständigkeit “, worunter im Sinne einer Disposition die Fähigkeit zum kompetenten und verantwortlichen betrieblichen Handeln auf der Basis verstandener und akzeptierter betriebliche Ziele und Strategien verstanden wird. Konstitutiv hierfür sind eine abhängige Beschäftigung sowie das Vorhandensein und die Wahrnehmung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen für den Mitarbeiter, die von ihm kognitive Leistungen im Hinblick auf Orientierung, Zielbildung, Planung, Ausführungsregulation, Kontrolle und Rechenschaftslegung verlangen. Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Postulat kunden-, qualitäts- und kostenorientierten beruflichen Handelns gewonnen, wobei zunehmend auch im Zuge arbeitsteiliger Prozesse innerbetriebliche Lieferanten-Kunden-Beziehungen konstruiert werden. In diesem Zusammenhang wird von „ Intrapreneurship “ gesprochen.
• Eine Variante der beruflichen Selbständigkeit, der „ Arbeitskraftunternehmer “ (z. B. VOß/ PONGRATZ 1998) bzw. das „ Selbstmarketing “ (CARNEGIE 1949/2002; HERBST 2003), ist die Bereitschaft und Fähigkeit zur Erhaltung, Entwicklung und Vermarktung der eigenen Arbeitsleistung. Dies ist eine Perspektive, die angesichts sich zunehmend diversifizierender Beschäftigungsformen und der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes erheblich an Bedeutung gewinnen dürfte (vgl. z. B. DOSTAL 2002, 13ff.).
• Die Ebene der personalen Selbständigkeit bezieht sich schließlich auf das genuin pädagogische Ziel der Förderung von Autonomie und Mündigkeit des Subjekts, eine umfassenden Orientierungs-, Urteils- und Handlungsfähigkeit mithin, die es dem Einzelnen erlaubt, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, auszufüllen und zu gestalten und somit ein erfülltes und sozial-verantwortliches Leben zu führen.
Mit diesen Ebenen sind jeweils klar unterscheidbare Kontexte der Lebensgestaltung angesprochen. Die zugrunde liegenden kognitiven, motivationalen und volitionalen Anforderungen an das Subjekt weisen allerdings weitgehende Parallelen auf. In diesem Sinne wird verbreitet auch von einer „Koinzidenz pädagogischer und ökonomischer Vernunft“ gesprochen (vgl. z. B. ACHTENHAGEN et al. 1992).
Unabhängig davon wird den Schulen, aber auch der betrieblichen Erstausbildung, häufig vorgeworfen, zu sehr auf die Perspektive abhängiger Beschäftigung fixiert zu sein und jene der wirtschaftlichen Selbständigkeit zu vernachlässigen. Ein Indiz hierfür könnte man im Wechsel des Leitbildes des Wirtschaftslehreunterrichts vom Ideal des (selbständigen) „königlichen Kaufmanns“ zum weisungsabhängigen „kaufmännischen Angestellten“ sehen.
Soll und darf man hieraus die Konsequenz ziehen, Berufsfachschüler und Berufsschüler auf die Option wirtschaftlicher Selbständigkeit hin auszubilden? Mit Ihnen z. B. Themen wie „Unternehmensgründung“, „Business Plan“ u. ä. bearbeiten oder mit ihnen unter dieser Zielperspektive Juniorenfirmen gründen und betreiben?
Wir sind hier sehr skeptisch. Einschlägige Analysen des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen, dass für den Schritt in die Selbständigkeit neben einem Bildungsabschluss und beruflicher Qualifizierung die einschlägige berufliche Erfahrung eine wesentliche Voraussetzung ist (IDW 1997, 17ff). Die Erstausbildung führt in aller Regel nicht direkt in die wirtschaftliche Selbständigkeit, die unmittelbare und gezielte Vorbereitung hierauf ist eine Domäne der Weiterbildung. Der Beitrag der Erstausbildung zu einer Vorbereitung auf die wirtschaftliche Selbständigkeit sollte nach unserer Auffassung darin bestehen, die Schüler und Auszubildenden konsequent auf die berufliche und personale Selbständigkeit hin auszubilden und zu fördern. Und genau hierin sehen wir auch die berechtigte Kritik an der bisherigen Ausbildungspraxis, dass sie nämlich lange Zeit (und z. T. noch immer) zu stark an der Vorbereitung auf (i. d. R. nicht valide ) Prüfungen hin orientiert war oder aber weiterhin in praktizistischer Verengung einer Schreib- und Ladentischperspektive verhaftet blieb, wie sie in den 1970er Jahren schon REETZ und WITT (1974) kritisierten. Hier haben Ausbildungsordnungen seit Anfang der 1990er Jahre und Rahmenlehrpläne spätestens seit der Ausrichtung am Lernfeldkonzept deutlich neue Akzente gesetzt – nämlich in Richtung auf den selbständig und verantwortlich handelnden kaufmännischen Fallbearbeiter, in Richtung also auf berufliche Selbständigkeit.
Fragt man nun nach den Merkmalen unternehmerischer Selbständigkeit, und diese könnten ja zumindest auch ein Bezugspunkt im Hinblick auf berufliche Selbständigkeit sein, so findet man in der Regel Listen idealer Persönlichkeitsmerkmale, die gleichermaßen unspezifisch, allgemein und beliebig erscheinen (vgl. hierzu z. B. die Beiträge in FALTIN et al. 1998 oder BLK 1997, 10).
Interessant und auch direkter auf den Typus des beruflich Selbständigen beziehbar scheint uns eine prozessbezogene Systematik von STEVENSON und GUMPERT, bei der sie Entrepreneurship im Kontext einer Verhaltensskala von Managern zwischen den Polen „Promoter“ und „Verwalter“ verorten (1998, 94f., ähnlich auch BRAUN 1998, 108). „Manager, die auf der Skala näher am Promoter-Typ liegen, denken und handeln unternehmerischer als die, die dem Verwalter-Typ näher stehen“.
Typischerweise frage der Promoter :
• Wo liegt die Möglichkeit?
• Wie kann ich sie gewinnbringend nutzen?
• Welche Ressource brauche ich?
• Wie kann ich die Verfügung darüber erlangen?
• Welche Struktur ist die Beste?
Demgegenüber stellt der Verwalter eher die Fragen:
• Welche Ressourcen habe ich zur Verfügung?
• Welche Struktur bestimmt unser Handeln am Markt?
• Wie kann ich den Einfluss anderer auf mein Handeln verringern?
• Welche Handlung ist angemessen?
Kennzeichnend für den Promoter sei der Blick nach außen, die Orientierung auf den Markt und die sich dort auftuenden Chancen hin, während der Verwalter eher den Blick nach innen, auf die Sicherung der eigenen Ressourcen und Strukturen gerichtet habe. Der Verwalter schaue von den Strukturen zu den Prozessen, der Promoter von den Prozessen zu den Strukturen (ebenda).
Auf den ersten Blick fällt auch hier auf, dass sehr stark Persönlichkeitsmerkmale und Handlungsstile betont werden. Bei genauer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass diese Attitüden sehr stark auch mit den Modellvorstellungen wirtschaftlichen Handelns zu tun haben, mit den handlungsleitenden Annahmen über den Zusammenhang von Markt und Unternehmen, von Prozess und Struktur, von Sachleistung und Gewinnerzielung. Es geht zwar auch um Denkstil und Mut zum Risiko, zugleich wird jedoch deutlich, dass dies keine abstrakten und allgemeinen Merkmale sind, sondern dass sie sich konkret auf wirtschaftliches Handeln beziehen und durch spezifische Modellverstellungen über wirtschaftliche Zusammenhänge und Prozesse erst ihre spezifische Zuspitzung und Relevanz erhalten. Die Ausbildung unternehmerischen Denkens und Handelns ist mithin nicht abstrakte und kontentunabhängige Persönlichkeitsentwicklung im Sinne formaler Bildungstheorien, sondern sie bliebe ohne die gleichzeitige Ausbildung domänenspezifischer Wissensstrukturen gegenstands- und wirkungslos.
Plastischer wird diese Einsicht dann, wenn man entlang der Kategorien unternehmerischen Denkens im Sinne des Entrepreneurship nach den jeweils zugehörigen ökonomisch-inhaltlichen Komponenten fragt:

Ein Bericht der BUND-LÄNDER-KOMMISSION für Bildungsplanung und Forschungsförderung zur Aus- und Weiterbildung zur unternehmerischen Selbständigkeit für Absolventen des beruflichen Bildungswesens aus dem Jahre 1997 (15) gelangt zu der Empfehlung, dass die beruflichen Schulen die Orientierung an beruflicher und unternehmerischer Selbständigkeit intensivieren sollten. Als didaktisches Mittel hierfür werden allgemein handlungsorientierte Unterrichtsformen und speziell Lernbüros, Juniorfirmen, Projektunterricht, Praktika oder spezifische Arbeitsaufträge genannt.
Offen bleibt dabei allerdings, worin der spezifische Beitrag dieser Lehr-Lern-Arrangements für die Ausbildung unternehmerischen Denkens und Handelns gesehen wird. Dieser Frage soll mit Blick auf die drei in dieser Ausgabe schwerpunktmäßig behandelten Varianten der Unternehmenssimulation auf operativer Ebene im nächsten Schritt nachgegangen werden.
In einem weit zurückreichenden Entwicklungsprozess haben sich, ausgehend von den merkantilistischen Übungskontoren des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, drei Grundmodelle oder Typen der komplexen Unternehmenssimulation unter Einbeziehung konkreter kaufmännischer Tätigkeiten ausgebildet. Es handelt sich dabei in aktueller, wenngleich durchaus nicht einheitlicher und unumstrittener Terminologie um das Lernbüro, die Übungsfirma und die Juniorenfirma (vgl. zur Abgrenzung das Editorial in diesem Band) .
Solche Varianten operativer Unternehmenssimulationen waren lange als Orte der Konzentration, der übenden Anwendung und des Praxistrainings konzipiert und damit auf eine Ergänzungs- bzw. Ersatzfunktion im Verhältnis zu anderen, dominierenden didaktischen Lernorten festgelegt. Erst über die Konzeption der „ Lernfirma“ wurde das innovative Potential dieser Arrangements deutlich herausgearbeitet, wodurch sie auch als Instrumente zur Förderung unternehmerischen Denkens und Handelns in den Blick kamen.
Das Konzept der Lernfirma geht auf den Hamburger Wirtschaftspädagogen Lothar REETZ zurück (siehe dazu inbesondere die beiden Veröffentlichungen in dieser Ausgabe: REETZ 1977/ 2006 und REETZ 1986/ 2006), der hiermit aus einer kognitions- und handlungstheoretisch fundierten didaktischen Perspektive heraus das innovative Potential des Lernens in simulativen kaufmännischen Lernumwelten beschrieben hat. Als „ Lernort eigener Prägung “ kann und soll hier eine Verknüpfung situationsbezogenen und systematischen Lernens erfolgen und damit ein Ansatz zur Überwindung des traditionellen Theorie-Praxis-Dualismus im beruflichen Lernen gefunden werden (vgl. TRAMM 1996b). Lernbüros, Übungsfirmen und Juniorenfirmen sind damit deutlich mehr als punktuelle Ergänzungen systematischen Lernens in der Phase der Konzentration und übenden Anwendung oder ein aus der Not geborener Ersatz des genuin überlegenen Lernortes Betrieb. Sie bieten vielmehr potentiell Lernmöglichkeiten, die mit keinem anderen Lehr-Lern-Arrangement erreicht werden können.
Die Lernfirma stellt in diesem Sinne ein komplexes Handlungs- und Erfahrungsfeld für Lernende dar, das es ihnen grundsätzlich erlaubt, betriebliche und volkswirtschaftliche Strukturen und Prozesse konkret und aus der Perspektive des im Modell handelnden Akteurs zu erfahren und zu reflektieren. Hierbei stünde die Arbeit in der Lernfirma nicht am Ende eines Lehrgangs, sondern wäre von Beginn an ein integraler und zentraler Bestandteil des Curriculums. Sie kann es den Schülern ermöglichen, erstmals betriebliche und Marktstrukturen kennen zu lernen und zu erkunden, sie kann dazu dienen, fachlich relevante Probleme oder Fragen am Beispiel eines vertrauten Modellunternehmens zu entdecken, sie kann dazu dienen, Problemlösungen zu erarbeiten, umzusetzen und zu bewerten und sie kann dazu dienen, vorgegebene Arbeitsstrukturen und -techniken zu verstehen, sich anzueignen und kritisch zu hinterfragen.
Ohne diese Konzeption hier im Detail zu entfalten (vgl. dazu TRAMM 1996a; TRAMM/ BAUMERT 1992; GRAMLINGER 2000), wollen wir vier präzisierende Akzente setzen:
1. Akzent: Lernfirmen sind keine naturalistischen Abbilder der Wirklichkeit, sondern didaktische Konstruktionen.
Realitätsnähe ist für sich genommen kein geeignetes Gestaltungs- oder Beurteilungskriterium für die Lernfirmenarbeit. Lernfirmen sind didaktische Simulationsmodelle, die einen bestimmten Gegenstand (eine Unternehmung in ihrer Umwelt) in seiner Struktur und seiner Dynamik darstellen, um hierin und hieran Lernprozesse in optimaler Weise zu ermöglichen. Diese Simulationen sind nicht einfach ein Abbild „der Realität“, denn erstens gibt es diese Realität nicht im Singular. Es gibt nicht „den“, sondern unzählig viele Betriebe; von „der“ Unternehmung zu sprechen ist nur auf der Ebene wissenschaftlicher Abstraktion möglich – diese aber ist per se im Konkreten undefiniert und deshalb auch nicht ohne einen Prozess der Rekonkretisierung darstellbar. Zweitens liegt der Nutzen von Modellen genau darin, dass sie zwar ihrem Original so weit ähneln, dass hier sozusagen stellvertretend Erfahrungen gemacht werden können, dass sie sich aber zugleich so weit vom Original unterscheiden, dass hier Erfahrungen möglich sind, die das Original nicht ermöglicht. In diesem Spannungsfeld operierend werden Lernfirmen nach Maßgabe der pädagogischen Intentionen von den Lehrenden gestaltet. Modelle sollen in diesem Sinne auch als Instrument verwendet werden, um Realität wahrzunehmen und sich in der Realität zu orientieren.
2. Akzent: Lernfirmen sind Orte des Lernens im umfassenden Sinne, nicht nur des Anwendens, der Übung oder des Praxistrainings
Üben und Anwenden oder, moderner formuliert, Training sind traditionell dominierende Anwendungsbereiche von Wirtschaftssimulationen (siehe dazu TRAMM 1994). Deren Funktionen können heute den Einsatz einer solchen Simulation nicht mehr rechtfertigen und sie dürften zugleich hinter deren tatsächlichen Möglichkeiten weit zurückbleiben. Mit dem Lernfirmenkonzept verbindet sich ein deutlich weiter gehender Anspruch, der ausgehend von einer handlungsorientierten Didaktik beruflichen Lernens in Verbindung mit einer Konzeption situierten Lernens in komplexen Lehr-Lern-Arrangements Lernen als einen Prozess des Aufbaus und der Ausdifferenzierung von Wissen, Können und Einstellungen aus der aktiven Auseinandersetzung mit praxisanalogen Problemstellungen konzeptualisiert. Lernfirmen erscheinen in diesem Konzept als komplexe Handlungs- und Erfahrungsräume im Hinblick auf relevante kaufmännisch-ökonomische Lerngegenstände und müssen zugleich Herausforderungen und Chancen zur begrifflichen Reflexion und Systematisierung dieser Erfahrungen eröffnen. Dabei sollen die Lernenden ihr Vorwissen und ihre Kompetenzen zur Strukturierung und Bewertung ihrer Wahrnehmungen, zur Entwicklung und Umsetzung von Lösungsideen und zu deren Bewertung aktiv einbringen, bevor diese mit konventionellem, professionellem und auch wissenschaftlichem Wissen konfrontiert und ergänzt werden.
LiM bedeutet, dass die Schüler im konkreten Modellkontext operative und strategische wirtschaftliche Aufgaben- und Problemstellungen bearbeiten können und sollen. Dabei ist ihre Sichtweise die von Mitarbeitern in einem Unternehmen, in dem sie ihre Kompetenzen und ihr Wissen aufbauend auf dem je vorhandenen Vorwissen entwickeln. Die Lernenden „tauchen in das Modell ein“, sie treten als handelnde (und lernende) Subjekte im Modell auf.
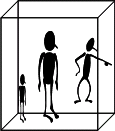
LaM (Lernen am Modell) dagegen macht das Modell selbst zum Thema: Am Beispiel des Modells sollen die Lernenden transferfähiges Wissen und übertragbare Kompetenzen erwerben. Dabei treten die Lernenden wieder aus dem Modell heraus, sie schaffen eine gewisse Distanz, machen das Modell zum Objekt des Lernhandelns und thematisieren das Objekt und das eigene Handeln und Lernen gleichsam aus der Vogelperspektive. Begriffliche Reflexion und Systematisierung der Erfahrungen sind dabei die wesentlichen Leistungen.
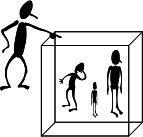
LiM und LaM sind geprägt durch ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Beides ist notwendig, um Vorbild und Abbild (Realität und Modell) aufeinander beziehen und in weiterer Folge auch den Transfer auf verschiedene Realitäten leisten zu können.
Lernfirmen als dynamische Prozessmodelle wirtschaftlicher Systeme erlauben es, Unternehmungen in ihrer vollen Komplexität darzustellen und so den Lernenden zugleich ein komplexes Handlungs- und Erfahrungsfeld zu eröffnen.
Der Aspekt der Komplexität lässt sich in dreifacher Hinsicht spezifizieren:
• Zunächst werden mit dem Modellunternehmen die Aspekte Zweck, Ziel, Prozess und Struktur in einen dynamischen Zusammenhang gestellt: Alle betriebwirtschaftlichen Überlegungen im Kontext des Modells müssen die Marktleistung der Unternehmung (Zweck) ins Auge fassen, sie müssen die darauf bezogenen Leistungsprozesse innerhalb der Unternehmung thematisieren (Prozess), sie müssen die vorhandene und ggf. zu optimierende Aufbau- und Ablauforganisation der Unternehmung (Struktur) berücksichtigen, und sie müssen schließlich erkennen, dass diese Prozesse und Strukturen im Hinblick auf den Wertschöpfungsprozess und das darauf bezogene Formalziel (Ziel) der Unternehmung zu gestalten sind. Diesen Zusammenhang kann man auf einem sehr einfachen, wenig differenzierten bzw. elaborierten Niveau thematisieren, und er bleibt bis hin zu den Modellen der wissenschaftlichen Betriebswirtschaftslehre der Erkenntnisgegenstand.
• Durchaus verbunden mit dieser Differenzierung lassen sich auf einer anderen Ebene verschiedene Schichten oder Dimensionen des betrieblichen Geschehens bzw. des Systems Unternehmung unterscheiden (siehe Abbildung 2). Je nach spezifischem Erkenntnis- oder Gestaltungsinteresse kann die Unternehmung thematisiert werden (vgl. ULRICH
• als technisches bzw. logistisches System, womit insbesondere der Leistungsprozess und der Zweckbezug der Unternehmung sowie die Ströme von Real- und Nominalgütern thematisiert werden;
• als Wertschöpfungssystem, womit die betrieblichen Leistungsprozesse auf der Wertebene abgebildet und auf ihren Beitrag zur Erreichung des Formalziels hin betrachtet werden;
• als soziales System, womit primär die formalen und informellen Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen in einer Unternehmung sowie zwischen der Unternehmung und ihrem Umsystem thematisiert werden;
• als Informationssystem, womit insbesondere die Überlagerung aller Systemebenen durch Informationsströme und Informationsbestände thematisiert wird, die dazu dienen, die Leistungsprozesse anzubahnen, vorzubereiten, zu organisieren, zu dokumentieren und auszuwerten und sie schließlich im Hinblick auf ihren Beitrag im Wertschöpfungsprozess zu analysieren und zu bewerten.
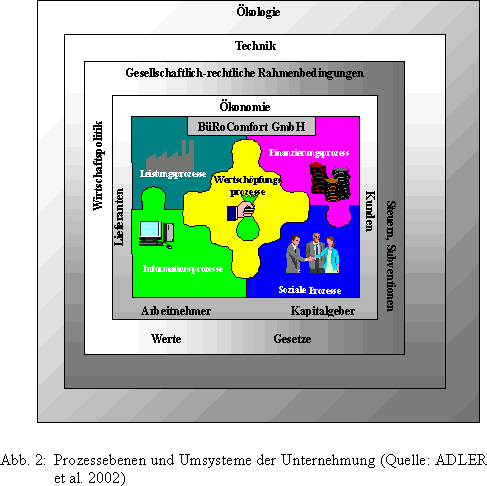
• Drittens schließlich lassen sich im Hinblick auf die Stellung in einem hierarchischen Zielsystem (dem nicht notwendig eine hierarchische Organisationsstruktur entsprechen muss) unterschiedliche Handlungsebenen identifizieren. Abbildung 3 vermittelt einen Eindruck in eine solche Hierarchie betriebswirtschaftlicher Handlungs- und Entscheidungsbereiche.
Für die Gestaltung der Lernfirmenarbeit ist es von grundlegender Bedeutung, ob und in welchem Maße diese unterschiedlichen Dimensionen im Modellgeschehen abgebildet sind und auch thematisiert werden. Hier muss natürlich durchaus berücksichtigt werden, in welcher spezifischen Funktion die Lernfirma eingesetzt wird und welche ergänzenden Lernangebote vorhanden sind. Dennoch scheint uns grundsätzlich jede reduzierte Perspektive problematisch und begründungsbedürftig. Dies gilt in besonderem Maße, wenn der Zusammenhang mit dem Wertschöpfungsprozess als der zentralen ökonomischen Zieldimension nicht deutlich wird und wenn Entscheidungsprozesse und Entscheidungen auf den Managementebenen unberücksichtigt und unreflektiert bleiben.
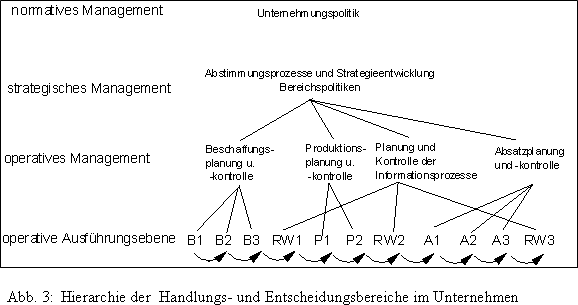
Auf der Grundlage dieser gewissermaßen paradigmatischen Festlegungen und mit Blick auf die Ausbildung insbesondere der kognitiven Voraussetzungen beruflicher Selbständigkeit sollen im Folgenden einige aus unserer Sicht zentrale Handlungsmaximen und Gestaltungspostulate der Lernfirmenarbeit angesprochen werden. Wir gehen davon aus, dass diese für jede der oben skizzierten Varianten Geltung beanspruchen können.
Lernfirmen sind vor allem Lernorte, ihre Gestaltung, ihre spezifische Akzentuierung und Reduktion muss deshalb im Hinblick auf die angestrebten Lernziele begründet und beurteilt werden. Vor diesem Hintergrund macht ein abstrakter Systemstreit zwischen Übungsfirma, Juniorenfirma oder Lernbüro wenig Sinn.
Lernfirmen sollen kaufmännisches und damit zugleich ökonomisches Handeln erfahrbar machen und sie sollen zeigen, wie dieses Handeln in relativ dauerhafte Systemstrukturen eingebunden ist. Der Erwerb kaufmännischer Handlungskompetenz beinhaltet in diesem Sinne immer zugleich auch den Aufbau einer Orientierungskompetenz, der Fähigkeit also, sich in komplexen Abläufen und Strukturen zurecht zu finden, gedanklich und auch begrifflich Ordnung zu stiften. Dies setzt voraus, dass in der komplexen und dynamischen Lernfirma sinnvoll gehandelt wird, dass die Unternehmensprozesse erkennbar und reflektiert auf die Erreichung wirtschaftlicher Ziele ausgerichtet sind, dass sich dies auch in der Organisation der Unternehmung, in ihren Entscheidungsfindungs- und Controllingprozessen widerspiegelt und dass schließlich auch die Effekte des Handelns in wirtschaftlich plausibler Weise eintreten.
Lernfirmen stellen einen Erfahrungsraum für Schüler dar, in dem sie mit ökonomisch akzentuierten Situationen konfrontiert und damit herausgefordert werden, angemessene Problemlösungen zu entwickeln und in der praktischen Umsetzung auf ihre tatsächliche Angemessenheit hin zu überprüfen. Lernfirmen sollen in diesem Sinne entdeckendes Lernen ermöglichen, wobei allerdings auch die Übernahme konventioneller Problemlösungen und Handlungsroutinen in begrenztem Maße einen legitimen Stellenwert haben kann. Keinesfalls darf es jedoch zum unreflektierten Einschleifen von Arbeitsalgorithmen und Handlungsroutinen führen. Entdeckendes Lernen, auch die aktive Aneignung und Variation konventioneller Verfahren, setzt die Chance voraus, auch Fehler machen zu dürfen und aus solchen Fehlern zu lernen. Dies freilich kann nur erfolgen, wenn das Modell nicht nur Fehler zulässt, sondern auf diese Fehler auch in spezifischer, ökonomisch valider Form reagiert. Und es macht darüber hinaus erst dann wirklich Sinn, wenn die Auswertung und Korrektur derartiger Fehler durch die Lehrenden gewährleistet und begleitet werden kann.
Das Arbeitshandeln im Modellunternehmen muss den Lernenden Handlungs- und Entscheidungsspielräume eröffnen, die diese zu ökonomischem Räsonnieren veranlassen. Handlungs- und Entscheidungsspielräume stellen die Handelnden in der Regel subjektiv vor ein Problem, sie fordern sie zum problemlösenden Denken heraus. Wo dieses in ökonomischen Kontexten erfolgt, bewegen sich die Lernenden im Problemraum der Betriebswirtschaftslehre, können auf deren Begriffsapparat, deren Theorien und Strategien zurückgreifen. Handlungs- und Entscheidungsprobleme im funktionalen Zusammenhang stellen somit die Brücke zur ökonomischen Theorie dar und umgekehrt sollte sich auch aus den Relevanzstrukturen der Disziplin bestimmen lassen, mit welchen Problemen die Lernenden konfrontiert werden sollten. Normativ zu entscheiden wäre hier allerdings, dass es sich keinesfalls nur um Probleme auf der operativen Ausführungsebene handeln darf, sondern dass vielmehr solche des operativen und strategischen Managements im Vordergrund stehen sollten. Zusätzlich erfordern Entscheidungen, die in Gruppen und im sozialen Kontext getroffen werden, ein gewisses Maß an Kooperations- und auch Konfliktfähigkeit. Damit bietet sich auch die Chance und die Notwendigkeit eines Einübens und Reflektierens sozialer Prozesse und Kompetenzen.
Die oben skizzierten Lernpotentiale werden sich nur einstellen, wenn die Lernenden auch bei einer arbeitsteiligen Organisationsstruktur an ihren konkreten Arbeitsplätzen mit Aufgaben konfrontiert werden, deren Bezug zum Gesamtzweck der Unternehmung, deren Beitrag zum Leistungsprozess und letztlich auch deren Beitrag zum Wertschöpfungsprozess für sie erkennbar bleiben. Dies setzt einerseits relativ ganzheitliche Aufgabenschneidungen in den Abteilungen voraus; andererseits erfordert es, dass die Schüler über die Abteilungsperspektive hinaus auch in die Planungs-, Entscheidungs- und Auswertungsprozesse auf der Ebene der Gesamtunternehmung mit einbezogen werden.
In jedem Fall jedoch liegt in der gemeinsamen Bearbeitung von Aufgabenstellungen im Rahmen von Partner- oder Gruppenarbeit ein wesentliches didaktisches Potential. Schüler können hier einerseits ihre Erfahrungen, ihr Vorwissen und ihre Ideen bündeln; sie sind zugleich in jeder Phase ihres Handelns zur Verbalisierung ihrer Überlegungen veranlasst. Schließlich liegen natürlich im kooperativen Handeln auch Chancen für die Ausprägung sozialer Kompetenzen.
Bereits oben wurde die Notwendigkeit angesprochen, aus Fehlern zu lernen, und es wurde verdeutlicht, dass dies angemessene, ökonomisch valide Antworten des Systems auf die Aktionen der Lernenden voraussetzt. In diesem Bereich haben Simulationen immer gewisse Probleme. Eine gewisse Ausgleichsmöglichkeiten im Falle unbefriedigender Feedback-Mechanismen im Modell ist dadurch gegeben, dass auch diese zum Ausgangspunkt und Gegenstand klärender Erörterungen werden können und dass dabei paradoxe oder erwartungs- bzw. erfahrungswidrige Reaktionen durchaus zum Nachdenken motivieren können. Auf der Ebene des Lernens am Modell lassen sich so durchaus Modellierungsschwachpunkte ausgleichen, nur sollte dies sicher nicht zum Regelfall werden.
Hier schließt sich auch der Kreis unserer Postulate zurück zum ersten: Lernfirmen sind zuallererst pädagogische Orte. Und Lernen ist unserem Verständnis nach immer auch ein sozialer Prozess, eingebettet in ein soziales Setting und ein soziales Umfeld. Wohl selten ist das augenscheinlicher als bei den Simulationsformen, die Gegenstand unserer Überlegungen sind.
Im Folgenden sollen in kursorischer Form die wesentlichen Stärken und Schwächen der drei Modelle im Hinblick auf den Anspruch des Lernfirmenkonzepts und auf die Förderung beruflicher und personaler Selbständigkeit angesprochen werden. Die Stärken und Schwächen sollten dabei weniger im Sinne einer definitiven Pro-Contra–Liste zur Entscheidungsbegründung gelesen werden, sondern mehr als Hinweise auf die je spezifischen Potenziale und Grenzen dieser Modelle, denen unter variierenden Zielen und in verschiedenen Phasen des Lernprozesses durchaus unterschiedliches Gewicht zukommt. Es geht also mehr um gegenseitige Befruchtung und intelligente Kombination als um das Sammeln argumentativer Munition in einem bornierten Grabenkrieg unter eigentlich ähnlich Gesinnten.
+ Durch die Geschlossenheit des Modells ergibt sich ein hohes Maß an Gestaltbarkeit der Geschäftsabläufe und der Arbeitsimpulse . Der Lehrer hat die Möglichkeit, die Ausgangssituation nach didaktischen Erfordernissen zu modellieren, er kann die Aktionen und Reaktionen der Geschäftspartner steuern und unabhängig von (realen) externen Partnern das Bearbeitungstempo variieren. Durch den größeren Gestaltungs- und Entscheidungsraum des Lehrers hat er in diesem Modell auch die besten Kontrollmöglichkeiten . Mit der größeren Planbarkeit ist zugleich eine höhere Vorhersehbarkeit der Prozesse und Abläufe und der in diesem Kontext auftretenden fachlichen Fragen und Probleme verbunden. Aus dem Zusammenwirken dieser Merkmale ergibt sich ein Maximum an didaktischer Gestaltbarkeit der Lernbüroarbeit und damit eine günstige Voraussetzung für eine intensive Verzahnung von Theorie und Praxis, von kasuistischem und systematischem Lernen.
+ Aus der Standardisierbarkeit der Modellierung und der damit verbundenen Wiederholbarkeit der Geschäftsabläufe ergeben sich zudem etliche positive Effekte im Hinblick auf eine effiziente, arbeitsteilige Vorbereitung der Lernbüroarbeit durch die Lehrer, die gemeinsame Nutzung von Arbeits- und Lernmaterialien, Dokumenten, Fallstudien etc. sowie die Herstellung von Bezügen zum Modellunternehmen aus dem Kontext anderer Unterrichtsfächer heraus. Dies führt nicht nur zu einer Arbeitsentlastung auf Seiten der Lehrenden, sondern ermöglicht es ihnen zugleich, sich stärker auf die Begleitung und Unterstützung individueller Lernprozesse einzulassen und/oder ihr Augenmerk auf die systematische Auswertung der Lernerfahrungen zu richten.
- Die Abbildung der Marktreaktionen durch den Lehrer oder eine ggf. von ihm angeleitete Schülergruppe kann demgegenüber schnell zu einer gewissen Willkürlichkeit der Markt(re)aktionen führen oder zumindest diesen Eindruck erwecken. Hier hängt die Qualität der Lernbüroarbeit entscheidend davon ab, inwiefern es dem Lehrenden einerseits gelingt, Marktbedingungen und Marktreaktionen ökonomisch valide einzuspielen und in welchem Maße andererseits der Aspekt der Markteinbettung und der Marktbezogenheit der Modellunternehmung mit den Schülern gemeinsam reflektiert wird.
- Die Repräsentation der Außenwelt durch Schülergruppen aus dem Klassenverband oder durch den Lehrer führt in jedem Fall zu einer Künstlichkeit der Kommunikationssituation . Wenn Geschäftsbriefe lediglich von Tisch zu Tisch, bestenfalls von Raum zu Raum weitergereicht werden, wenn Telefonate mit Kunden oder Lieferanten als Rollenspiel unter wohlbekannten Mitschülern stattfinden, so beeinträchtigt dies unweigerlich den Ernstcharakter der kommunikativen Situation. Natürlich ist es hier auch nur begrenzt möglich, Geschäftsusancen und kommunikative Standards zu realisieren. Häufig bilden sich informell eigene, wenig valide Standards und Usancen aus, die eher Vorurteile und schulische Normen widerspiegeln als einen Einblick in die Geschäftswirklichkeit erlauben.
- Aus diesem Aspekt heraus ergibt sich als eine der größten Gefahren der Lernbüroarbeit eine Tendenz zur Bürokratisierung der kaufmännischen Abläufe und Arbeitsprozesse und zur schematischen Abarbeitung vorgegebener Bearbeitungsfolgen. Hintergrund dieser Tendenz ist die Neigung, nicht ein komplexes Unternehmen unter besonderer Akzentuierung der Informationsströme und der darauf bezogenen Aktivitäten zu modellieren, sondern die im bürokratischen Ablauf verbundenen Tätigkeiten kaufmännischer Sachbearbeiter weitgehend isoliert von den korrespondierenden, Güter- und Wertströmen nachzubilden. In diesem Sinne dominieren in der Lernbüroarbeit häufig Strukturen gegenüber den Prozessen . Gegenstand der Abbildung ist primär das starr erscheinende Gefüge von funktional definierten Abteilungen, Stellen und Verrichtungen mit den korrespondierenden Dokumenten, Arbeitsmitteln und zu erzeugenden Schriftstücken. Die dahinter stehenden kommunikativen Zwecke und Informationsbedarfe sowie die wirtschaftlichen Zwecke und Ziele, auf die diese intentional ausgerichtet sein sollten, treten demgegenüber deutlich in den Hintergrund bzw. werden häufig gar nicht abgebildet. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Finanzbuchhaltung, in der zwar (im günstigen Falle) Geschäftsvorgänge ordnungsgemäß erfasst, in der Regel jedoch nicht zeitnah abgeschlossen, ausgewertet und für die Steuerung betrieblicher Abläufe genutzt werden.
• Eng verbunden mit den Potentialen zur Didaktisierung der Lernbüroarbeit muss quasi als Kehrseite der Medaille eine ausgeprägte Tendenz zur Lehrerdominanz zumindest im Vergleich mit anderen Formen der Lernfirmenarbeit konstatiert werden. Solange der Lehrer für die Simulation der Außenkontakte und Marktmechanismen und für die Erhaltung einer wirtschaftlich sinnvollen Datenstruktur im Lernbüro zuständig ist, wird sich hieran wohl nur wenig ändern lassen.
Die Stärke dieser Simulationsform liegt zusammenfassend betrachtet auf jeden Fall in der relativ guten Plan- und Steuerbarkeit der Lernprozesse unter Wahrung eines relativ hohen Komplexitätsniveaus der Lernumwelt und der Lernhandlungen. Erfolgskritische Variablen sind insbesondere die Validität der ökonomischen Modellierung und das Niveau der curricularen Integration der Lernbüroarbeit.
+ Durch ihre Einbindung in einen nationalen und ggf. auch internationalen Verbund gleichartiger Modellunternehmen stellen Übungsfirmen die hinsichtlich ihrer Struktur- und Prozessmerkmale vergleichsweise komplexesten Unternehmensmodelle dar. Die Komplexität ergibt sich aus den vielschichtigen und vielfältigen Anforderungen und Modellierungsmöglichkeiten innerhalb des Übungsfirmenringes und des damit zugleich dargestellten staatlichen und institutionellen Ordnungsrahmens; die Dynamik resultiert aus der Vielzahl realer Außenkontakte in den Marktzusammenhängen des Übungsfirmenringes. Über den Unternehmenszusammenhang hinaus modelliert der Übungsfirmenring zugleich gesamtwirtschaftliche Strukturen bis hin zur weltwirtschaftlichen Verflechtung, sowie die institutionellen, rechtlichen und auch technologischen Rahmenbedingungen betrieblichen Handelns. Durch die Mitglieder des Übungsfirmenringes und ihre spezifischen Ausbildungskontexte und betrieblichen Bezüge werden realwirtschaftliche Entwicklungen ausgesprochen schnell in den Übungsfirmenmarkt hinein getragen und bewirken so ständige Anpassung des Gesamtmodells an die wirtschaftliche Realität, was auch auf der Ebene der einzelnen Übungsfirma zu einem einen relativ hohen Anpassungsdruck führt.
+ Eine wesentliche Stärke der Übungsfirmenarbeit liegt im Ernstcharakter der realen Außenkontakte . Insbesondere durch die Internationalisierung der Übungsfirmenarbeit und die damit verbundene Möglichkeit weltweiter Geschäftsbeziehungen ergeben sich wichtige neue Lernchancen. Die Stichworte hierzu reichen von internationalem Handels- und Vertragsrecht, über Fremdsprachengebrauch bis hin zur Nutzung der modernsten Informations- und Kommunikationstechnologien. Im Kontext der Übungsfirmenarbeit hat in den letzten Jahren, gerade auch als Reaktion auf extrem lange Postwege und unter dem Aspekt der Förderung internationaler Geschäftsbeziehungen, die internetbasierte Kommunikation eine wichtige Rolle zu spielen begonnen . Die Übungsfirmenarbeit hat sich so aus ihrer eigenen Entwicklungsdynamik heraus Varianten des E-Business angenähert und in einer konsequenten Nutzung dieses Mediums liegen beträchtliche Potentiale zur Weiterentwicklung der Übungsfirmenarbeit (vgl. dazu TRAMM/ GRAMLINGER 2002).
• Die valide Abbildung von Marktstrukturen und Marktmechanismen als Voraussetzung für ein an wirtschaftlichen Erwartungen ausgerichtetes und nach wirtschaftlichen Kriterien zu bewertendes betriebswirtschaftliches Handeln im Modellunternehmen ist bis heute nicht hinreichend gelungen . Der Übungsfirmenmarkt weist deutliche sektorale Ungleichgewichte aus; da jede einzelne Übungsfirma die Branchen, Sortiments- und Vertriebswegeentscheidungen auch wesentlich unter didaktischen Gesichtspunkten trifft, findet sich ein deutliches Übergewicht von Handelsbetrieben gegenüber Industriebetrieben und Dienstleistern; konsumnahe Produkte sind gegenüber Rohstoffen, Grundstoffen oder industriellen Komponenten deutlich überrepräsentiert etc. (vgl. TRAMM 1996a; GRAMLINGER/ KÜHBÖCK/ LEITHNER 2000, NEUWEG 2001). Da den Kaufentscheidungen in der Regel keine realen Bedürfnisse bzw. Bedarfe zugrunde liegen, erfolgen auch die Kaufentscheidungen der einzelnen Übungsfirmen, insbesondere im Bereich des sogenannten Belegschaftseinkaufes, in der Regel eher willkürlich oder aufgrund ökonomisch nicht relevanter Aspekte.
• Mit der relativ großen Offenheit der Arbeitsimpulse und des Geschäftsablaufes in Abhängigkeit von Art und Umfang der Aktivitäten der Geschäftspartner im Übungsfirmenring sind auch die Möglichkeiten der didaktisch gezielten Beeinflussung und Steuerung und damit auch der Verzahnung von fallbezogenem und systematischem Lernen begrenzt . Übungsfirmen werden in der Regel lerngruppenüberdauernd betrieben, ihr Geschäftsverlauf ist bei wechselnden Lerngruppen kontinuierlich, jede Lernergruppe knüpft an die Arbeit ihrer Vorgänger - und damit auch an deren Fehler und Versäumnisse - an. Zugleich sind Übungsfirmen i. d. R. nicht reproduzierbar und auch spezifische Ereignisse und Problemstellungen sind allenfalls begrenzt wiederholbar. Die Möglichkeiten der konzeptionellen Kooperation zwischen den Lehrerteams unterschiedlicher Übungsfirmen sind damit ebenso begrenzt wie die Möglichkeiten zur gemeinsamen Erarbeitung von Lernmaterialien.
Die Übungsfirma zeichnet jener Faktor aus, der ihr zugleich auch viele Probleme bereitet: Das Handeln und Verhandeln mit realen Partnern – und das weltweit – bietet eine sehr große Zahl an Lernmöglichkeiten und -chancen, bringt es aber auch mit sich, dass vieles weder inhaltlich noch vom Arbeitsanfall her planbar ist. Die Chancen, ein vorhandenes Modell in beinahe jede Richtung verändern und gestalten (eben: modellieren) zu können, und das Modell als Referenzrahmen für das Lernen zu nutzen, sind aber nach unserer Ansicht allenfalls ansatzweise ausgenutzt. Und auch darin liegt eine große Chance und zugleich ein ständig drohender Quell der Überforderung der beteiligten Akteure (insbesondere aber der Lehrenden): In der Übungsfirma kann man „nicht nicht modellieren“.
+ Im Gegensatz zu den beiden bisher besprochenen Modellen liegt bei den Juniorenfirmen ein Lehr-Lernarrangement vor, in dem reale Güter oder Leistungen gegen reale Geldzahlungen angeboten und verkauft werden. Der Sachzielbezug bzw. die zu erstellende und zu vermarktende Leistung einerseits und der darüber angestrebte wirtschaftliche Erfolg im Sinne des Formalzielbezuges sind für die Lernenden handlungsleitend . Auf dieser Grundlage sind der Markterfolg und die realisierte Wertschöpfung klare ökonomische Erfolgskriterien , auf die hin das Handeln zu optimieren und der Erfolg zu erfassen ist. Die Schüler könnten mithin den Erfolg ihres Handelns unmittelbar (Sachziel) und durch das Rechnungswesen vermittelt (Formalziel) erfahren und erleben so zugleich die Notwendigkeit einer wirtschaftlich akzentuierten Erfolgsfeststellung. Die Klarheit dieser Zielkriterien erlaubt es, auf eine detaillierte Steuerung und Kontrolle des Prozessverlaufs durch die Lehrenden bzw. die Ausbilder zu verzichten . Die Stabilität des Ablaufes wird durch die Validität in der Zieldimension und nicht primär durch Abbildgenauigkeit in der Prozess- oder Strukturdimension gesichert. Dies wiederum erlaubt es, dem Team der Lernenden größere Handlungsspielräume und damit Initiative und Verantwortung zu übertragen.
+/-Im Zentrum der Juniorenfirmenarbeit steht in der Regel das Management relativ eng umgrenzter wirtschaftlicher Projekte, wobei wiederum die Vermarktung der erzeugten Güter auf meist geschützten Absatzmärkten im Vordergrund steht. In diesem Sinne handelt es sich i. d. R. eher um Junioren-Projekte als um auf Dauerhaftigkeit angelegte Junioren-Firmen . Entsprechend dominiert die Planung, Durchführung und Auswertung solcher Prozesse deutlich gegenüber einer umfassenden Abbildung einer komplexen Unternehmung in einer vielschichtigen, offenen Umwelt. Juniorenfirmen modellieren also wirtschaftliches Handeln , nicht jedoch komplexe ökonomische Systeme in einer komplexen Umwelt. Sie scheinen von daher geeignet, Verlaufs- und Erfolgskriterien wirtschaftlichen Handelns erfahrbar zu machen, sind jedoch nur bedingt tauglich, in die Architektur, die Abläufe und die charakteristischen Tätigkeiten des Systems Unternehmung einzuführen.
• Besonders deutlich wird dies dadurch, dass die Juniorenfirmen in aller Regel unter dem wirtschaftlichen und rechtlichen Mantel ihrer Mutterunternehmung agieren, deren Personal einsetzen, deren Sachanlagen, Räume etc. nutzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Haftungs- und Kostenfragen sich bei der Gestaltung der Juniorenfirmenarbeit als problematisch erweisen können und dass auch wirtschaftliche und pädagogische Optimierungskriterien der Juniorenfirmenarbeit in einem durchaus spannungsreichen Verhältnis zueinander stehen. Wesentlich für eine umfassende Modellierung von Juniorenfirmen als eigenständige ökonomische Systeme wäre eine klare Abgrenzung der Juniorenfirmen von der sie tragenden Mutterunternehmung mit Hilfe einer dezidierten Kosten- und Leistungsrechnung. Hier wären insbesondere jene Faktoreinsätze zu erfassen, die aus der Mutterunternehmung kommend für das Juniorenprojekt eingesetzt werden, aber natürlich auch die produktiven Leistungen der Juniorenfirma für das Mutterunternehmen. Problematisch bliebe in jedem Fall, dass eine solche Form eines weitgehend vermögenslosen Unternehmens kaum als valides Modell für die Erschließung grundlegender Systemmerkmale von Unternehmungen generell geeignet scheint.
• Unter didaktischem Aspekt ist angesichts der relativen Offenheit der Arbeits- und Lernsituation nach dem spezifischen Beitrag dieses Lernortes für den beruflichen Kompetenzerwerb zu fragen. Insbesondere ist zu fragen, inwieweit die konkrete Juniorenfirmenarbeit auf einen systematischen Erkenntnisgewinn abzielt, der sich auch im Umfang und Niveau der begrifflichen Reflexion und Systematisierung der Handlungserfahrungen erweist.
Die größte Stärke dieses Lernortes liegt zusammenfassend betrachtet zweifellos im ausgeprägten Ernstcharakter des wirtschaftlichen Vorhabens, auch wenn hieraus die Gefahr erwachsen kann, den spezifischen Anforderungen des Lernhandelns zu wenig Beachtung zu schenken. Juniorenfirmen eignen sich deshalb insbesondere dafür, Verständnis für die Kriterien erfolgreichen wirtschaftlichen Handelns zu entwickeln sowie Kompetenzen und Einstellungen zum Projektmanagement wie auch umfassender zum unternehmerischen Denken und Handeln im Sinne des Entrepreneurship zu fördern.
Wir wollen das Ergebnis unserer Überlegungen kurz zusammenfassen:
Grundlage unternehmerischer Selbständigkeit i. S. des Entrepreneurshipkonzepts sind spezifische Persönlichkeitsmerkmale, berufliche Kompetenzen und einschlägige Berufserfahrung. Berufliche Erstausbildung kann und sollte nicht darauf fokussieren, unternehmerische Selbständigkeit als unmittelbares Ziel zu verfolgen. Sie ist jedoch den Zielen der beruflichen und personalen Selbständigkeit verpflichtet, und indem sie diese Zielsetzungen ernst nimmt, schafft sie wesentliche Voraussetzungen für einen späteren Weg auch in die unternehmerische Selbständigkeit, ohne allerdings die Jugendlichen in diese Richtung zu drängen.
Zentral für berufliche Selbständigkeit im kaufmännischen Bereich ist ein gründliches Verständnis ökonomischer Prozesse und Systemzusammenhänge sowie der Eigenarten, Prinzipien, Risiken und Kriterien wirtschaftlichen Handelns. Auszubildende sind also über die verengende operative Sachbearbeiterperspektive hinaus auch mit strategischen und normativen Problemkreisen betriebswirtschaftlichen Handelns zu konfrontieren (siehe dazu auch den Beitrag von BERCHTOLD/ STOCK in dieser Ausgabe).
Aus dieser Perspektive heraus zeigen sich starke Affinitäten des unternehmerischen Denkens und Handelns zum Konzept der Lernfirma, das als normatives Bezugsmodell der Analyse und Weiterentwicklung der traditionell operativ akzentuierten Varianten der Unternehmenssimulation dienen kann. Übungsfirmen, Lernbüros und Juniorenfirmen sollten vorrangig im Hinblick auf die Qualitätskriterien dieses Modells hin beurteilt und weiterentwickelt werden.
Wesentliche Ansatzpunkte für diese Modelle sehen wir zusammenfassend in folgenden Aspekten:
• Lernbüro- und Übungsfirmenmodelle haben ihre Stärke in der Abbildung von Strukturzusammenhängen, sie weisen allerdings Schwächen in der Prozessabbildung auf und neigen darüber auch dazu, an traditionellen und häufig ineffizienten Organisationsformen festzuhalten. Ansätze zur Optimierung lägen hier
• in einer stimmigeren Modellierung der ökonomischen Prozesse und der entsprechenden Strukturdaten,
• in einer stärkeren Betonung von Planungs- und Controllingprozessen,
• in einer Abkehr von der traditionellen funktionsspezifischen Organisationsstruktur mit stark segmentierender Arbeitsteilung und einer Einführung von Modellen der Spartenorganisation,
• in curricularen Ergänzungsangeboten um Planspiele und Realprojekte um jene Zieldimensionen zu realisieren, die mit diesem Modell kaum zu erreichen sind.
• Juniorenfirmen haben deutliche Stärken im Bereich der Prozessmodellierung, weisen jedoch Mängel bei der Abbildung des betrieblichen Gesamtzusammenhanges auf organisationaler Ebene auf. Ansätze zur Optimierung lägen hier
• in der deutlichen Akzentuierung der Juniorenfirmen als betriebliche Projekte bzw. als Profitcenter in einer Unternehmung,
• in einer sorgfältig betriebenen Kosten- und Leistungsrechnung in Abgrenzung zum Mutterunternehmen, um so zu einer geschlossenen Betrachtung des Wertschöpfungsprozesses in diesem Juniorenprojekt/-unternehmen zu kommen,
• in einer Öffnung bzw. Erweiterung der Produktpalette und der Märkte,
• und vor allem in der systematischen Anbahnung und Auswertung der Lernerfahrungen.
Letztendlich wäre es vernünftig, diese Modelle weniger als konkurrierende Konzepte zu betrachten, sondern als Varianten mit spezifischen Stärken und Schwächen, unter denen nach der jeweils vorliegenden Situation zu wählen ist. Interessant erscheinen uns insbesondere Überlegungen, diese Konzepte nicht alternativ, sondern komplementär bzw. konsekutiv einzusetzen (interessant dazu sind die Ausführungen zum „methodischen Dreischritt“ bei BRAUKMANN und EBBERS/ HALBFAS), also beispielsweise ein Übungsfirmencurriculum durch Juniorenprojekte phasenweise anzureichern oder aber eine curriculare Sequenz von Juniorenprojekten, Lernbüro- und Übungsfirmenarbeit zu organisieren.
ACHTENHAGEN, F./ SCHNEIDER, D. (1993): Stand und Entwicklungsmöglichkeiten der Lernbüroarbeit unter Berücksichtigung der Nutzung Neuer Technologien. Bericht für den Niedersächsischen Kultusminister. Göttingen.
ACHTENHAGEN, F./ TRAMM, T./ PREIß, P./ JOHN, E. G./ SEEMANN-WEYMAR, H./ SCHUNCK, A. (1992): Lernhandeln in komplexen Situationen. Neue Konzepte der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Wiesbaden.
ADLER, J./ FROST, G./ GOLDBACH, A./ SEIDLER, D./ TRAMM, T./ WICHMANN, E. (2002): Prozessorientierte Wirtschaftslehre. Troisdorf.
BRAUN, G. (1998): Das Personal im Bildungswesen: Vom Erziehungsbeamten zum pädagogischen Unternehmer. In: BUND-LÄNDER-KOMMISSION für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Vorbereitung von Absolventen des Schulwesens auf eine selbständige Tätigkeit. Band 65 der Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung. Bonn, 99-116.
BUND-LÄNDER-KOMMISSION für Bildungsplanung und Forschungsförderung (1997): Aus und Weiterbildung zur unternehmerischen Selbständigkeit für Absolventen des beruflichen Bildungswesens. Bericht und Empfehlung der BLK. Band 55 der Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung. Bonn.
CARNAGIE, D. (1949/2002): Wie man Freunde gewinnt. 44. Aufl., München.
DOSTAL, W.(2002): Zukunft von Arbeit und Qualifikation in der modernen Dienstleistungsgesellschaft. In: TRAMM, T. (Hrsg.): Perspektiven der kaufmännischen Berufsbildung. Bielefeld, 5-19.
FALTIN, G./ RIPSAS, S./ ZIMMER, J. (Hrsg.) (1998): Entrepreneurship. Wie aus Ideen Unternehmen werden. München.
FIX, W. (1989): Juniorenfirmen. Ein innovatives Konzept zur Förderung von Schlüsselqualifikationen. Berlin.
GRAMLINGER, F. (2000): Die Übungsfirma auf dem Weg zur Lernfirma? Eine empirische Darstellung in Form zweier Portraits. Bergisch Gladbach.
GRAMLINGER, F./ KÜHBÖCK, E./ LEITHNER, S. (2000): Wie stellt sich die österreichische Übungsfirmen-Landschaft 1999 dar? Eine empirische Untersuchung im Vergleich mit 1995 und 1997. Linz.
GRUHLER, W. (1996): Existenzgründer zwischen Erfolg und Scheitern. In: BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT (Hrsg.): Chancen und Risiken der Existenzgründung. Bonn, 10-18.
HERBST, D. (2003): Der Mensch als Marke. Göttingen.
INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT (IDW) KÖLN (1997): Aus- und Weiterbildung zur unternehmerischen Selbständigkeit. Abschlussbericht des Projektes. Köln.
NEUWEG, G. H. (2001): Die Übungsfirma im kaufmännischen Vollzeitschulwesen Österreichs – ein Lernort eigener Prägung? In: Wirtschaft und Erziehung 53, H: 7-8, 238-243.
REETZ, L. (1986): Konzeptionen der Lernfirma. Ein Beitrag zur Theorie einer Organisationsform wirtschaftsberuflichen Lernens im Betriebsmodell. In: Wirtschaft und Erziehung. 39, H. 11, 351-365.
REETZ, L./ WITT, R. (1974): Berufsausbildung in der Kritik: Curriculumanalyse Wirtschaftslehre. Hamburg.
STEVENSON, H. H./ GUMPERT, D.E. (1998) : Der Kern unternehmerischen Handelns. In: FALTIN, G./ RIPSAS, S./ ZIMMER, J. (Hrsg.): Entrepreneurship. Wie aus Ideen Unternehmen werden. München, 93-111.
TRAMM, T. (1991): Entwicklungsperspektiven der Übungsfirmen- und Lernbüroarbeit aus der Sicht einer Didaktik handlungsorientierten Lernens. In: Wirtschaft und Erziehung. 43, H. 7/8, 248-259.
TRAMM, T. (1994): Funktion und Entwicklungsperspektiven der Übungsfirmenarbeit. Referat auf dem Seminar "Erfahrungsaustausch Schulversuch Neue Handelsschule" des BMUK in Kitzbühel am 6. Oktober 1994.
TRAMM, T. (1996a): Lernprozesse in der Übungsfirma. Rekonstruktion und Weiterentwicklung schulischer Übungsfirmenarbeit als Anwendungsfall einer evaluativ-konstruktiven und handlungsorientierten Curriculumstrategie. Habilitation, Göttingen.
TRAMM, T. (1996b): Die Übungsfirma als Lernfirma oder: Einzig ärgerlich an der Übungsfirma ist ihr Name. In: Die Berufsbildenden Schulen auf dem Weg ins 3. Jahrtausend. (Vortrag gehalten auf dem Symposion Mobilität, Flexibilität, Sprachkompetenz) Hrsg. vom BMUkA, Wien, 65–84.
TRAMM, T./ BAUMERT, W. (1990): Theoretische und praktische Perspektiven der Lernbüroarbeit. Oldenburg: Projekt- und Seminarberichte der Universität.
TRAMM, T./ GRAMLINGER, F. : (2002): Lernfirmen in virtuellen Netzen – didaktische Visionen und technische Potenziale. In: GAVRANOVIC, Z. / ELSTER, F./ ROUVEL, J./ ZIMMER, G. (Hrsg .): E-Commerce und unternehmerisches Handeln. Kompetenzentwicklung in vernetzten Juniorenfirmen. Bielefeld, 96-128.
ULRICH, H. (1970): Die Unternehmung als produktives soziales System. 2. Aufl. Bern, Stuttgart.
VOß, G./ PONGRATZ, H. J . (1998): Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 50. Jg., 131-158.