|
| ||





Im Zusammenhang mit der Berufsvorbildung der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen wird in der Literatur immer wieder die Diskussion geführt, ob der Professionalisierung oder der Polyvalenz im Studium der Vorzug zu geben ist (vgl. z.B. TRAMM 2001; KIPP 1998; CZYCHOLL 2000). Im Positionspapier der Universität Bielefeld wird beispielsweise von Professionalität als Polyvalenz bei der universitären LehrerInnenbildung gesprochen, wobei es „nicht um eine berufspraktische Vorbereitung auf ein Lehramt, sondern um die Entwicklung von Professionalität mit den Mitteln der Wissenschaft gehen [soll, denn Studierende] müssen an der Universität nicht als Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe, sondern als Experten für organisiertes Lernen“ sowie WächterInnen der Bildung vorgebildet werden (HÄNSEL et al. 1999, 7). Im Sinne der Professionalität sind sie als ExpertInnen für Lehr- und Lernprozesse nicht nur für eine Arbeit an der Schule qualifiziert, sondern für viele andere Arbeitsfelder auch (vgl. HÄNSEL et al. 1999, 7). Schlussfolgernd gilt somit ein universitärer Abschluss immer dann als polyvalent, wenn er den AbsolventInnen nicht nur einen Zugang zu einem bestimmten Beruf oder Berufsfeld ermöglicht, sondern wenn der Abschluss für unterschiedliche Berufsfelder nutzbar gemacht werden kann (vgl. KÖRBER, 2001).
Was bedeutet die Frage der Professionalität und Polyvalenz im Kontext des Studiums der Wirtschaftspädagogik?
Das Studium der Wirtschaftspädagogik ist in Österreich einphasig angelegt, d.h. die schulpraktische Ausbildung ist in das Studium integriert und somit mit der fachwissenschaftlichen und pädagogisch-didaktischen Qualifizierung der Studierenden eng verwoben. Um den Beruf einer Lehrerin bzw. eines Lehrers für kaufmännische Fächer an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule in Österreich ausüben zu dürfen, muss grundsätzlich einerseits das wirtschaftspädagogische Studium abgeschlossen sein und andererseits eine facheinschlägige Berufspraxis im Umfang von mindestens 2 Jahren nach Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums (Betriebswirtschaft, Handelswissenschaften, Volkswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik) nachgewiesen werden, wobei unterrichtende Tätigkeiten nicht als Berufspraxis zählen (vgl. BDG 1979, Anlage 1).
Der Ursprung der Disziplin Wirtschaftspädagogik sowie ihrer Forschungsmethoden werden in der Literatur sowohl aus den Erziehungswissenschaften als auch aus den Wirtschaftswissenschaften begründet (vgl. z.B. HUISINGA/ LISOP 1999; REBMANN et al. 2005; SLOANE et al. 2004). Der Fokus der Forschung und Lehre liegt somit auf dem Menschen in der Wirtschaft, denn die Wirtschaftspädagogik beschäftigt sich innerhalb ihrer unterschiedlichen Teildisziplinen sowohl mit der Methodik und Didaktik des Wirtschaftsunterrichtes, als auch in sehr umfassender Form mit pädagogischen Fragestellungen der Wirtschaft (vgl. KAISER 1997, 575). In Österreich sind alle vier Standorte der Wirtschaftspädagogik den Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten zugeordnet. Dies ist richtungweisend für Lehre und Forschung der Disziplin in Österreich.
An den Standorten Linz, Innsbruck und Graz ist das Studium der Wirtschaftspädagogik derzeit als Diplomstudium mit einer Regelstudiendauer von 9 Semestern organisiert. In Wien wurde mit dem Studienjahr 2006/07 auf das Bachelor-/Masterkonzept umgestellt, wobei der Master erst mit Studienjahr 2007/08 startet (vgl. WIPÄD-WIEN 2006). Auf der Bachelorebene wird an der Wirtschaftsuniversität Wien ein gemeinsamer Bachelor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften für alle Studienrichtungen mit einer Regelstudiendauer von 6 Semestern angeboten. Demnach kann Wirtschaftspädagogik am Standort Wien nicht auf der Bachelorebene studiert werden. Nach Absolvierung eines wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiums ist eine Aufnahme des Masterstudiums Wirtschaftspädagogik vorgesehen, welches 5 Semester umfassen wird. Aufgrund der Integration des Schulpraktikums wurde der Master Wirtschaftspädagogik um 1 Semester länger als andere Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Studien konzipiert, so wie es auch beim Diplomstudium Wirtschaftspädagogik der Fall ist.
Unabhängig von der Gestaltung als Diplomstudium oder Bachelor-/Masterstudium ist das Studium der Wirtschaftspädagogik an den Standorten Wien und Graz mehrfachqualifizierend angelegt, d.h. es dient einerseits der wissenschaftlichen Berufsvorbildung für die Lehrtätigkeit an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen der Sekundarstufe II. Andererseits bereitet es auch auf die Beschäftigungsfelder als Betriebspädagogin bzw. Betriebspädagoge sowie der Erwachsenenbildung vor. Darüber hinaus bildet das Studium WirtschaftspädagogInnen als breit qualifizierte verhaltensorientierte ExpertInnen für alle betriebswirtschaftlichen Berufsrichtungen aus (vgl. WIPÄD-GRAZ 2005, 4).
Wird die beabsichtigte Polyvalenz des Abschlusses der Wirtschaftspädagogik an beiden Standorten aber auch genutzt? Das ist die zentrale Fragestellung der empirischen Untersuchungen an den beiden Standorten. Viele Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang wie beispielsweise: In welchen Berufsfeldern sind AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik zu finden? Warum entscheiden sie sich für oder gegen den Lehrberuf? Wie zufrieden sind sie mit ihrer beruflichen Tätigkeit?
Die Ergebnisse dieser Studie an den beiden Standorten Wien und Graz bringen aktuelle Antworten auf diese Fragen.
Das Forschungsprojekt startete im Sommer 2006 an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien). Fast zeitgleich konnte dafür eine Kooperation zwischen den Instituten für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien und an der Karl-Franzens-Universität Graz (KFU Graz) ins Leben gerufen werden. An der KFU Graz wurde eine vergleichbare Studie in Anlehnung an Wien im Herbst 2006 durchgeführt.
Im Rahmen dieser Studien wurden AbsolventInnen der beiden Standorte befragt, um im Anschluss daran die erhobenen Daten gegenüberzustellen und interpretieren zu können. Somit stehen für Österreich erstmals gesicherte Befunde hinsichtlich der Polyvalenz im Sinne der Verwertbarkeit des Abschlusse der Wirtschaftspädagogik an zwei der insgesamt vier Standorte zur Verfügung. An beiden Universitäten wurde jeweils eine Diplomandin mit der Durchführung der Erhebung betraut, wodurch dieses gemeinsame Projekt letztlich erst realisierbar wurde.
Mit den beiden Untersuchungen in Wien und Graz wurden folgende zentrale Zielsetzungen verfolgt:
• Erforschung der Karriereverläufe der AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik
• Erforschung der Gründe für die Wahl bzw. Nicht-Wahl des Lehrberufes
• Erhebung der Zufriedenheit der AbsolventInnen mit ihren beruflichen Tätigkeiten
• Befragung über den Nutzen des Studiums für die betriebliche Praxis
• Erhebung der Gründe für die Wahl des Studiums
• Erhebung umfassender demographischer Daten
Aus diesen Zielsetzungen ergeben sich demnach folgende Forschungsfragen:
• Welcher Anteil der AbsolventInnen ergreift den Lehrberuf bzw. übt Tätigkeiten in der Wirtschaft aus?
• Wie verändert sich die gewählte berufliche Tätigkeit im Zeitverlauf?
• Aus welchen Gründen wurde das Studium der Wirtschaftspädagogik gewählt und welche Bedeutung hatte die Polyvalenz des Studiums für die Studienwahl?
• Wie viele AbsolventInnen verfügen über mehr als ein abgeschlossenes Studium?
• Aus welchen Gründen wurde der Lehrberuf ergriffen respektive nicht ergriffen?
• Welche Bedeutung wird den wirtschaftspädagogischen Ausbildungsinhalten für Tätigkeiten in der Wirtschaft beigemessen?
• Wie zufrieden sind die AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik mit ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit?
• Wie beurteilen AbsolventInnen die in Österreich geltende Praxisregelung für die Ausübung des Lehrberufes?
Bei der Klärung dieser Fragestellungen soll in der Folge immer speziell auf Unterschiede zwischen LehrerInnen und der in der Wirtschaft Tätigen (hier als Nicht-LehrerInnen bezeichnet) an beiden Standorten eingegangen werden.
In die vorliegenden Studien wurden AbsolventInnen der Studienrichtung Wirtschaftspädagogik der Standorte Wien und Graz einbezogen, die ihr Studium zwischen 1998 und 2002 an einem dieser beiden Standorte abgeschlossen haben. Mit der Wahl dieses Zeitraums ist sichergestellt, dass auch eine Längsschnitt-Analyse möglich ist. Somit kann die Beschäftigungssituation unmittelbar nach Abschluss des Studiums, mit jener 2 Jahre nach Abschluss des Studiums und schließlich mit jener 4 Jahre nach Abschluss des Studiums verglichen werden.
Für die Befragung wurde in Wien ein standardisierter Fragebogen konzipiert, wobei die Erhebung in telefonischer Form erfolgte. In Graz wurde die Untersuchung mit Hilfe eines Online-Fragebogens durchgeführt. Als Basis wurde der Fragebogen der WU Wien herangezogen, allerdings musste er für die Online-Befragung umfassend adaptiert werden. Die einzelnen Fragestellungen waren zwar ähnlich, konnten jedoch aufgrund der unterschiedlichen Befragungstechniken nicht vollkommen ident konzipiert werden. Es wurde an beiden Standorten Pretests durchgeführt und die Instrumente im Anschluss adaptiert. Trotz der unterschiedlichen Erhebungstechniken wurde darauf geachtet, die Fragebögen so zugestalten, dass ein späterer Vergleich der Ergebnisse sichergestellt war.
An der WU Wien haben im Zeitraum 1998 – 2002 insgesamt 444 Studierende das Studium der Wirtschaftspädagogik abgeschlossen, die in die Erhebung einbezogen wurden. Die Durchführung der Erhebung in telefonischer Form brachte letztendlich eine Rücklaufquote von 45 % (n = 202).
An der KFU Graz haben in diesem Zeitraum insgesamt 135 Studierende das Studium der Wirtschaftspädagogik abgeschlossen. Die Rücklaufquote für diesen Zeitraum beträgt 63,7 % (n = 86).
An der KFU Graz war die Studie generell sehr breit angelegt. Mit der Online-Befragung wurden alle AbsolventInnen befragt, die zwischen 1.1.1987 und 31.8.2004 ihr Studium der Wirtschaftspädagogik in Graz abgeschlossen haben. Für die Gegenüberstellung mit dem Standort Wien wurden lediglich die in den Zeitraum 1998 – 2002 fallenden relevanten Datensätze einbezogen.
Die Fragebögen für die Erhebungen in Wien und Graz wurden grundsätzlich in acht thematische Blöcke gegliedert. Bei der Erstellung des Wiener Fragebogens wurden neben offenen Fragen auch vierstufige Likert-Skalen verwendet. Im Rahmen der Grazer Online-Befragung wurden überwiegend vorgegebene standardisierte Antwortkategorien, sowie ebenfalls vierteilige Likert-Skalen verwendet.
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte in beiden Fällen mit SPSS Version 14.0.
Im Rahmen der koordinierten Auswertung der Daten von Graz und Wien wurde besonderes Augenmerk auf mögliche Unterschiede zwischen LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen gelegt.
In der Folge werden nun ausgewählte Ergebnisse der Untersuchungen in Wien und Graz präsentiert. Es werden immer die jeweiligen Themenbereiche aus der Befragung vorgestellt, darauf folgend die Untersuchungsergebnisse dargestellt und in einem weiteren Schritt die Ergebnisse interpretiert. Die Gliederung in diesem Abschnitt orientiert sich im Wesentlichen an den vorgestellten Forschungsfragen.
Die Ergebnisse vom Standort Wien zeigen, dass exakt 50,5 % (102 Personen) der befragten AbsolventInnen tatsächlich in der Wirtschaft tätig sind und 49,5 % (100 Personen) den Lehrberuf ergriffen haben. Die Ergebnisse der KFU Graz zeigen hingegen ein ganz anderes Bild: Von den Grazer AbsolventInnen sind 64 % (55 Personen) in der Wirtschaft tätig sind und nur 36 % (31 Personen) haben den Lehrberuf ergriffen.
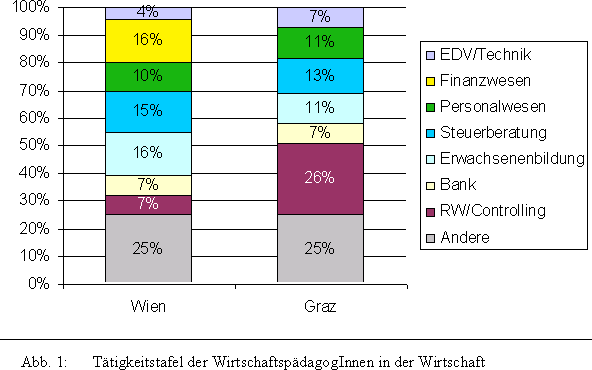
Betrachtet man die Antworten jener, die in der Wirtschaft tätig sind, so zeigt sich, wie in Abb. 1 ersichtlich, dass die AbsolventInnen in einem sehr breiten Spektrum des wirtschaftlichen Lebens Beschäftigungsmöglichkeiten finden. Grundsätzlich wäre zu erwarten, dass die Bereiche Erwachsenenbildung (Wien: 16 %, Graz: 11 %) und Personalwesen (Wien: 10 %, Graz: 11 %) aufgrund des inhaltlichen Naheverhältnisses zum Studium der Wirtschaftspädagogik anteilsmäßig die höchsten Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Diese Erwartung zeigt sich aber nicht in den vorliegenden Untersuchungsergebnissen. Beispielsweise zeigt sich am Standort Wien vielmehr, dass ein sehr hoher Anteil von AbsolventInnen in den Bereichen Steuerberatung (15 %) und Finanzwesen (16 %) Beschäftigung findet. Typisch für die Prägung des Grazer Lehrstuhls (sehr rechnungswesenlastige Ausrichtung des Studiums) ist hingegen, dass 26 % der AbsolventInnen im Bereich Rechnungswesen / Controlling und 13 % im Bereich Steuerberatung tätig sind.
Betrachtet man die Ergebnisse jener, die im Lehrberuf tätig sind, bezogen auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Lehrtätigkeit, so zeigt sich folgendes Bild:
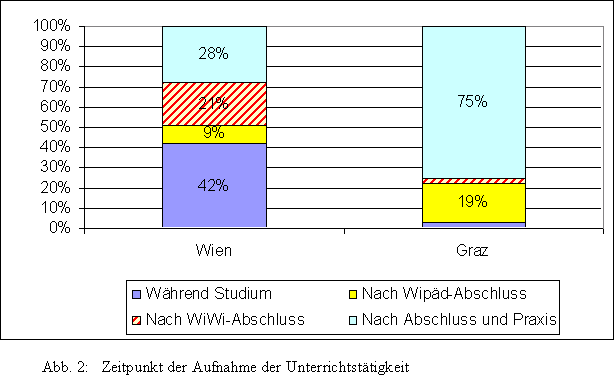
Die Grafik zeigt, dass 42 % der AbsolventInnen der WU Wien bereits während ihres Studiums der Wirtschaftspädagogik ihre schulische Lehrtätigkeit begonnen haben. Weitere 9 % ergreifen unmittelbar nach Abschluss ihres Wirtschaftspädagogikstudiums den Lehrberuf sowie weitere 21 % wurden unmittelbar nach Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums Lehrerin oder Lehrer. Lediglich 28 % der Befragten ergriffen nach Abschluss der gesetzlich erforderlichen zweijährigen Wirtschaftspraxis oder später den Lehrberuf.
In Graz verhält es sich geradezu umgekehrt. Von den AbsolventInnen der KFU Graz sind lediglich 3 % bereits während ihres Studiums der Wirtschaftspädagogik als Lehrkräfte tätig geworden. Weitere 19 % ergriffen unmittelbar nach Abschluss ihres Wirtschaftspädagogikstudiums den Lehrberuf sowie weitere 3 % wurden unmittelbar nach Abschluss eines anderen wirtschaftswissenschaftlichen Studiums Lehrerin oder Lehrer. 75 % der Befragten haben erst nach Abschluss der erforderlichen zweijährigen Wirtschaftspraxis oder später den Lehrberuf aufgenommen.
Diese Unterschiede zwischen Wien und Graz weisen darauf hin, dass Angebot und Nachfrage auch den Markt im Lehrberuf regulieren. Wien als international e Großstadt ist dafür bekannt, dass hier die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten in der Privatwirtschaft vielfach zu einem Engpass an potenziellen LehrerInnen für den Schulbereich führen.
In Wien und Graz unterrichten 100 % der kaufmännischen LehrerInnen an berufsbildenden Schulen der Sekundarstufe II. Der signifikant (p=0,000) größere Teil der Lehrenden (Wien 72 %; Graz 61 %) unterrichtet an kaufmännischen Schulen (Handelsakademie, Handelsschule). An zweiter Stelle wird an humanberuflichen Schulen (Wien 26 %; Graz 35 %) unterrichtet und an dritter Stelle erst an technischen Schulen (Wien 2 %; Graz 3 %). An allgemeinbildenden höheren Schulen unterrichtet keine der befragten Personen.
Einen großen Unterschied gibt es zwischen Wien und Graz auch bezüglich des unterrichteten Stundenausmaßes. In Wien zeigt eine genauerer Betrachtung, dass lediglich 26 % der Befragten 18 – 21 Stunden (Vollbeschäftigung bzw. knapp darüber) unterrichten. 45 % der Befragten unterrichten hingegen zwischen 22 und 26 Stunden pro Woche und immerhin noch 6 % zwischen 27 und 33 Stunden pro Woche. Auch dieses Ergebnis zeigt, dass im Bereich der kaufmännischen Unterrichtsgegenstände noch immer Beschäftigungspotential gegeben ist.
Hingegen zeigt sich bei den Ergebnissen der Grazer AbsolventInnen, dass 48 % der Befragten 18 – 21 Stunden unterrichten. Der Anteil jener, deren Lehrverpflichtung darüber hinausgeht ist mit 29 % deutlich geringer als jener von Wien, wobei keine einzige teilnehmende Person an der Studie von Graz angab, mehr als 26 Wochenstunden zu unterrichten.
Betrachtet man die getroffene Berufswahl im Zeitverlauf, so zeigt sich an beiden Standorten, dass unmittelbar nach Studienabschluss in Wien 32,7 % bzw. in Graz 8,1 % der AbsolventInnen direkt in den Schulbetrieb einsteigen. Zwei Jahre nach Studienabschluss steigt der Anteil jener, die als Lehrerin bzw. als Lehrer tätig sind, bei den Wiener AbsolventInnen auf 40,1 % respektive bei den Grazer AbsolventInnen auf 24,4 %. Durch einen weiteren Wechsel von der Wirtschaft zur Schule (19 % in Wien bzw. 15 % in Graz) ergibt sich die eingangs dargestellte Verteilung zwischen Schule und Wirtschaft (Wien: 50:50; Graz: 36:64).
Im Rahmen der Untersuchungen wurden die AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik in Wien und Graz nach den Gründen befragt, warum sie das Studium der Wirtschaftspädagogik gewählt haben und warum sie LehrerIn bzw. eben nicht LehrerIn geworden sind.
In der nachfolgenden Tabelle sind die fünf häufigsten genannten Gründe angeführt. Die Anzahl der Nennungen (%-Satz-Nennung in der Klammer) unterscheidet sich zwischen Wien und Graz deshalb so wesentlich, da bei der telefonischen Befragung an der WU Wien dies eine offene Fragestellung war und bei der Online-Befragung der KFU Graz aus 15 vorgegebenen Statements ausgewählt werden konnte (Mehrfachnennungen waren möglich) bzw. auch ein offener Antwortbereich gegeben war. Ein Rückschluss auf die Bedeutung der einzelnen Motive ist dennoch möglich.

Wie die oben angeführte Tabelle zeigt, ist der meist genannte Grund für die Wahl des Studiums der AbsolventInnen der WU Wien wie auch der KFU Graz der Wunsch, Lehrerin bzw. Lehrer zu werden. Die Argumentation geht an beiden Standorten in die gleiche Richtung außer, dass die Grazer AbsolventInnen im Gegensatz zu den Wiener AbsolventInnen nie als Grund „ Weil bereits unterrichtet wurde“ angegeben haben. Dies ist stimmig mit den Ausführungen im vorangegangenen Kapitel bzw. der Abbildung 2 in diesem Beitrag.
Seit der Diskussion der PISA-Ergebnisse wird auch medial immer häufer die Thematik der Qualität respektive Qualifikation von LehrerInnen angeschnitten. Aus diesem Grund wurde die Anzahl der abgeschlossenen Studien und allfällige Unterschiede zwischen LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen auch untersucht.
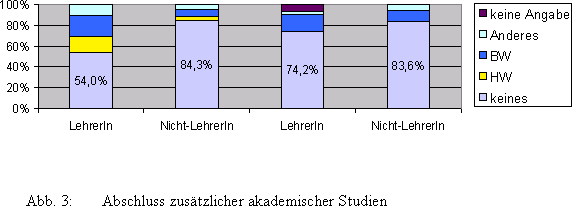
Wie die Grafik zeigt, haben von den AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik an der WU Wien 54 % jener, die LehrerIn wurden und 84,3 % jener, die nicht LehrerIn wurden kein weiteres Studium abgeschlossen. Hingegen haben 46 % der LehrerInnen ein weiteres Studium abgeschlossen und nur 15,7 % der Nicht-LehrerInnen – dies zeigt einen signifikanten Unterschied (p = 0,000). Ein möglicher Grund dafür ist der Umstand, dass knapp 20 % der AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik vor Beginn des Studiums der Wirtschaftspädagogik an der WU Wien bereits ein anderes – in der Regel wirtschaftswissenschaftliches – Studium abgeschlossen haben.
Bei den AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik an der KFU Graz zeigt sich hingegen eher eine Gleichverteilung zwischen LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen. Hier haben 74,2 % der LehrerInnen und 83,6 % der Nicht-LehrerInnen kein anderes Studium als das Studium der Wirtschaftspädagogik abgeschlossen. 19,3 % der LehrerInnen und 16,4 % der Nicht-LehrerInnen haben ein anderes Studium neben dem Studium der Wirtschaftspädagogik absolviert.
Zusatzmagister ist in Österreich bei den Abschlüssen der Wirtschaftspädagogik ein geläufiger Begriff. Mit Zusatzmagister werden jene Personen bezeichnet, die nach Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums auch das Studium der Wirtschaftspädagogik aufnehmen und abschließen. Es liegt die Annahme nahe, dass diese Personen vor allem ihr Studium der Wirtschaftspädagogik aufnehmen und abschließen, da sie die Absicht haben, in den Schuldienst zu gehen, denn mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss haben sie bereits die gesamte fachwissenschaftliche Berufsvorbildung, die gesamte fachdidaktische respektive pädagogisch-didaktische Berufsvorbildung für den Lehrberuf fehlt aber noch.
An der WU Wien fallen 16,8 % der AbsolventInnen (34 Personen) in diese Kategorie. 88, 2 % dieser (30 Personen) haben nach Abschluss ihres Studiums der Wirtschaftspädagogik auch dann wirklich den Beruf einer Lehrerin / eines Lehrers ergriffen. In Graz spielt der Zusatzmagister im betrachteten Zeitraum eine untergeordnete Rolle. So haben in Graz lediglich 4,7 % der AbsolventInnen (4 Personen) nach Beendigung eines anderen wirtschaftswissenschaftlichen Studiums das Studium der Wirtschaftspädagogik begonnen und abgeschlossen. Von diesen 4,7 % haben lediglich nur 50 % (2 Personen) nach Abschluss des Studiums der Wirtschaftspädagogik den Beruf einer Lehrerin / eines Lehrers ergriffen.
In Rahmen der Untersuchung wurde auch nach der Relevanz des Motivs, den Lehrberuf nach Abschluss des Studiums der Wirtschaftspädagogik ausüben zu können, gefragt. Die folgende Abbildung zeigt das sehr eindeutige Ergebnis.
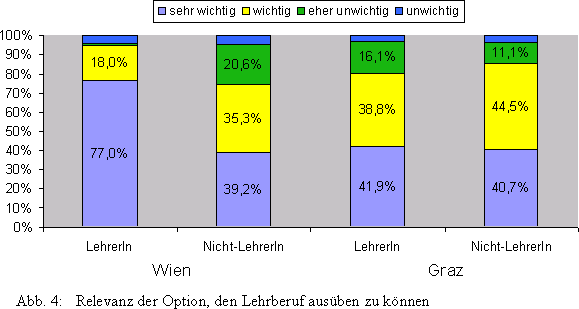
An der WU Wien zeigt sich, dass 77 % der LehrerInnen und 39,2 % der Nicht-LehrerInnen auf einer vierteiligen Likert-Skala die Option, mit dem Abschluss des Studiums der Wirtschaftspädagogik den Lehrberuf ausüben zu können, als sehr wichtig eingestuft haben (Mittelwert = 1,32 bei LehrerInnen; Mittelwert = 1,91 bei Nicht-LehrerInnen). Der Unterschied zwischen den Angaben der LehrerInnen und der Nicht-LehrerInnen ist hierbei signifikant (p = 0,000).
Betrachtet man im Vergleich dazu die Ergebnisse der Befragung der AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik der KFU Graz, zeigt sich, dass 41,9 % der LehrerInnen und 40,7 % der Nicht-LehrerInnen auf einer vierteiligen Likert-Skala die Option, mit dem Abschluss des Studiums der Wirtschaftspädagogik den Lehrberuf ausüben zu können, als sehr wichtig eingestuft haben (Mittelwert = 1,81 bei LehrerInnen; Mittelwert = 1,78 bei Nicht-LehrerInnen). Der Unterschied zwischen den Angaben der LehrerInnen und der Nicht-LehrerInnen ist von Graz – im Unterschied zur WU Wien – nicht signifikant (p = 0,906).
Die AbsolventInnen der beiden Standorte Graz und Wien wurden auch nach den Gründen befragt, warum sie sich für die jeweilige berufliche Tätigkeit – LehrerIn respektive Nicht-LehrerIn – entschieden haben.
Bei der Frage nach dem Warum für den Lehrberuf sind in der nachfolgenden Tabelle die fünf am häufigsten dafür genannten Gründe angeführt. Die Anzahl der Nennungen (%-Satz-Nennung in der Klammer) unterscheidet sich auch hier wieder zwischen Wien und Graz deshalb so wesentlich, da bei der telefonischen Befragung an der WU Wien dies eine offene Fragestellung war und bei der Online-Befragung der KFU Graz aus 15 vorgegebenen Statements ausgewählt werden konnte. Der Stellenwert der einzelnen Gründe ist dennoch ersichtlich und vergleichbar.
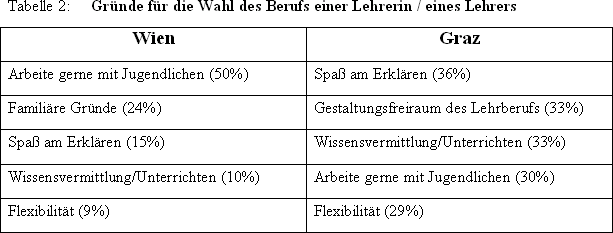
Wie die oben angeführte Tabelle zeigt, ist der meist genannte Grund der Ausübung des Lehrberufes für die AbsolventInnen der WU Wien die Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und an der KFU Graz der Spaß am Erklären. Die Argumentation der AbsolventInnen geht an beiden Standorten aber in die gleiche Richtung im Sinne, dass sie Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und am Unterrichten haben, die Flexibilität im Lehrberuf schätzen und ebenso familiäre Gründe für diesen Beruf sprechen.
Darüber hinaus wurden auch jene Gründe erhoben, warum AbsolventInnen zwar das Studium der Wirtschaftspädagogik gewählt haben, aber dennoch nicht als Lehrerin / Lehrer arbeiten.
In der nachfolgenden Tabelle sind die fünf häufigsten dafür genannten Gründe angeführt. Die Anzahl der Nennungen (%-Satz-Nennung in der Klammer) unterscheidet sich auch hier wiederum zwischen Wien und Graz deshalb so wesentlich, da bei der telefonischen Befragung an der WU Wien dies eine offene Fragestellung war und bei der Online-Befragung der KFU Graz wieder aus 15 vorgegebenen Statements ausgewählt werden konnte.
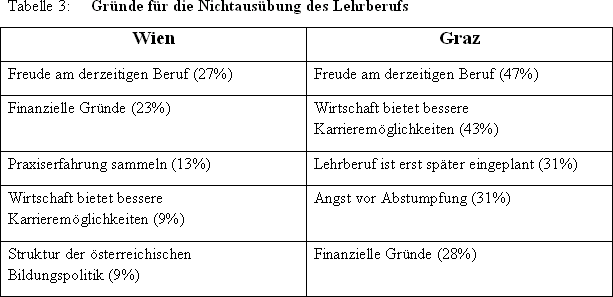
Wie die oben angeführte Tabelle zeigt, ist der meist genannte Grund der Nicht-Ausübung eines Lehrberufes für die AbsolventInnen der WU Wien wie auch der KFU Graz die Freude am derzeitigen Beruf. Die Argumentation geht an beiden Standorten in die gleiche Richtung im Sinne, dass die Wirtschaft mehr Karrierechancen als die Schule bietet und dass in der Wirtschaft mehr Geld zu verdienen sei. Dass der Lehrberuf erst später eingeplant ist, ist nur eine Argumentation der Grazer AbsolventInnen und zeigt sich wieder stimmig mit den Darstellungen in Abbildung 2 und der in der Folge beschriebenen anteilsmäßigen Veränderung der Tätigkeitsfelder zwischen Wirtschaft und Schule.
Die AbsolventInnen beider Standorte wurden ebenso befragt, wie sie die Bedeutung wirtschaftspädagogischer Inhalte für die berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft einschätzen.
Bei den Ergebnissen der Befragung der AbsolventInnen der WU Wien zeigt sich, dass 24 % der LehrerInnen und 30,4 % der Nicht-LehrerInnen auf einer vierteiligen Likert-Skala die Relevanz wirtschaftspädagogischer Inhalte für die berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft als sehr relevant eingestuft haben und dass 48 % der LehrerInnen und 60,8 % der Nicht-LehrerInnen auf der vierteiligen Likert-Skala die Relevanz wirtschaftspädagogischer Inhalte für die berufliche Tätigkeit als relevant eingestuft haben. Lediglich 8 % der LehrerInnen und 1 % der Nicht-LehrerInnen schätzten die wirtschaftspädagogischen Inhalte als nicht relevant für die Wirtschaft ein. Die am häufigsten angeführten Inhalten der AbsolventInnen der WU Wien sind: Präsentationstechnik inkl. Rhetorik und Auftreten (51,5 %), Rechnungswesen, Buchhaltung und Steuerlehreinhalte (35,1 %), betriebswirtschaftliche Inhalte (16,8 %), Didaktik (16,3 %) und Konzepte erstellen (12,9 %). Tendenziell haben die LehrerInnen die Relevanz der Inhalte niedriger eingeschätzt als die Nicht-LehrerInnen.
Betrachtet man im Vergleich dazu die Ergebnisse der Befragung an der KFU Graz, so zeigt sich, dass 17,3 % der LehrerInnen und 9,1 % der Nicht-LehrerInnen auf einer vierteiligen Likert-Skala die Relevanz wirtschaftspädagogischer Inhalte für die berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft als sehr relevant eingestuft haben und dass 31 % der LehrerInnen und 58,2 % der Nicht-LehrerInnen auf der vierteiligen Likert-Skala die Relevanz wirtschaftspädagogischer Inhalte zumindest als relevant eingestuft haben. Lediglich 3,4 % der LehrerInnen und 5,4 % der Nicht-LehrerInnen schätzten die wirtschaftspädagogischen Inhalte als nicht relevant für die Wirtschaft ein. Die am häufigsten von den Grazer AbsolventInnen angeführten Inhalten sind: Soziale Kompetenz (73 %), Teamarbeit (72 %), Kommunikation (70 %), Präsentationstechnik inkl. Rhetorik und Auftreten (70 %) und Schlüsselqualifikationen allgemein (66 %). Tendenziell haben auch bei den Grazer Ergebnissen die LehrerInnen und die Relevanz der wirtschaftspädagogischen Inhalte für die Wirtschaft weniger relevant eingeschätzt als jene, die in der Wirtschaft tätig sind.
Es gibt in den Medien viele Diskussionen über Belastungen im Lehrberuf und die Zufriedenheit respektive die Unzufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer Tätigkeit. Im Rahmen der Befragungen der AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik in Wien und Graz wurden die Teilnehmenden auch über die Zufriedenheit mit ihrer derzeitig ausgeübten beruflichen Tätigkeit befragt. Die nachfolgende Abbildung zeigt das doch überraschende Ergebnis.
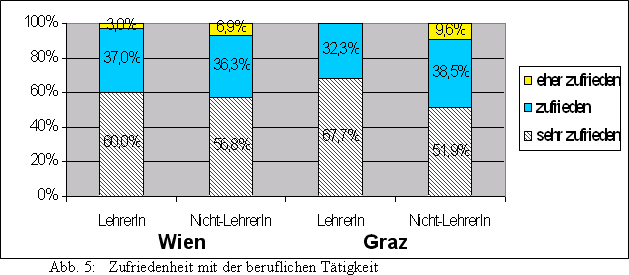
Die Befragten hatten die Möglichkeit auf einer vierteiligen Likert-Skala den Grad ihrer Zufriedenheit mit ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit anzugeben. Weder AbsolventInnen der WU Wien noch der KFU Graz haben angegeben, unzufrieden mit der derzeitigen beruflichen Tätigkeit zu sein. Wie die Darstellung für die AbsolventInnen der WU Wien zeigt, sind 60 % der LehrerInnen und 56,8 % der Nicht-LehrerInnen vielmehr sehr zufrieden und 37 % der LehrerInnen und 36,3 % der Nicht-LehrerInnen zufrieden .
Vergleicht man diese mit den Grazer Auswertungen, so zeigen sich dort ähnliche Tendenzen. Die Grazer Ergebnisse besagen, dass 67,7 % der LehrerInnen und 51,9 % der Nicht-LehrerInnen sehr zufrieden mit der derzeitigen beruflichen Tätigkeit sind und dass 32,3 % der LehrerInnen und 38,5 % der Nicht-LehrerInnen zufrieden mit ihrer derzeitigen Tätigkeit sind. Die Auswertungen beider Standorte zeigen, dass Widererwarten keine signifikanten Unterschiede bei den Ergebnissen hinsichtlich LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen nachweisbar sind.
Wie im Kapitel 2 des vorliegenden Beitrages bereits dargestellt wurde, ist in Österreich eine mindestens zweijährige facheinschlägige Berufspraxis neben dem Abschluss des Studiums der Wirtschaftspädagogik eine gesetzliche Voraussetzung für die Lehrtätigkeit an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Die Notwendigkeit einer Berufspraxis ist erfahrungsgemäß generell ein sehr kontroversielles Thema. Hinsichtlich der Sinnhaftigkeit dieser Praxisregelung besteht in Wien beispielsweise ein signifikanter Unterschied zwischen LehrerInnen und jenen, die in der Wirtschaft tätig sind (p=0,018). 78 % der LehrerInnen und sogar 90,2 % der Nicht-Lehrer beurteilen die geforderte Wirtschaftspraxis als sinnvoll . Am Standort Graz zeigen die Ergebnisse der Untersuchung keine signifikanten Unterschiede zwischen LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen. 92,1 % der in der Wirtschaft Tätigen und 89 % der LehrerInnen beurteilen die geforderte Wirtschaftspraxis als sinnvoll und notwendig.
Auch die Einschätzung, wonach durch die Wirtschaftspraxis eine höhere Qualität der Ausbildung erreicht wird, ist an beiden Standorten extrem hoch: Am Standort Wien stellen 80 % der LehrerInnen und 93,1 % der Nicht-LehrerInnen einen positiven Einfluss auf die Unterrichtsqualität fest (p=0,006). In Graz besteht kein signifikanter Unterscheid, 91,4 % der LehrerInnen und 92,7 % der Nicht-LehrerInnen sehen durch die Wirtschaftspraxis eine Erhöhung der Unterrichtsqualität.
Geschlecht:
Grundsätzlich zeigt sich, dass der Frauenanteil im Studium der Wirtschaftspädagogik an beiden Standorten weit über dem Durchschnitt der anderen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Studien liegt. Allerdings sind zwischen der Berufswahl LehrerIn und dem Geschlecht keine signifikanten Zusammenhänge zu erkennen. Beispielsweise liegt der Frauenanteil bei den LehrerInnen bei 69 %. Bei den in der Wirtschaft Tätigen liegt dieser Anteil mit 71,6 % nicht signifikant höher (p=0,69). In Graz zeigt sich das gleiche Bild: 77,4 % der LehrerInnen und 83,6 % der Nicht-LehrerInnen gehören zum weiblichen Geschlecht (p=0,57).
Hochschulreife:
Die Auswertungen der Daten zu der Frage nach der Erlangung der Hochschulreife zeigen in Wien und Graz folgendes Bild:
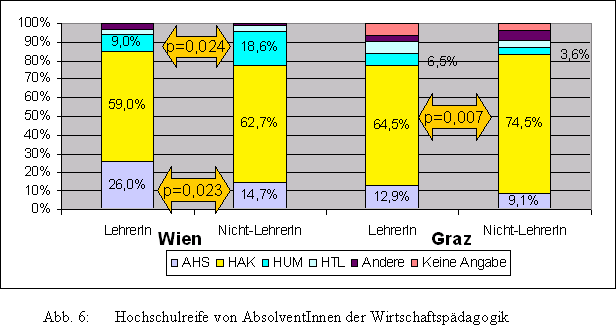
Wie aus Abbildung 6 ersichtlich, hat ein Großteil der AbsolventInnen beider Standorte auf der Sekundarstufe II eine kaufmännische Schulausbildung (Handelsakademie = HAK) abgeschlossen. Dahinter folgen AbsolventInnen der allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS, Gymnasien) und den humanberuflichen Schulen (HUM). Betrachtet man die Unterschiede zwischen LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen, so zeigt sich am Standort Wien, dass zwei von drei AHS-AbsolventInnen den Lehrberuf ergreifen (p=0,023) – bei den AbsolventInnen mit HUM-Vorbildung ist diese Tendenz genau umgekehrt (p=0,024). Am Standort Graz ist der Anteil der HAK-AbsolventInnen, die später Tätigkeiten in der Wirtschaft annehmen, mit 74,5 % signifikant höher, als jener, die in den Lehrberuf einsteigen (p=0,007).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Studium der Wirtschaftspädagogik an den Standorten Wien und Graz polyvalent konzipiert ist, was in der Folge auch zu einer polyvalenten Verwendung des Abschlusses durch die AbsolventInnen führt. Hierbei ist erfreulich, dass ein hoher Grad an Zufriedenheit mit der derzeitig ausgeübten beruflichen Tätigkeit festgestellt werden konnte. Trotz immer wiederkehrender Diskussionen über hohe Arbeitsbelastungen, schlechtes Image und dürftige Bezahlung lässt sich hierbei kein signifikanter Unterschied zwischen LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen feststellen. Es zeigt sich, dass AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik in nahezu allen wirtschaftlichen Berufen auch tatsächlich beschäftigt werden. Neben der Erwachsenenbildung bzw. der Tätigkeit in Personalabteilungen sind die Bereiche Rechnungswesen / Controlling, Steuerberatung und Finanzwesen zentrale Tätigkeitsfelder. Im Bereich des Lehrberufes konnte nachgewiesen werden, dass regionale Besonderheiten – z.B. eine hohe Nachfrage an akademischem Personal seitens der Privatwirtschaft – zu einer Rekrutierung von Lehrpersonal ohne fertig abgeschlossenes Studium führen kann. Dies geht unter Umständen auch soweit, dass von gesetzlich definierten Ernennungserfordernissen seitens der Schulverwaltung Abstand genommen wird. Die Untersuchungen bringen klar zutage, dass typische wirtschaftspädagogische Inhalte von den AbsolventInnen auch für Tätigkeiten in der Wirtschaft überwiegend als relevant eingestuft werden. Hierbei treten klare Meinungsunterschiede zwischen LehrerInnen und Nicht-LehrerInnen zutage. Auch hinsichtlich der in Österreich geltenden Praxisregelung zeigt sich eine breite Zustimmung zu deren Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit, wobei damit auch eine Steigerung der Unterrichtsqualität verbunden wird. Abschließend stellen die Autorin und der Autor des vorliegenden Beitrages fest, dass Polyvalenz und Professionalisierung des Lehrberufes keinen Widerspruch darstellen, sondern eine Hebung der Ausbildungsqualität unserer LehrerInnen vielmehr an eine polyvalente Gestaltung des Studiums gekoppelt ist. Eine polyvalente wissenschaftliche Vorbildung ist demnach der Schlüssel zur Sicherung sowie Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit der AbsolventInnen der Wirtschaftspädagogik.
BDG (1979): Beamten-Dienstrechtsgesetz, Anlage 1, 23. Verwendungsgruppe L1, BGBl 1999/127 Art 1. Online: http://www.i-med.ac.at/rechtsservice/formulare/bdg.pdf (06-04-2007).
CZYCHOLL, R. (2000): Lehrerbildung für berufliche Schulen auf dem Wege in das 21. Jahrhundert - Quo vadis ? In: CZYCHOLL, R. (Hrsg.): Berufsbildung, Berufsbildungspolitik und Berufsbildungsforschung auf dem Wege in das dritte Jahrtausend. Oldenburg, 235-258.
HÄNSEL, D./ MILLER, S./ TILLMANN, K. (1999): Zur Reform der Lehrerbildung an der Universität Bielefeld. Online: http://www.uni-bielefeld.de/bielefelder-modell/allgemeines/bi-dokumente/Archiv/lehrerbildung.html (06-04-2007).
HUISINGA, R./ LISOP, I. (1999): Wirtschaftspädagogik. Ein interdisziplinär orientiertes Lehrbuch. Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. München.
KAISER, F. (1997):Wirtschaftspädagogik. In: MAY, H. (Hrsg.): Lexikon der ökonomischen Bildung. 2. Aufl. München, Wien, 573-576.
KIPP, M. (1998): Zwischen Professionalisierungs- und Polyvalenzansprüchen – Erforderliche Bestimmtheit und notwendige Offenheit als Gestaltungsgrundsätze berufs- und wirtschaftspädagogischer Studiengänge. In: DREES, G./ ILSE, F. (Hrsg.): Berufliche Bildung zwischen Aufklärungsanspruch und Verwertungsinteressen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Bielefeld, 51-72.
KÖRBER, A. (2001): Themen zur Lehrerbildung: Polyvalenz. Online: http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/Personal/koerber/lbildg/polyvalenz.htm (05-04-2007).
REBMANN, K./ TENFELDE, W./ UHE E. (2005): Berufs- und Wirtschaftspädagogik . Eine Einführung in Strukturbegriffe. 3. überarb. Aufl. Wiesbaden.
SLOANE, P./ TWARDY, M./ BUSCHFELD, D. (2004): Einführung in die Wirtschaftspädagogik. 2. überarb. U. erw. Aufl. Paderborn.
TRAMM, T. (2001): Polyvalenz oder Professionalisierung – die Quadratur des Kreises? In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 1. Online: http://www.ibw.uni-hamburg.de/bwpat/ausgabe1/Tramm_bwpat1.pdf (05-04-2007).
WIPÄD-GRAZ (2005): Studienplan Wirtschaftspädagogik Graz, Mitteilungsblatt der Karl-Franzens-Universität Graz, Studienjahr 2004/2005 Ausgegeben am 3. 8.2005 21.f Stück, 53. SONDERNUMMER. Online: www.uni-graz.at/zvwww/miblatt.html (05-04-2007).
WIPÄD-WIEN (2006): Studienplan für das Masterstudium Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Online: http://www.wu-wien.ac.at/lehre/studienangebot/studienangebot_aktuell/wiso/master/studienplaene/master_wipaed.pdf (13-04-2007).