|
| ||


Erstmals erschienen in: ÖFEB Newsletter 5 (2005) Nr. 1, 5–15. Die Wiederveröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.

Keineswegs nur mehr bei Studierenden gilt Praxisorientierung als das „Maoam“ der universitären LehrerInnenbildung (BABEL 2005); „Wissenschaftsorientierung“ ist zu einem Merkmal geworden, das man der LehrerInnenbildung heute vielfach eher vorwirft als es ihr komplimentierend zu attestieren. Insbesondere dominieren Konzepte der „Praxisreflexion“ die Szene, die dem Erfahrungslernen zentralen Stellenwert einräumen und in ihren besonders konsequenten Erscheinungsformen den Anspruch systematischer Wissensvermittlung zugunsten reflexiv-induktiven Lernens nahezu gänzlich aufgeben (vgl. bspw. KORTHAGEN 2001).
Der practical turn in der Lehrerbildungsdidaktik macht auf Grenzen und Probleme des Wissenschaftsprinzips aufmerksam, für die sensibel zu sein in der Tat wichtig ist.
(1) Das Problem der mangelnden Dissemination des Ausbildungswissens in die Praxis. Auch wer dem Wissenschaftswissen potenziell handlungsleitende Funktion zuschreibt, muss zur Kenntnis nehmen, dass dieses faktisch offenbar kaum seinen Weg in die Praxis findet. Die einschlägigen Befunde sind durchwegs ernüchternd. LehrerInnen greifen in erstaunlich geringem Maße auf im Studium angeeignetes Wissen zurück, und zwar selbst dann, wenn sie sich in einer von unmittelbarem Handlungsdruck entlasteten Situation befinden, in der sie dies prinzipiell könnten. So ergibt eine Befragung von mehr als 500 LehrerInnen an niedersächsischen Schulen beispielsweise folgendes Bild:
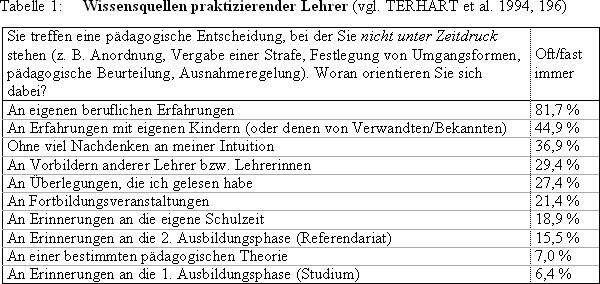
(2) Unzulänglichkeiten in der erziehungswissenschaftlichen Wissensbasis.
Befunde der erwähnten Art lassen sehr unterschiedliche Deutungen zu – etwa, dass LehrerInnen unprofessionellerweise nicht auf gute Theorien zurückgreifen oder die Universitäten diese schlecht vermitteln. Zurückfragen lässt sich aber auch auf die Qualität des erziehungswissenschaftlichen Technologieangebotes: (a) Klagen über eine erhebliche Lückenhaftigkeit des Theorienbestandes gehören zum Standardrepertoire gerade auch der Vertreter eines nomothetischen Wissenschaftsideals (vgl. z. B. BECK 1983; BREZINKA 1978; ACHTENHAGEN 1984; WEINERT/ SCHRADER/ HELMKE 1990); universitäre Lehrerbildung daran zu orientieren, würde, so meint BECK (1992, 185) gar, bedeuten: „die Studienzeit könnte sich auf zwei Semester verkürzen, denn mehr gute Theorien haben wir nicht.“ Teilt man die Prämissen des Technologiekonzepts, dann ist dies in hohem Maße auf eine wissenschaftstheoretisch bisweilen fehlgeleitete und nicht hinreichend empirisch orientierte Forschungspraxis zurückzuführen. Teilt man sie nicht, so mag man die Ursachen in der Beschaffenheit des Erfahrungsgegenstandes verorten – ein in der Pädagogik recht populäres Argumentationsmuster: Niemals steige man zweimal in denselben Fluss, zu einzigartig seien die je besonderen Situationen, in denen man sich zu bewähren und die je besonderen SchülerInnen, mit denen man es dabei zu tun habe. (b) Für Teile des verfügbaren Wissensbestandes mag der Vorwurf der Trivialität gerechtfertigt sein. Dass zum Beispiel strukturierter Unterricht günstiger als chaotischer und der Unterrichtserfolg eine Funktion der aktiven Lernzeit ist, durfte man schon vor aller Unterrichtsforschung vermuten. (c) Zu den Defiziten in der Technologiebasis gesellt sich das Problem der normativen Enthaltsamkeit der Erziehungswissenschaft. Pädagogisches Handeln erfordert nicht nur eine Entscheidung über die Erziehungsmittel, sondern auch eine über die Erziehungsziele, auf die hin solche Mittel ausgewählt werden sollen. Weil Theorien im Sinne des Technologiemodells aber nichts ge- oder verbieten, sondern lediglich kausale und teils technologisch nutzbare Relationen beschreiben, bedürfen LehrerInnen offensichtlich zusätzlich einer „normativen Philosophie der Erziehung“ ( BREZINKA 1978), die von den Wissenschaften (und also von der Universität) nicht beigestellt werden kann, wenn diese ihr Mandat nicht überschreiten wollen.
(3) Das Problem des trägen Wissens .
(Vgl. zum Begriff des „trägen Wissens“ und zum diesbezüglichen Forschungsstand in der Pädagogischen Psychologie bspw. GRUBER/ RENKL 2000. )
Mehr und mehr wächst die Einsicht, dass umfassendes erziehungswissenschaftliches Wissen alleine noch keine Handlungskompetenz begründet. Wissen kann aus mehreren Gründen „träge“ bleiben. (a) Einerseits muss zum Wissen Kontextualisierungskompetenz hinzutreten. In der Anwendung – und das heißt: in der Abwendung von der allgemeinen Regel und der Zuwendung zum Einzelfall – muss der Praktiker entscheiden, welche Verallgemeinerungen auf seine Situation überhaupt anwendbar sind und/oder was es heißt, eine allgemeine Verhaltensempfehlung situationsgerecht anzuwenden, und/oder ob die besondere Situation nicht die Ausnahme von der grundsätzlich geltenden Regel darstellt (vgl. dazu PATRY 2000). Vorausgesetzt sind daher „pädagogischer Takt“ (HERBART 1802) und ein „feines Verständnis der gegenwärtigen Lage“ (JAMES 1908, 4 f.) – Fähigkeiten, die, wenn überhaupt, nur auf der Grundlage von Erfahrung entstehen können. (b) Können setzt nicht nur die Kontextualisierung, sondern vor allem auch die Prozeduralisierung von Wissen voraus. Der Takt meint schon bei Herbart nicht zufällig mehr als Urteilskraft, er ermöglicht außerdem „schnelle Beurteilung und Entscheidung“ (HERBART 1802, 141), „rasche und entschlossene Tat“ (ebd., 145). Die „Kunst“ sei „eine Summe von Fertigkeiten“ und dürfe „während der Ausübung sich in keine Spekulation verlieren“ (ebd., 139). Didaktisch impliziert dies die Notwendigkeit systematischen und ausgedehnten Wahrnehmungs- und Verhaltenstrainings. Kaum etwas aber ist den Universitäten fremder als das elementare didaktische Element der Übung, und so bleibt, wie BOLLNOW (1991, 15) in einer lesenswerten Hommage an das Üben formuliert, ihr Bildungsergebnis gemessen am Maßstab einer genauen Formung der entsprechenden Fertigkeiten „im Ungenauen und Ungefähren“. (c) Zu berücksichtigen ist schließlich, dass universitär vermitteltes Wissen dann träge bleiben wird, wenn es die subjektiven Theorien der Studierenden nicht wirksam verändert und „Lern- und Prüfungswissen“ einerseits, „Anwendungs-Wissen“ andererseits friedlich koexistieren, ohne einander wechselseitig zu irritieren ( Wissenskompartmentalisierung ) – wovon vielfach auszugehen sein wird, wenn alltagstheoretisches Vorwissen in der Hochschuldidaktik nicht systematisch aufgegriffen und zu objektiven Theorien in Beziehung gesetzt wird.
(4) Das Problem der Geringschätzung alltagstheoretischen Substitutionswissens. Berücksichtigenswert sind subjektive Theorien freilich nicht nur als potenzieller Störfaktor beim Versuch, Studierende wissenschaftlich aufzuklären. Eine Gefahr besteht auch darin, die Leistungsfähigkeit dieses Wissens zu unterschätzen und zu unterstellen, angehende LehrerInnen wären ohne Wissenschaftswissen in der Unterrichtspraxis nahezu handlungsunfähig. So argumentiert bspw. BECK (1992, 195), dass vor allen praktischen Handlungsversuchen im Klassenzimmer deshalb eine fundierte kognitive Qualifizierung stehen müsse, weil das Geschäft der Erziehung nicht minder verantwortungsbeladen sei wie das Betreiben eines Kernkraftwerkes. Die Analogie geht offenbar in zwei zentralen Punkten fehl. Erstens halten sich die wenigsten von uns in ihrer Kindheit und Jugend in Kernkraftwerken, alle dagegen in Schulen auf. LehrerInnenbildung dockt also immer an reichhaltigen Beständen von Vorwissen über Lehren und Lernen an. Und zweitens erfordert der Betrieb eines Kernkraftwerkes Spezialwissen, zu dem es im Alltagswissen keinerlei Entsprechung gibt. Dagegen tun LehrerInnen über erhebliche Strecken, was jedermann, wenn auch nicht in professioneller Rolle, tut: Sie machen sich anderen verständlich und sie gestalten Beziehungen.
(5) Handlungs- und wissenspsychologische Verkürzungen .
Praxisgängige Formen intuitiven Handelns im Klassenzimmer wurden lange Zeit als gedankenlose und vor allem unflexible Automatismen aufgefasst, die keinesfalls den Kern dessen ausmachen, was als professionelles, expertenhaftes Handeln gelten darf. Mehr und mehr macht sich die Einsicht breit, dass kompetentes LehrerInnenhandeln vermutlich weder als Rationalhandeln noch als bloßes Gewohnheitshandeln angemessen beschrieben ist. Im Idealfall teilt es als intuitiv-improvisierendes (vgl. VOLPERT 1994, 2003) oder situiertes Handeln (vgl. SUCHMAN 1987) mit ersterem die Flexibilität, mit zweiterem die intuitive Entschlossenheit. Mindestens diesfalls wäre dann darauf zurückzufragen, inwieweit Wissen überhaupt noch als zusätzlich zur Handlungskompetenz existierende und für diese ursächliche Entität gedacht werden kann. In hohem Maße wird es vielmehr als implizites Wissen anzusetzen sein, das im Handeln selbst seinen Ausdruck findet (vgl. dazu eingehend NEUWEG 2001, 2002, 2005). Der akademischen Lehrbarkeit kann sich ein solches Wissen aus unterschiedlichen Gründen entziehen. Zum einen kann sich dieses als zu einzelfallbezogen und kontextsensitiv erweisen, als dass seine Flexibilität und das ihr unterliegende situative Verstehen erschöpfend auf Regeln abgebildet werden könnten ( Nichtexplizierbarkeit ). Dass der Experte bzw. die Expertin auf die Frage, woran allgemein man diese oder jene Situation erkenne und was allgemein in ihr wie getan werden müsse, mit der Bemerkung, das komme darauf an, antwortet, markiert einen zentralen Unterschied gegenüber einem bloß Regel befolgenden, „Dienst nach Vorschrift“ versehenden Novizen. Zum anderen: Nicht jedes kompetente Können, das sich angemessen als Einhalten von Regeln beschreiben lässt, kann auch über diese Regeln instruiert werden ( Nichtinstruierbarkeit ). (Man denke z. B. an das „Hamburger Verständlichkeitskonzept (vgl. bspw. LANGER/ SCHULZ VON THUN/ TAUSCH 1999). Es entmystifiziert die komplexe, didaktisch hochbedeutsame Kompetenz, Sach-, Sinn- und Problemzusammenhänge verständlich darzustellen, indem es Merkmale angibt, denen eine verständliche Textdarbietung genügt. Aber obwohl der gute Vortragende oder Autor darstellt, als ob er diese Kriterien kennen und berücksichtigen würde, lernt man über die Kenntnisnahme dieser Kriterien nicht unbedingt, verständlich zu erklären. Man lernt vor allem, in seiner Wirksamkeit zu begründen, was man auch ohne dieses Wissen können kann. )
Aus mehreren Gründen allerdings besteht wenig Veranlassung zur romantischen Verklärung und Verabsolutierung des Erfahrungslernens in der LehrerInnenbildung.
(1) Erfahrung ist kein didaktischer „Selbstläufer“ .
Mit Sicherheit verändert sich im Gefolge von Erfahrung der Handlungsmodus im Feld: Man handelt zunehmend intuitiver. Aber intuitiv-improvisierendes Handeln ist nicht notwendig auch erfolgreiches Handeln und implizites „Wissen“ kann auch implizites Vorurteil und implizite Blindheit sein. Im Gegensatz etwa zu Schachspielern oder Medizinern gibt es „keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Dauer der Berufstätigkeit von Lehrern, dem Niveau ihres Expertenwissens und ihrem Unterrichtserfolg“ (WEINERT/ HELMKE 1996, 232). Die Vermutung, „dass das Klassenzimmer kein angemessenes Rückmeldesystem für langfristige Kompetenzsteigerungen der Lehrer darstellt“ (ebd.), ist durchaus nahe liegend. Denn es gibt kein Erfahrungslernen ohne Feedback über die Erfolgswirksamkeit des eigenen Handelns. Im Falle des Lehrers müsste dieses vor allem subtile Information über die Lern- und Verständnisprozesse der einzelnen Schüler und über die Zusammenhänge zwischen diesen Prozessen und dem eigenen Handeln beinhalten – eine Voraussetzung, die bei hinreichender Sensibilität des Lehrenden bestenfalls in one-to-one-teaching-Situationen gegeben ist. Im Unterschied etwa zum Tennisspiel, zum Extremklettern oder zum Schachspiel verringern sich bei der Tätigkeit des Unterrichtens mangels deutlich umrissener Ziele und rascher, klarer und interpretationsfreier Rückmeldungen die Chancen, unmittelbar aus der Erfahrung zu lernen, drastisch. Wenn man aber aus der Erfahrung nur lernen kann, wenn man in ihr auch wirklich etwas erfährt, dann ist LehrerInnenprofessionalisierung zu konzipieren als Wechselspiel von Einlassung auf Erfahrung, Reflexion auf Erfahrung und Rückübersetzung in neues Handeln und Erfahren. Professionell ist ein Lehrer dann weder aufgrund seines Wissens noch aufgrund des schlichten Ausmaßes seiner Erfahrung, sondern erst, wenn er zudem bereit ist, seine Handlungspraxis regelmäßig zu analysieren, zu evaluieren und gegebenenfalls zu verändern, wenn er Verantwortung für das eigene Wachstum übernehmen will und kann. Auszuprägen sind also ein reflexiver Habitus und eine reflexive Kompetenz – Einstellungen und Fähigkeiten, die man an und in „der Praxis“ so ohne weiteres nicht nur nicht erwirbt, sondern dort auch wirkungsvoll verlieren kann.
(2) Implizites Regelbefolgen bedingt nicht impliziten Regelerwerb.
Es ist grundsätzlich problematisch, von Beschreibungen kompetenten Handelns auf die zum Erwerb einer solchen Handlungskompetenz erforderlichen Lernprozesse rückzuschließen. Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass aus der Tatsache, dass sich ein Verhalten als regelgeleitet beschreiben lässt, nicht geschlossen werden darf, dass es auch über Regeln erworben werden kann oder muss. Es gilt aber auch die Umkehrung: Aus der Tatsache, dass ExpertInnen intuitiv handeln, darf nicht geschlossen werden, dass sie diese Handlungsfähigkeit unbedingt nur implizit erlernen sollten. Dies gibt bspw. DILLER (1975) in einer Kritik an POLANYI, dem Schöpfer des Konzepts des „impliziten Wissens“, zu bedenken; es genügt nicht, „Anfänger einfach einem praktizierenden Experten zu überantworten in der Hoffnung, dass sie die notwendigen Regeln und Fertigkeiten unbewusst lernen werden“ (DILLER 1975, 61). Gerade für den Anfänger sei der Experte nicht notwendigerweise ein guter Lehrer. „Der erfolgreiche Praktiker, eben weil er erfolgreich ist, schenkt genau dem, worauf der Anfänger achten muss, um zu lernen, keine Beachtung mehr. In seiner Rolle als erfahrener Praktiker ist er außerdem möglicherweise weder damit befasst noch fähig, viele der Regeln, denen er folgt, zu spezifizieren“ (ebd.).
(3) Praxis ist verbesserungs- und innovationsbedürftig .
Dass Praxis ihre eigene Dignität habe, gehört seit den Tagen Schleiermachers zu den Stehsätzen in der lehrerbildungsdidaktischen Debatte. Diese lehrerbildungsdidaktisch wichtige Einsicht darf freilich nicht verdecken, wie weit alltäglicher Unterricht oft hinter didaktischen Mindeststandards zurück bleibt und in welchem Maße auf Impulse der Qualitätsverbesserung und Innovation verzichtet, wer LehrerInnenbildung nur mehr als Selbstreproduktion von Praxis zu organisieren bereit ist.
(4) Die Kontraintuivität und Nichttrivialität erziehungswissenschaftlichen Wissens .
Das Argument, die bisher verfügbaren erziehungswissenschaftlichen Theorien würden wenig mehr abbilden als triviale Selbstverständlichkeiten, ist mit erheblicher Vorsicht zu genießen. Zum einen kann mittlerweile auf recht beeindruckende Bestände nicht-trivialen Wissens über Prozess-Produkt-Zusammenhänge verwiesen werden. (Ein allgemeindidaktisch ausgerichtetes Lehrprogramm mit einer Fülle empirisch abgesicherten Wissens bieten zum Beispiel FREY / FREY-EILING (1992). Dieses zu studieren vermittelt angehenden LehrerInnen zum Beispiel das durchaus kontraintuitive Wissen , dass sie mit individuell kommentierten Hausübungen im Allgemeinen mehr bewirken können als mit hervorragend strukturierten Lehrervorträgen. ) Zum anderen lässt sich zeigen, dass Menschen dazu neigen, Forschungsergebnisse grundsätzlich als selbstverständlich zu betrachten, also auch dann, wenn die vorgelegten „Ergebnisse“ das Gegenteil dessen darstellen, was Forschung tatsächlich festgestellt hat. (So wird etwa für „selbstverständlich“ gehalten, dass die Ergebnisse in Leistungstests in den Klassen eins bis neun bei stärker lehrerbestimmtem Unterricht besser sind als bei stärker schülerbestimmtem oder dass die Lernleistung von Mittelschichtskindern der dritten bis sechsten Klasse höher ist, wenn der Lehrer eher „geschäftsmäßig“ und mit etwas weniger emotionaler Wärme unterrichtet. Beides lässt sich durch Forschungsdaten belegen. Es wird aber auch das genaue Gegenteil für „selbstverständlich“ gehalten, wenn man es als Forschungsergebnis präsentiert: „Natürlich“, so meinen die Befragten dann, verbessern sich die Ergebnisse, wenn der Unterricht schülerbestimmter ist, und „natürlich“ ist die Lernleistung höher, wenn der Lehrer mehr emotionale Wärme zeigt. (Vgl. WONG 1987 zit. n. GAGE/ BERLINGER 1996, 8 f.). )
(5) Das Problem der Fehlverortung der Leistungsfähigkeit von Wissenschaftswissen .
In den letzten Jahren werden verstärkt Zweifel an der Vorstellung angemeldet, Wissenschaftswissen könne unmittelbar handlungsleitend wirken. Es fragt sich freilich, ob Wissenschaftswissen hauptsächlich oder überhaupt an diesem Anspruch gemessen werden kann. (a) Zum einen wird in der Konzentration auf Regeln mit unmittelbarem Handlungsbezug übersehen, dass Pädagogik in hohem Maße und vielleicht sogar überwiegend Aussagesysteme mit sehr mittelbarem oder ohne instrumentellen Bezug anbietet: Begriffe und Beziehungen zwischen Begriffen, Deutungssysteme und Problemmodelle, keineswegs nur nomologische oder technologische Aussagen. Zwischen solche „Theorien“ und die Praxis schieben sich intervenierende Variablen in Form von Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten, Überzeugungen, Einstellungen. Sie fungieren dann nicht als Regeln oder Rezepte, sondern als „Brillen, die jeweils etwas sichtbar machen und etwas anderes ausblenden“ (RADTKE 1999, 18), als „Hintergrundwissen“ (HERRMANN 1979) in Form von Auffassungsmustern, Sichtweisen und Problemsensibilisierungen, die von rigiden Regeln und Techniken gerade im Gegenteil unabhängig machen und dabei helfen, Übersimplifizierungen zu vermeiden und neue Problemdimensionen zu sehen. So betrachtet lernt man an der Universität nicht Handeln, sondern eher Wahrnehmen, werden „durch die Wissenschaft Augen eingesetzt, die darüber bestimmen, was der Pädagoge in seinem Tätigkeitsfeld sieht und welche Relevanzen er in seinem Handlungsfeld setzt. In der akademischen Ausbildung wird entschieden, ob er z. B. ‚begabte', ‚milieugeschädigte' oder solche Kinder sieht, die auf einer Entwicklungsleiter aufwärts hangeln etc.“ (DEWE/ RADTKE 1991, 155). (Daher sind auch empirische Befunde, denen zufolge Lehrer angeben, sich bei ihren Entscheidungen nur in geringem Maße auf erziehungswissenschaftliches Wissen zu beziehen, mit Vorsicht zu interpretieren, denn: Die „Intuition“, auf die sie sich stützen, ist unter Umständen „nichts anderes als theoretisch gelenkte Praxiswahrnehmung“ (BLÖMEKE 2002, 60). ) (b) Zum anderen: Die wachsende Einsicht in die phänomenologische und theoretische Problematik der Wendung vom „handlungsleitenden“ Wissen (vgl. bspw. BROMME 1992, RADTKE 1996, NEUWEG 2000) darf nicht dazu verleiten, mit ihr zugleich auch die Konzepte des handlungs vorbereitenden , - rechtfertigenden und korrigierenden Wissens aufzugeben, für die Wissenschaftswissen seine primäre Zuständigkeit anmelden darf und muss. Es wäre im Gegenteil im Auge zu behalten, dass auch intuitiv-improvisierendes Handeln in übergreifende Pläne eingebettet bleibt und wie jedes professionelle Handeln einer Begründungsverpflichtung unterliegt, die mindestens potenziell einlösbar sein muss. Weder Handlungsplanung noch Handlungsbegründung oder begründete Handlungskorrektur können sich aber intuitiv vollziehen oder auf Bestände expliziten Wissens verzichten.
Offensichtlich also können die Ansprüche auf Wissenschafts- und auf Praxisorientierung je für sich entwertend übertrieben werden und ebenso offensichtlich muss es deshalb darum gehen, diese beiden Grundsätze in ein Verhältnis ausgehaltener Spannung zu setzen.
Dafür bieten sich zwei sehr unterschiedliche Modelle (Für eine umfassende Darstellung denkbarer Modelle der Relationierung von Wissen und Können, Theorie und Praxis in der LehrerInnenbildung vgl. NEUWEG (2004). ) an (vgl. Abb. 1): ein Integrationsmodell, wie es einphasigen LehrerInnenbildungskonzepten zu Grunde liegt und in dem Theorie- und Erfahrungslernphasen im Idealfall über die gesamte Bildungsbiographie hinweg möglichst intensiv ineinander verzahnt werden, sowie ein Phasenmodell, das die LehrerInnenbildung institutionell, personell und funktional in drei klar voneinander unter scheidbare Phasen aufgliedert.
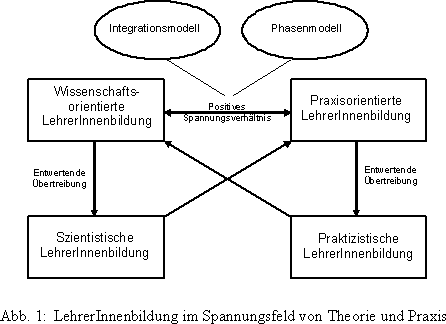
Das Integrationsmodell ist von der Leitidee getragen, die Bereiche des Wissens und Denkens einerseits und des Handelns andererseits möglichst weitgehend zur Deckung zu bringen. Zur einen Seite hin soll Wissen in möglichst hohem Maße handlungssteuernd werden, zur anderen Seite hin Handeln sich als reflektiert ausweisen. Die Nichtüberschneidungsbereiche zwischen Wissen und praktischem Können dagegen gelten als Betriebsunfälle im Rahmen einer nicht geglückten LehrerInnenbildung, als träges Wissen einerseits, blinde Routine andererseits (vgl. Abb. 2).
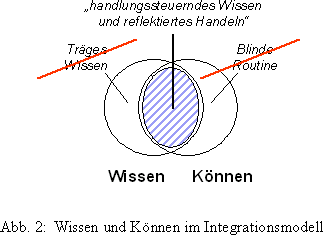
Als hauptverantwortlich für das viel beklagte Theorie-Praxis-Problem gilt dabei die traditionelle Phasengliederung der LehrerInnenbildung. Sie wird mit dem Argument abgelehnt, dass erstens in der ersten, praxisentlasteten Phase Theorien unanschaulich und in der zweiten Phase Anschauungen untheoretisch bleiben und es zweitens zu keinen produktiven Begegnungen zwischen objektiven und subjektiven Theorien kommt. Wirksame Veränderungsprozesse setzen in der Perspektive des Integrationsmodells systematischen Konfrontationen von subjektiven mit objektiven Theorien voraus, und zwar in Form einer Bewusstmachung subjektiver Theorien anhand konkreter Praxiserfahrung, der Modifikation dieser Theorien durch objektive Theorien und der handelnden Rückübersetzung der gewonnenen Einsichten in neue Praxiserfahrung. Dies erfordert eine zeitliche und didaktische Parallelschaltung von Theorie- und Praxisbezügen, die letztlich dem Wissens- und dem Könnenserwerb gleichermaßen dienlich ist. Einerseits nämlich bleibt Erfahrung ohne Begriffe blind; was jemand erfährt, hängt von den begrifflichen Kategorien ab, mit denen er an diese Erfahrung herantritt. Andererseits bleiben Begriffe ohne Erfahrung leer; welche Theorieangebote jemand wie versteht, hängt von den Erfahrungen ab, die er schon gemacht hat.
Inwiefern im Rahmen einer dadurch nahe gelegten Parallelisierung von Sache und Sprache das Licht nach und nach über der äußeren Wirklichkeit und den begrifflichen Konzepten zugleich aufgeht, verdeutlicht Michael POLANYI (1964, 101, Übers. u. Hervorh. G.H.N.) am Beispiel eines Medizinstudenten, der lernt, Lungenradiogramme zu interpretieren:
„Er betrachtet in einem verdunkelten Raum vage Spuren auf einem gegenüber der Brust des Patienten platzierten Leuchtschirm und hört, wie der Radiologe seinen Assistenten in der Fachsprache die bedeutsamen Merkmale dieser Schatten erläutert. Zunächst ist der Student vollkommen verwirrt. Denn er vermag im Röntgenbild eines Brustkorbs nur die Schatten von Herz und Rippen mit einigen spinnenartigen Flecken dazwischen zu erkennen. Die Experten scheinen über pure Produkte ihrer Einbildungskraft zu fabulieren; er kann nichts von dem sehen, worüber sie sprechen . Durch fortgesetztes Zuhören während einiger Wochen und sorgfältiges Betrachten immer neuer Bilder verschiedener Fälle werden dann erste Anzeichen von Verständnis heraufdämmern; er wird allmählich die Rippen vergessen und beginnen, die Lungen zu sehen. Und schließlich wird sich ihm, wenn er verständig fortfährt, ein reiches Panorama bedeutsamer Details auftun: von physiologischen Abweichungen und pathologischen Veränderungen, von Narben, von chronischen Infektionen und Anzeichen akuter Krankheit. Er hat eine neue Welt betreten. Immer noch sieht er nur einen Bruchteil dessen, was die Experten zu sehen vermögen, aber die Bilder machen nun eindeutig Sinn und das gilt auch für die auf sie bezogenen Erläuterungen. [...] Der Student hat also genau in dem Augenblick, in dem er die Sprache der Lungenradiologie erlernt hat, auch gelernt, Lungenradiogramme zu verstehen. Beides kann nur zusammen geschehen. Beide Hälften des Problems, vor das uns ein unverständlicher Text stellt, der sich auf einen unverstandenen Gegenstand bezieht, leiten gemeinsam unsere Problemlöseanstrengungen, und werden schließlich zusammen durch das Entdecken eines Konzepts gelöst, das ein gemeinsames Verstehen sowohl der Worte als auch der Dinge umfasst.“
Mit dem Integrationsgedanken verbinden sich auch hohe Ansprüche an das in der LehrerInnenbildung tätige Personal. Vorausgesetzt wäre einerseits, dass Lehrende selbst können, wovon sie theoretisch überzeugt sind. Möglicherweise werden die potenziellen Effekte eines Lehramtsstudiums gerade dann massiv unterlaufen, wenn Theoretiker darin Studierenden eine Praxis predigen, die sie selbst nicht beherrschen. Aber nicht nur HochschullehrerInnen müssten im Integrationsmodell praktisch können, was sie theoretisch wissen; auch BetreuungslehrerInnen und Praxisvorbilder müssten in der Lage sein, theoretisch zu kommentieren und zu begründen, was sie meisterlich vorzuzeigen vermögen.
Die Grenzen zwischen den traditionellen Phasen lösen sich im Integrationskonzept in hohem Maße auf. An allen Stellen des LehrerInnenbildungsgeschehens nämlich ginge es darum, an konkreter Praxiserfahrung anzusetzen, und gleichzeitig dürfte LehrerInnenbildung an keiner Stelle als bloße Einsozialisierung in Praxis ohne begriffliche Durchdringung und reflexive Brechung missverstanden werden.
Ganz anders stellt sich die Beziehung zwischen Wissen und Können im Phasenmodell dar. Die Welten des Wissens und des praktischen Könnens werden als different betrachtet, die ihnen jeweils korrespondierende Formen der Weltaneignung als kategorial verschieden konzipiert. Die Forderung, „praktisches“ oder „persönliches“ Wissen einerseits und „Buchwissen“ andererseits könnten oder müssten nahezu ohne Rest ineinander aufgehen, wird von Grund auf problematisiert (vgl. Abb. 3). Die Abbildung verdeutlicht, dass zum einen die beiden Bereiche nun weiter auseinander rücken. Es verändert sich vor allem aber auch die Attitüde gegenüber den Nichtüberschneidungsbereichen.
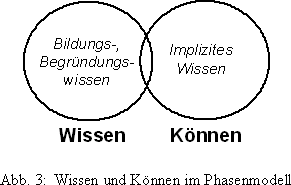
Wissen ohne unmittelbar korrespondierendem Können gilt jetzt nicht mehr exklusiv als zu vermeidendes träges Wissen; ins Auge gefasst wird vielmehr, dass es sich dabei um unverzichtbares Bildungs-, Hintergrund-, Reflexions- oder Begründungswissen handeln kann, das am Maßstab der unmittelbaren Handlungsrelevanz gar nicht abzutragen ist. Auf der anderen Seite gelten nicht mehr alle Formen eines durch explizites Wissen nicht unterlegten Könnens als Ausdruck blinder Routine, sondern unter Umständen als Erscheinungsformen recht subtilen impliziten Wissens.
Leitidee des Phasenmodells ist nun die Überzeugung, dass nicht alles zugleich und am ungeeigneten Ort erledigt werden muss (RADTKE 1996). Aus der epistemologischen Differenz zwischen explizitem Wissenschaftswissen und implizitem Handlungswissen wird eine phasen- und institutionenspezifische Zuordnung von Ausbildungsaufgaben abgeleitet. Die erste, universitäre Phase hat dabei die Aufgabe, in radikaler Distanz zur Praxis einen wissenschaftlich-forschenden, an der Wahrheitsidee orientierten Habitus aufzubauen und Begründungswissen zu vermitteln. In der zweiten Phase soll die implizite Handlungsgrammatik der Praxis durch Eigenerfahrung, durch Modell-Lernen und durch Teilhabe an communities of practice angeeignet werden. Die dritte Phase der LehrerInnenfortbildung schließlich dient der Korrektur der in der Praxis missglückten „Sätze“ durch Neubegegnungen mit der expliziten Grammatik pädagogisch-didaktischen Handelns.
Hinter dem Modell steht letztlich die Überzeugung, dass die je für sich unverzichtbaren Momente des Theorie- und des Könnenserwerbs im Falle der didaktischen Gleichzeitigkeit, wie sie das Integrationsmodell vorsieht, interferieren und einander dann wechselseitig verkürzen. Dahinter steht einerseits fundamentaler Zweifel daran, ob die für die wirklich tief greifende Assimilation sowohl des Fach- als auch des pädagogischen Wissens erforderlichen Bildungsprozesse in der Nähe zum Funktionsfeld und dadurch bewerkstelligbar sind, dass den Studierenden immer und überall mitgezeigt wird, welche „praktische Relevanz“ Erkenntnis für sie hat. Integrationsmodelle, so wird befürchtet, laufen Gefahr, den reflexiven Anspruch an dem abzutragen, was angehenden LehrerInnen im Rahmen ihrer Praxiserfahrung selbst zum Problem wird. Es geht aber auch um die Verbreiterung der Perspektiven, aus denen heraus Probleme ihre Rahmung erfahren. Akademisches Wissen muss deshalb eine reflexive Breite induzieren, die sich nicht am Maßstab der Utilität erschöpft, und die Chance erhöhen, dass Reflexion über den Tellerrand der Klassenzimmererfahrung hinaus- und – beispielsweise – in curriculare, bildungstheoretische, anthropologische und gesellschaftstheoretische Fragestellungen hineinreicht. Daher erfordert Theorielernen eine Kultur der Distanz, während Verwertungsdruck das Lernen zur intellektuellen Seite hin entscheidend verkürzen kann.
Andererseits: So, wie Theorielernen und Reflexion einer Kultur der Distanz bedürfen, die sich nicht ständig durch Praxis irritieren lassen darf, so bedarf umgekehrt der Könnenserwerb einer Kultur der durch Wissen nicht ständig irritierten Einlassung. Reflexionsdruck nämlich vermag Lernen zur intuitiven Seite hin zu verkürzen. Als Tausendfüßersyndrom kennt immerhin schon der Alltagssprachgebrauch das Problem der Performanzverschlechterung durch Interferenzen zwischen Denken und Tun, und als Dienst nach Vorschrift schließlich ist die Verdrängung lebendiger Flexibilität durch Regeln und Rezepte bekannt. „Eine der Stärken (und zugleich Schwächen) der Formalisierung“, analysiert BOURDIEU (1992, 108), „liegt darin, dass sie – wie jede Rationalisierung – einem erspart, sich Neues ausdenken, improvisieren, schöpferisch tätig sein zu müssen.“ Daher ist immer mit dem Phänomen der Verdrängung von Lernen durch Wissen zu rechnen. Es lernt durch Erfahrung nicht nur schlecht, wer gar nichts weiß, sondern auch, wer glaubt, schon alles zu wissen.
ACHTENHAGEN, F. (1984): Didaktik des Wirtschaftslehreunterrichts. Opladen.
BABEL, H. (2005): „Praxis“ – das „Maoam“ der universitären LehrerInnenbildung. Über die merkwürdige Unstrittigkeit der Forderung nach mehr „Praxis“ im Lehramtsstudium. In: DZIERZBICKA, A./ KUBAC, R./ SATTLER, E. (Hrsg.): Bildung riskiert. Erziehungswissenschaftliche Markierungen. Wien, 123-130.
BECK, K. (1983): Lehrerausbildung als „Verbindung“ von Theorie und Praxis? Über den Status von Theorien im Kontext der Lehrerrolle. In: Pädagogische Rundschau, 37, 145-169.
BECK, K. (1992): Zur Funktion von Universität und Studienseminar in der Ausbildung von Lehrern für berufsbildende Schulen. In: BONZ, B./ SOMMER, K.-H./ WEBER, G. (Hrsg.): Lehrer für berufliche Schulen. Lehrermangel und Lehrerausbildung. Esslingen, 183-200.
BLÖMEKE, S. (2002): Universität und Lehrerausbildung. Bad Heilbrunn/Obb.
BOLLNOW, O.F. (1991): Vom Geist des Übens. Eine Rückbesinnung auf elementare didaktische Erfahrungen. 3., durchges. u. erw. Aufl. Stäfa.
BOURDIEU , P. (1992): Die Kodifizierung. Vortrag, gehalten im Mai 1983 in Neuchatel. In: Ders: Rede und Antwort. Frankfurt a. M., 99–110.
BREZINKA, W. (1978): Metatheorie der Erziehung. Eine Einführung in die Grundlagen der Erziehungswissenschaft, der Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädagogik. München.
BROMME, R. (1992): Der Lehrer als Experte. Zur Psychologie des professionellen Wissens. Bern.
DEWE, B./ RADTKE, F.-O. (1991): Was wissen Pädagogen über ihr Können? Professionstheoretische Überlegungen zum Theorie-Praxis-Problem in der Pädagogik. In: OELKERS, J./ TENORTH, H.-E. (Hrsg.): Pädagogisches Wissen. Weinheim, 143-162.
DILLER, A. (1975): On Tacit Knowing and Apprenticeship. In: Educational Philosophy and Theory, 7, 55-63.
FREY, K./ FREY-EILING, A. (1992): Allgemeine Didaktik. 5., völlig überarb. Aufl. Zürich.
GAGE, N.L./ BERLINGER, D.C. (1996): Pädagogische Psychologie. 5., vollst. überarb. Aufl. Weinheim.
GRUBER, H./ RENKL, A. (2000): Die Kluft zwischen Wissen und Handeln. Das Problem des trägen Wissens. In: NEUWEG, G.H. (Hrsg.): Wissen – Können – Reflexion. Ausgewählte Verhältnisbestimmungen. Innsbruck, 155-174.
JAMES, W. (1908): Psychologie und Erziehung. Ansprachen an Lehrer. 2., überarb. Aufl. Leipzig. (Orig. 1899, 1. dt. Aufl. 1900).
HERBART , J.F. (1802): Die erste Vorlesung über Pädagogik. In: MÜSSENER, G. (Hrsg.) (1991): Johann Friedrich Herbart. Didaktische Texte zu Unterricht und Erziehung in Wissenschaft und Schule. Wuppertal, 137-144.
HERRMANN, T. (1979): Psychologie als Problem. Herausforderungen der psychologischen Wissenschaft. Stuttgart .
KORTHAGEN , F.A.J. (2001): Linking Practice and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education. Mahwah, NJ.
LANGER, I./ SCHULZ VON THUN, F./ TAUSCH, R. (1999): Sich verständlich ausdrücken. 6. Aufl. München.
NEUWEG, G.H. (2000): Können und Wissen. Eine alltagssprachphilosophische Verhältnisbestimmung. In: Ders. (Hrsg.): Wissen – Können – Reflexion. Ausgewählte Verhältnisbestimmungen. Innsbruck, 65–82.
NEUWEG, G.H. (2001): Könnerschaft und implizites Wissen. Zur lehr-lerntheoretischen Bedeutung der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis. 2., korr. Aufl. Münster.
NEUWEG, G.H. (2002): Lehrerhandeln und Lehrerbildung im Lichte des Konzepts des impliziten Wissens. In: Zeitschrift für Pädagogik, 48, H.1, 10–29.
NEUWEG, G.H. (2004): Figuren der Relationierung von Lehrerwissen und Lehrerkönnen. In: HACKL, B./ NEUWEG, G.H. (Hrsg.): Zur Professionalisierung pädagogischen Handelns. Arbeiten aus der Sektion Lehrerbildung und Lehrerbildungsforschung in der ÖFEB. Münster, 1–26.
NEUWEG, G.H. (2005): Implizites Wissen als Forschungsgegenstand. In: RAUNER, F. (Hrsg.): Handbuch der Berufsbildungsforschung. Bielefeld, 581-588.
PATRY, J.-L. (2000): Schulunterricht ist komplex – Kann da Theorie noch praktisch sein? In: Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft, 4, H.1, 43-59.
POLANYI, M. (1964): Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. New York.
RADTKE, F.-O. (1996): Wissen und Können. Die Rolle der Erziehungswissenschaft in der Erziehung. Opladen.
RADTKE, F.-O. (1999): Autonomisierung, Entstaatlichung, Modularisierung. Neue Argumente in der Lehrerbildungsdiskussion? In: Ders. (Hrsg.): Lehrerbildung an der Universität. Zur Wissensbasis pädagogischer Professionalität. Frankfurt a. M., 11–25.
SUCHMAN, L. (1987): Plans and Situated Actions. The Problem of Human Machine Communication. Cambridge.
TERHART, E./ CZERWENKA, K./ EHRICH, K./ JORDAN, F./ SCHMIDT, H.J. (1994): Berufsbiographien von Lehrern und Lehrerinnen. Frankfurt a. M..
VOLPERT, W. (1994): Wider die Maschinenmodelle des Handelns. Aufsätze zur Handlungsregulationstheorie. Lengerich.
VOLPERT, W. (2003): Wie wir handeln – was wir können. Ein Disput als Einführung in die Handlungspsychologie. 3., vollst. überarb. Aufl. Sottrum.
WEINERT, F.E./ HELMKE, A. (1996): Der gute Lehrer: Person, Funktion oder Fiktion? In: LESCHINKSY, A. (Hrsg.): Die Institutionalisierung von Lehren und Lernen. Beiträge zu einer Theorie der Schule. Weinheim, 223–233.
WEINERT, F.E./ SCHRADER, F.-E./ HELMKE, A. (1990): Unterrichtsexpertise – Ein Konzept zur Verringerung der Kluft zwischen zwei theoretischen Paradigmen. In: ALISCH, L.-M./ BAUMERT, J./ BECK , K. (Hrsg.): Professionswissen und Professionalisierung. Braunschweig, 173-206.