|
| ||



Studierende der Pädagogik sind aufgerufen, einen „forschenden Habitus“ zu entwickeln (OBOLENSKI/ MEYER 2006). Also eine Haltung, die sich der Erkenntnisgewinnung verpflichtet weiß. Forschung kennzeichnet einen Standpunkt des Subjekts zur Welt, dem es um die Erlangung von neuem Wissen, um begründete Urteile über Natur, Technik wie auch gesellschaftliche Praxis geht. Theorien etwa über die Schwerkraft, die Schule oder die Arbeitswelt geben an, was diese Gegenstände jeweils kennzeichnet und von anderen Dingen und Sachverhalten unterscheidet, warum sie so und nicht anders sind, was also ihr Begriff, Grund und Zweck ist.
Nun zielt jedwedes Lernen von Theorien auf Erkenntnisgewinnung. Als Resultat des Lernprozesses entsteht neues Wissen beim Lernenden. Im Terminus des „forschenden Lernens“ ist aber gefordert, im Studium über die Prüfung und Aneignung existierender Theorien hinauszugehen. Die Generierung neuen Wissens soll also zentrales Element beim Erwerb von Wissen, dem Lernen, werden.
EULER (2005) fokussiert mit der Forderung nach forschendem Lernen nicht nur die Art der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien, sondern nimmt auch Praxiskontakte im Studium in den Blick. „Getreu dem Prinzip, dass nicht nur für das Leben, sondern auch in ihm gelernt wird, ist die Lebenspraxis nicht nur Gegenstand einer distanzierten intellektuellen Reflexion, sondern auch ein Ort der Erfahrung, der zumindest exemplarisch aufgesucht bzw. konkret aufgenommen wird, um Probleme zu erkunden und Problemlösungen zu überprüfen.“ (EULER 2005, 13)
Das Erleben, die Erfahrung in der Praxis, die ja Ausgangspunkt und Gegenstand von Wissenschaft ist, soll danach für angehende Pädagogen nicht in erster Linie der Vorbereitung auf den Lehrerberuf im Sinne des Einübens von professionellen Handlungsroutinen dienen, sondern der wissenschaftlichen Erkenntnis, die über die erkundeten „Probleme“ aufklärt, indem die vorgefundenen Lösungen „überprüft“ werden. Was EULER für Probleme, also für Sachverhalte, die aus dem Blickwinkel bestimmter Interessen als verbesserungsbedürftig angesehen werden, formuliert, lässt sich auf die gedankliche Erschließung betrieblicher und schulischer Praxis generell ausdehnen: die Ermittlung und Bewertung gültiger Ziele und Interessen, der dabei verfolgten Strategien, notwendiger Kompetenzen etc.
Als dafür ausgewiesene Orte und Gelegenheiten gelten studienintegrierte Praktika. So formulieren etwa die Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Praxisphasen in Nordrhein-Westfalen: „Forschendes Lernen setzt Praktika im Handlungsfeld Schule in Beziehung zu einer spezifischen Interessenhaltung, die auf Wissenschaftlichkeit ausgerichtet ist. Diese Bedeutungskomponente ergibt sich, wenn man Lernen im schulischen Handlungsfeld aus der Perspektive der in einem weiten Sinne zu verstehenden Tätigkeit des Forschens sieht. Mit dieser Tätigkeit ist zunächst eine Haltung der Neugierde verknüpft im Sinne von Offenheit, neue Erkenntnisse erwerben und verarbeiten zu wollen. Weiterhin verbindet sich mit reflektierter Neugierde das Interesse, den Erkenntniserwerb zu methodisieren und die Verarbeitung von Erkenntnissen zu systematisieren.“ ( BOELHAUVE et al. 2004, 5)
Was hier für das Praxisfeld Schule formuliert wird, gilt für angehende Berufspädagogen in doppelter Weise. Für die schulische wie auch gleichermaßen für die betriebliche Praxis. Neuere Studienkonzepte sehen für betriebliche Praxiskontakte speziell ausgewiesene Praxisstudien vor. So auch im kooperativen Studiengang für das Lehramt an Berufskollegs, der gemeinsam von der Westfälischen Wilhelms-Universität und der Fachhochschule Münster betrieben wird. Von der Hochschule angeleitete betriebliche Praxiserschließung ist als fester Studienbestandteil etabliert. Im Umfang von bis zu einem Semester soll betriebliche Realität erlebt und im skizzierten Sinne erforscht werden (vgl. ADIEK/ STUBER 2006). Das in Abschnitt 3 skizzierte Informationsportal „Betriebliche Praxisfelder erschließen“ spielt darin die Rolle eines Werkzeugs für verschiedene Aufgabenstellungen, die von der Themenfindung für studentische Projektvorhaben, über Informationen zu berufswissenschaftlichen Analysemethoden bis zu Checklisten für den Einsatz empirischer Erhebungstechniken reicht.
Angehende Berufspädagogen sollen vor Antritt ihrer Lehrtätigkeit systematische Einblicke in die betrieblichen Arbeits- und Bildungsprozesse, sowie in das außerschulische Arbeitsumfeld ihres jeweiligen beruflichen Studienschwerpunkts erhalten. Um diesen im Sinne des forschenden Lernens erarbeiten zu können, bedarf es der Bereitstellung wissenschaftlicher Expertise. Studierende müssen die konzeptionellen Ansätze und methodischen Vorgehensweisen, die die Wissenschaft entwickelt hat, kennen lernen, einschätzen können und exemplarisch anwenden.
Woran soll man sich dabei orientieren? Insbesondere zwei theoretische Orientierungspunkte sind hier relevant. Dies ist einmal die Berufsbildungsforschung: „Berufsbildungsforschung beschäftigt sich in ihrem Kern mit berufsförmig organisierten Arbeitsaufgaben und -prozessen als konstitutiven Momenten für die Organisation und Gestaltung von Qualifizierungs- und Bildungsprozessen, die sich in mehr oder weniger formalisierten beruflichen Bildungsgängen und -systemen vollziehen. Ihr Erkenntnisinteresse richtet sich auf Phänomene, die in den situativen Praktiken der Handelnden konstituiert sind. Die Handlungskontexte sind daher eine zentrale Quelle der Erkenntnis und nicht eine Störquelle.“ (RAUNER 2005, 557)
Mit einem Plädoyer für die Analyse der stattfindenden Praxis als Erkenntnisquelle macht RAUNER deutlich, dass es der Berufsbildungsforschung um die Erschließung der beruflichen Facharbeit und der darin eingeschlossenen Kompetenzen geht. Folgt man dieser Argumentation, so ist die praktische Stellung des Forschers aber nicht von dem ermittelten Wissen her formuliert, sondern vorab in den Dienst folgender Aufgaben gestellt:
• Entdecken und sichern `tatsächlich` verwendeten Wissens und Könnens der Facharbeiter im Arbeitsprozess;
• Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs;
• Identifizieren typischer Arbeitsaufgaben für einen Beruf, Ordnen dieser Aufgaben in einer entwicklungslogischen Struktur;
• Entwicklung von Lern- und Arbeitsaufgaben (Inhalte und Methoden);
• Curriculumentwicklung und -revision;
• Lernortgestaltung (Ausstattung von Lernräumen, integrierte Fachräume usw.);
• Entwicklung problemorientierter Lernumgebungen.
Die Berufsbildungsforschung verknüpft demnach ihr wissenschaftliches Interesse der Erkenntnisgewinnung mit dem Willen zur Gestaltung der von ihr untersuchten Praxis. Sie nähert sich ihrem Untersuchungsgegenstand nicht unvoreingenommen, sondern mit dem vorab festgelegten Bekenntnis, dass die untersuchte Praxis Unterstützung verdiene. Der Vorteil des direkten sich Einlassens auf die „Handlungskontexte“ wird daher mit einem Nachteil erkauft. Die grundsätzlich positive Einstellung der Berufsbildungsforschung zu ihrem Untersuchungsgegenstand verschließt ihr möglicherweise Erkenntnisquellen. Ein unvoreingenommenes Einlassen der Studierenden auf die Praxis, die es zu erforschen gilt, halten wir hingegen für eine Voraussetzung, substanzielle Eigenarten derselben zu erschließen und auch, gegebenenfalls eine als schlecht erkannte Praxis zu verwerfen.
Als ein weiterer Orientierungspunkt empfiehlt sich die empirische Sozialforschung. „Empirisch kommt aus dem Griechischen und heißt `auf Erfahrung beruhend/ erfahrungsmäßig`. Diese Erfahrung kann auf Beobachtung, Befragung, Experimenten oder anderem Datenmaterial beruhen. Empirische Forschung sucht also nach Erkenntnissen durch systematische Auswertung von Erfahrung. - Nach einem empirisch-sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsverständnis ist zur Prüfung einer Theorie die Konfrontation daraus abgeleiteter Aussagen, Fragestellungen oder Hypothesen mit der Erfahrungswelt notwendig." (REICHER/ STIGLER 2005, 86)
Empirische Sozialforschung teilt demnach mit jeder Wissenschaft den Ausgangspunkt, dass sie nicht von Phantastereien und Glaubensbekenntnissen etc. ausgeht, sondern von dem, was in der Welt erfahren wird. Dabei reicht es für wissenschaftliche Erkenntnis nicht aus, dass diese Erfahrungen subjektiv-individueller Art sind; vielmehr müssen sie systematisiert und gedanklich ausgewertet werden. Dafür hat die empirische Sozialforschung vielfältige Ansätze, Verfahren und Systeme methodischer Regeln entwickelt.
Folgt man dem obigen Zitat, so formuliert die empirische Sozialforschung dabei allerdings einen Zirkelschluss. Denn die Empirie ist bei ihr einmal der Ausgangspunkt und Gegenstand der Erkenntnistätigkeit und zugleich soll sie Kriterium für den Wahrheitsgehalt von Theorien sein. Beides kann aber nicht zugleich gelten. Methodisch kontrolliertes Beobachten, Befragen und Experimentieren erlaubt die Praxiserschließung im Sinne der Gewinnung und Strukturierung von Aussagen und Sachverhalten. Mit dieser Registrierung von Phänomenen ist aber noch keine Erklärung über Grund und Zweck dieser Erscheinungen geleistet. Fakten aus der Erfahrungswelt werden erhoben und zur Kenntnis gebracht. Damit werden sie zum Stoff und Hilfsmittel für das Nachdenken. Werden sie nun analysiert, also forschend durchdrungen, hilft der zirkuläre Rückgriff auf das empirische Material nicht weiter, sondern nur Argumente. Der „Forschende Lerner“ hat durch seine Argumentation und Begründung zu überzeugen. Daher darf die Rolle der Erhebungsmethoden keinesfalls überschätzt werden. Erhebungsmethoden und entsprechende Instrumente strukturieren das Feld der Erscheinungen, aber sie ersetzen nicht die Qualität der Argumentation.
Die positive Voreingenommenheit in dem einen Falle, und die zirkuläre Doppelbewertung des empirischen Materials in dem anderen Falle, machen Berufsbildungsforschung und empirische Sozialforschung zu wichtigen, aber ergänzungsbedürftigen Orientierungen für betriebliche Praxisstudien. Dies gilt umso mehr, als Lehramtsstudierende, die Praxisstudien durchführen sollen, keine erfahrenen und beruflich ausgewiesenen Forscher sind; auch wollen sie in aller Regel keine solchen werden, sondern Lehrer. Eine handhabbare Balance zu finden zwischen methodischer Präzision auf der einen Seite und argumentativer Standfestigkeit und Überzeugungskraft auf der anderen Seite ist also eine große Herausforderung für die Unterstützung forschenden Lernens angehender Berufspädagogen.
Dieser Herausforderung stellt sich das Informationsportal „Betriebliche Praxisfelder erschließen“. Es greift die genannten Defizite der Berufsbildungs- und Sozialforschung für studentische ‚Praxisforscher' auf setzt dies in ein neues Online-Tool um. Die Entwicklung des Informationsportals erfolgt seit 2005 im Rahmen des Forschungsvorhabens „Forschendes Lernen in der Lehrerbildung - Professionalisierung durch Stärkung des Berufsfeldbezuges “ am Institut für Berufliche Lehrerbildung IBL der Fachhochschule Münster. Sie wird gefördert vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Stiftung Mercator im Programm „Neue Wege in der Lehrerausbildung“ (ADIEK/ STUBER 2006).
Die Entwickler haben dem Portal verschiedene Zielsetzungen gegeben. Es versucht erstens, dem anhaltend großen Informationsbedarf der Studierenden in Bezug auf handhabbare Methoden und Instrumente für die Planung und Durchführung von Praxisstudien nachzukommen. Zweitens nimmt es für die Perspektive der späteren Berufsarbeit als Berufspädagogen Kompetenzen für die Ausgestaltung von Lernfeldern in den Blick. Professionalität im Lehrerberuf bedeutet permanente Fort- und Weiterbildung, Schulmanagement, Medien- und Curriculumentwicklung, Lernortkooperation und Expertenwissen im Berufsfeld. Daher werden drittens Anforderungen dieser übergreifenden Tätigkeitsfelder und Praxisorte mit einbezogen. Viertens ist zugleich klar, dass es für die unterschiedlichsten Vorhaben, denen Studierende in ihren Studien nachgehen, weder die eine Methode, noch das perfekt vorbereitete Instrument gibt, das stets empfohlen werden kann. Somit kann ein Online-Portal eine „face-to-face“-Betreuung nicht ersetzen . Im besten Falle verhilft es fünftens den Studierenden zu fundierten Grundlagen über das, was sie zur Vorbereitung und im Vollzug wissen können und sich aneignen müssen . Im Idealfall entwickeln sich so präzise Vorstellungen, welche Kompetenzen für die erfolgreiche Realisierung betrieblicher Praxisstudien notwendig sind und wie diese in ein Erfolg versprechendes Forschungsdesign umgesetzt werden können.
Diese Anforderungen münden als Gestaltungselemente in einen dreigliedrigen Aufbau.
• Eine erste Abteilung umfasst Hilfestellungen für die Frage: Was sind die Anforderungen und was ist zu tun in Praxisstudien? Diese finden sich unter „Informationen zu den Aufgabenstellungen in Praxisstudien“.
• Zielführende (und möglichst knappe) Ausführungen zu ausgewählten Untersuchungsfeldern und Methoden der Sozial-, Berufs- und Arbeitswissenschaften finden sich in der Abteilung „Untersuchungsgegenstände und Methoden“.
• In der abschließenden Abteilung „empirische Werkzeuge“ finden sich Angaben und Einschätzungen zu Instrumenten der empirischen Sozial- und Bildungsforschung, die in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden.
Abbildung 1 zeigt den generellen Aufbau des Portals „Betriebliche Praxisfelder erschließen“.
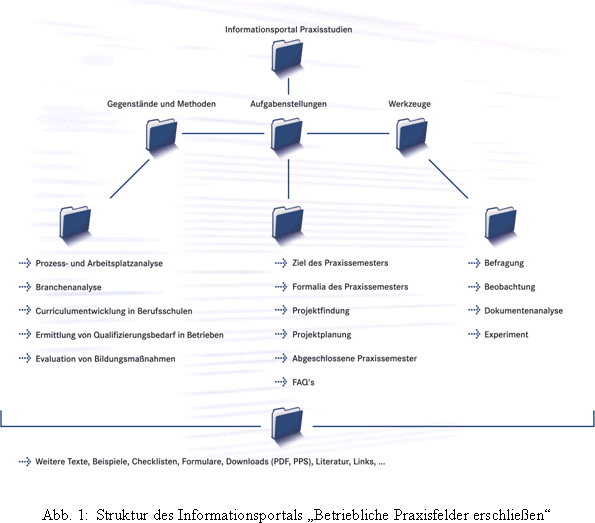
Damit betriebliche Praxisstudien den erwünschten Nutzen erbringen, ist es unbedingt erforderlich, die Durchführung nicht dem Zufall oder den im Betrieb vorfindlichen Bedingungen zu überlassen. Es ist notwendig, die gewünschten Resultate durch eine systematische, planmäßige Vorbereitung anzuvisieren und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sicherzustellen.
Dazu gehört als erster Schritt, über die Zielsetzungen im Sinne der Erwartungen der Hochschule aufzuklären. Der Bogen ist dabei weit gespannt: Möglich ist die Befassung etwa mit folgenden Sachverhalten:
• Vernetzung der betrieblichen Praxis mit der schulischen Ausbildung,
• Kompetenzprofile und Arbeitsbeziehungen von Auszubildenden und Fachkräften,
• direkter Erwerb von Erfahrung und Arbeitsprozesswissen im Arbeitsprozess im Berufsfeld,
• Wirkungs- und Gestaltungsprozesse im Spannungsfeld unternehmerischer Gewinnkalkulation, Technikentwicklung und Arbeitnehmerinteressen,
• Interessen, Motive und Kooperationsformen weiterer Akteure der beruflichen Bildung (Kammern, Lehrwerkstätten, Bildungsverwaltung und -politik, Forschungseinrichtungen etc.).
Diese Breite und Offenheit fordert von Anbeginn dazu heraus, die Themenstellung gut zu planen, sich frühzeitig mit allen Akteuren abzusprechen und ein planvolles Vorgehen von der ersten Projektidee bis zur zeitlichen Strukturierung einzelner Realisierungsschritte zu entwickeln. Das Portal bietet dafür Hilfen für Projektfindung und Projektplanung an. So empfehlen wir, frühzeitig eine knappe Projektskizze zu erstellen und kontinuierlich zu ergänzen und zu aktualisieren. Diese sollte eine Diagnose des Projektfeldes, eine Beschreibung des methodischen Designs und eine Terminplanung umfassen. Verschiedene Leitfragen sollen die Erstellung der Skizze unterstützen. Beispielhaft für die Themenfindung:
• Überlegen Sie, was Sie während Ihres bisherigen Studiums bereits an Grundlagen erworben haben und welches „Thema“ bzw. welche Fragestellung (z.B. innerhalb eines Seminars) Ihnen besonders interessant vorgekommen ist (Bsp. Lernortkooperation zwischen Ausbildungsleitung des Betriebes und Berufskolleg oder: neue Entwicklungen innerhalb einer Berufsgruppe).
• Überlegen Sie, ob sich dieses „Thema“ bzw. diese Fragestellung mit einem Vorhaben für die Praxisstudie verknüpfen lässt.
• Überlegen Sie dann, welche Gesichtspunkte Sie innerhalb ihres „Themas“ genauer verfolgen wollen (z.B. Lernortkooperation - Befragung von Auszubildenden). Präzisieren Sie also die Problemformulierung.
• Bedenken Sie: Unbrauchbar sind vorläufige Untersuchungsideen, die unklare, mehrdeutige oder schlecht definierte Begriffe enthalten (Bsp. „Probleme und Entwicklungen innerhalb der Lernortkooperation bei der gewerblich-technischen Ausbildung“).
• Vermeiden Sie Fragestellungen, bei denen man absehbar nur schon seit langem Bekanntes wieder reproduziert. Aspekte wie die Abstimmung mit den Gegebenheiten der Praxisforschungsstätte, die Aktualität des Themenbereiches und die Erweiterung des Wissens im Hinblick auf die spätere Lehrtätigkeit sollten Berücksichtigung finden.
Oder für die Projektplanung:
• Welchen Anforderungen der Hochschule wollen Sie besonders nachgehen? Sind ihre Interessen an einer bestimmten Praktikumsstelle und ihre eigene Fragestellung darauf abgestimmt? Ergeben sich hier möglicherweise Konflikte? Wenn ja, welche?
• Welche Vorkenntnisse über Ihre Praktikumsstelle haben Sie und wie gedenken Sie, diese mit Ihrer Fragestellung zu verknüpfen? Welche möglichen Anforderungen wird die Praktikumsstelle an Sie formulieren?
Weitere Anregungen in diesem Bereich geben summarische Darstellungen von „good-practice“-Beispielen abgeschlossener Praxisstudien.
In dieser Abteilung erfolgt die einführende Darstellung typischer Untersuchungsfelder bildungswissenschaftlich orientierter Praxiserschließung und dafür entwickelter Methoden und Verfahren. Sie zeigt bekannte und teils in verschiedenen Kontexten erprobte Zugangsweisen zur Erschließung und Erklärung betrieblicher Praxis auf, an denen sich eigene Projektfragestellungen der Studenten orientieren können. Folgende Zugänge sind derzeit implementiert:
Der Abschnitt Prozess- und Arbeitsplatzanalyse trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die Analyse der Arbeitspraxis von Fachkräften nicht kontextfrei nur auf isolierte Verrichtungen am Arbeitsplatz beziehen sollte. Ohne Berücksichtigung der zentralen Arbeitsaufgaben und deren Einbindung in Geschäfts- und Arbeitsprozesse wird Facharbeit in ihrer Vielseitigkeit nicht angemessen erfasst. Für die Prozess- und Arbeitsplatzanalyse werden exemplarisch Methoden vorgestellt, die helfen, typische Arbeitsaufgaben, Material- und Informationsdiagramme, Organisations- und Qualifikationskonzepte oder auch Darstellungen des Auftragsdurchlaufs zu erarbeiten und dokumentieren.
Mittels Branchenanalysen wird die Entwicklung von Geschäftsfeldern und Beschäftigungsstrukturen sowie der Wandel von Arbeits- und Geschäftsprozessen erhoben. Deren Ergebnisse bilden auch das Gerüst für die Ausgestaltung von Aus- und Weiterbildungsaktivitäten. Branchenanalysen werden häufig von (großen) Unternehmen in Auftrag gegeben, um Erkenntnisse über Entwicklungspotenziale zu erlangen. Innerhalb von Praxisstudien ist eine solche, komplette Branchenanalyse nicht zu leisten. Die Beschäftigung mit existierenden Branchenanalysen oder auch die eigenständige Erarbeitung eines Teilbereichs einer Branchenanalyse kann ein wertvolles Mittel sein, Erkenntnisse über die sich ständig wandelnden Arbeitsabläufe, Organisationsstrukturen und –hierarchien und die dabei verfolgten Interessen der relevanten Akteure zu erlangen.
Der Abschnitt Curriculumentwicklung in Berufsschulen greift eine zentrale Aufgabenstellung auf, die mit den Lernfeldcurricula einhergeht. Hier wird in Methoden eingeführt, die helfen, relevante Arbeitsaufgaben und Kompetenzen zu ermitteln, die als Lern- und Arbeitsaufgaben Eingang in den schulischen Lernprozess finden können oder als Lernarbeitsaufgaben auch Lernort übergreifend konzipiert werden. Damit soll in Praxisstudien erarbeitet und erprobt werden, wie der am Arbeitsprozess orientierte Anspruch von Lernfeldern und Lernsituationen implementiert werden kann. Am Beispiel der in diesem Abschnitt behandelten Methode CURRENT soll ein tiefer gehender Eindruck vermittelt werden.
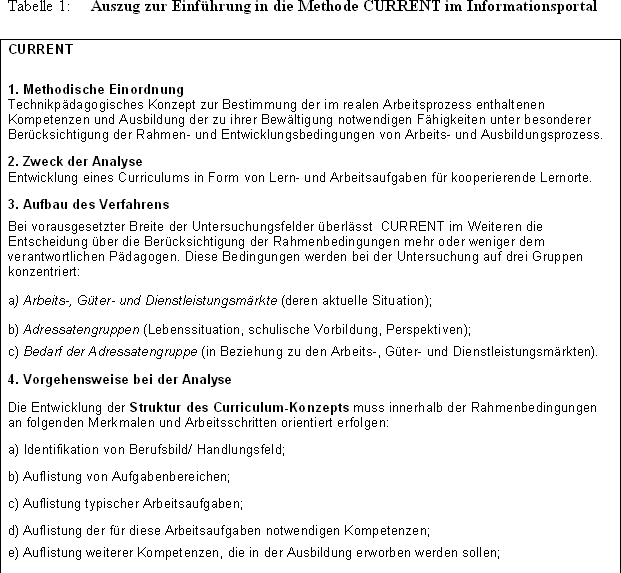

Für die Ermittlung von Qualifizierungsbedarf in Unternehmen geben die vorgenannten Methoden bereits erste Ideen. Im dafür ausdrücklich eingerichteten Abschnitt werden darüber hinaus Ansätze vorgestellt, die sich explizit mit dem frühzeitigen Aufspüren von Qualifikationsdefiziten und dem Bedarf an Fort- und Weiterbildung im Betrieb befassen. Dabei werden auch Methoden zur Früherkennung von Qualifikationserfordernissen und Möglichkeiten im Bereich gering qualifizierter Arbeit einbezogen. Damit sehen wir eine Grundlage gelegt, wenn im Rahmen der Praxisstudie beispielsweise eigene Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen entwickelt werden sollen.
Der abschließende Abschnitt Evaluation von Bildungsmaßnahmen widmet sich Ansätzen der prozess- und ergebnisorientierten Bestandsaufnahme und Bewertung von Innovationen im Bildungsbereich. Dazu erfolgt eine Einführung in Evaluation als zeitlich begrenzte Maßnahme für einen bestimmten Untersuchungsbereich (z.B. betriebliche Ausbildung im Unternehmen, neu geordnete Berufe etc.), mit nicht nur deskriptivem und analytischem, sondern auch wertendem und auf Anwendung zielendem Anspruch. Studierende sollen hier ein Gespür entwickeln, worauf zu achten ist, wenn im Rahmen einer Evaluation Sachverhalte, Personen, Vorgänge oder Institutionen beurteilt werden und aus der Beurteilung Konsequenzen für das Handeln gezogen werden. Dabei ist gerade für den Bildungsbereich von besonderer Bedeutung, dass erfolgreiche Evaluationen eine permanente Verständigung der beteiligten Akteure über Ziel- und Inhaltsfragen erfordert.
Alle fünf Abschnitte umfassen je
• einen einführenden Text,
• exemplarisch vorgestellte und in ihrem Zweck, Aufbau, Anwendungskontext und – soweit verfügbar – auch Anwendungserfahrungen erläuterte Methoden
• vertiefende Literaturangaben und Links
• Checklisten und Formblätter
Die Notwendigkeit, sich neben dem bereits vorgestellten Methodenbereich nun dem Thema der empirischen Werkzeuge als eigenständiger Abteilung im Portal zu widmen, ergibt sich daraus: Die Abteilung Untersuchungsgegenstände und Methoden dient dazu, (betriebliche) Praxis zu objektivieren, um systematische Schlüsse ziehen zu können, wie es oft unter dem Druck des Alltagshandelns nicht möglich ist. Forschendes Lernen hilft damit, einen klaren und zugleich distanzierten Blick auf die Praxis zu gewinnen und damit das Handeln zu erklären. So verhelfen Methoden zu einer zielgenauen Reflexion. Sie nehmen einen Gegenstand, eine bestimmte Fragestellung in den Blick, sie klären, was man sich bei einem Vorhaben vorgenommen hat und wie man generell dabei vorgeht.
Studentische Praxiserschließung ist aber in aller Regel nicht genau deckungsgleich mit diesen Untersuchungsfeldern und Methoden. Es muss daher eine Bewertung und Auswahl getroffen werden, aus welchem Bereich man eine Idee weiter verfolgt, welchen (Teil-)bereich man für das eigene Vorhaben nutzt, etc.
Hier setzt nun die Abteilung der empirischen Werkzeuge an. Diese sind in der individuell gewählten Projektfragestellung je spezifisch eingebettet. Und die eigenen Fragen bedienen sich ggfs. einer Vielzahl von Werkzeugen. Auch ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass eine einmal gewählte ‚Leit'methode im Verlauf nach eigenem Ermessen abgeändert wird.
In das Portal aufgenommen wurden Abschnitte zu Befragung, Beobachtung, Dokumentenanalyse und zum Experiment. Nach einem Einführungstext erfolgt jeweils die weitere Gliederung in
• Gütekriterien
• Vermeidbare Fehler
• Beispiele, Checklisten, Formulare
• Studentische Arbeiten
• Weiterführende Links und Literatur
Mit dieser breit angelegten Palette versprechen wir uns, den Studierenden zu helfen, ein gutes eigenes Forschungsdesign zu entwickeln. Denn grundsätzlich gilt: Umso angepasster und abgestimmter die Konstruktion des Werkzeugs, desto besser können die späteren Daten in ver- und bewertbare Resultate umgesetzt werden.
Neben den drei grundsätzlichen Abteilungen stellt das Portal Navigationshilfen zur orientierenden Einarbeitung in zur Verfügung. Dies sei am Beispiel einer exemplarischen Vorgehensweise für eine analyseorientierte Projektaufgabe dargestellt.
Den Ausgangspunkt für ein eigenes Projektvorhaben bildet beispielsweise eine orientierende Sammlung und Analyse der im Betrieb vorkommenden Tätigkeiten, Leistungen und Prozesse. Für diese Bestandsaufnahme der Arbeitstätigkeiten, auf der u. a. die Entwicklung der Lern- und Arbeitsaufgaben aufsetzt, gibt es verschiedene Vorgehensweisen.
• Erkundung von Facharbeit im Betrieb (vgl. BAG ; Beobachtung )
• Interviews und Befragungen von Meistern und Facharbeitern (vgl. EFAW ; Befragung )
• Betriebsbegehungen (vgl. Beobachtung )
• Studium und Analyse von vorliegenden Unterlagen wie beispielsweise betrieblicher Verfahrensanweisungen, Prozessbeschreibungen, Qualitätsbeschreibung, Qualitätsmanagementverfahren etc. (vgl. Dokumentenanalyse )
Eine Auswahl hierbei auftretender Fragen sind (vgl. auch Checkliste )
• Welche Produkte und Dienstleistungen bietet der Betrieb an? (vgl. Branchenanalyse )
• Wie sieht der Geschäftsprozess aus - von der Akquisition bis zur Auslieferung? (vgl. K3-Methode )
• Welche Aufträge werden im Moment im Betrieb bearbeitet? (vgl. CURRENT-Leitfragen )
• Welche Aufträge werden in näherer Zukunft anstehen?
• Wie sehen aktuelle betriebliche Entwicklungen aus?
Im Bereich der empirischen Werkzeuge finden Sie mehrere Checklisten und Arbeitsformulare, die u. a. die Sammlung und Analyse von Arbeitsaufgaben im betrieblichen Umfeld unterstützen.
Die ersten Studierenden im Praxissemester arbeiten seit Ende 2006 mit dem Portal. Deren Rückmeldungen fließen über Begleitveranstaltungen in den weiteren Entwicklungsprozess ein. Zwecks systematischer Evaluation wurde am Institut für Berufliche Lehrerbildung ein regelmäßiges Seminar „Methoden für betriebliche Praxisstudien“ eingerichtet, das in die Thematik anhand von simulierten Projektfragestellungen einführt und dabei die verschiedenen Abteilungen des Portals nutzt. Die erzielten Ergebnisse werden von den Studierenden teilweise als erster Schritt zur Ausarbeitung einer komplexeren Projektaufgabe im anschließenden Praxissemester genutzt. Eine derzeit laufende schriftliche Erhebung bei allen Absolventen des Praxissemesters soll weiteren Aufschluss über Unterstützungsbedarfe liefern.
Diese ersten Erfahrungen bestätigen insgesamt, dass das Informationsportal „Betriebliche Praxisfelder erschließen“ Neuland im Hinblick auf die Verschränkung wissenschaftlicher und professionsbezogener Kompetenzentwicklung zur Herausbildung eines „forschenden Habitus“ bei den angehenden Berufspädagogen betreten hat. Im speziellen Bereich der Praxisstudien wird das Erleben und Erforschen betrieblicher Praxis intensiv unterstützt. Damit wird es den Studierenden erleichtert, eine handhabbare Balance zwischen empirischer Datenerhebung, analytischer Durchdringung und begründeter Schlussfolgerung zu finden.
Dies sehen wir als eine bleibende herausfordernde Aufgabe der Forschungsorientierung in der Lehrerbildung insgesamt. Das Projektteam hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, das Portal in doppelter Hinsicht weiter zu verbessern.
• Einmal werden durch den Gebrauch permanent neue Bedarfe sichtbar. Sei es, dass unsere Studierenden Themen bearbeiten, für die das Portal noch keine Hinweise zum konzeptionellen und methodischen Vorgehen bereithält; sei es, dass die Studierenden wertvolle Hinwiese zur Stärkung des Werkzeugcharakters des Portals geben. Mit kommenden Erprobungsphasen im Turnus der im Studienverlauf verpflichtenden betrieblichen Praxisstudien versprechen wir uns eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung in Breite und Tiefe des Angebots.
• Bislang konzentriert sich das Portal auf die Belange angehender Berufpädagogen. Auch die Praxisphasen in den allgemein bildenden Lehrämtern öffnen sich zunehmend für den außerschulischen Bereich. Das Portal soll daher auch für diese Anforderungen geöffnet werden. Diese Weiterentwicklung soll in enger Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Berufliche Lehrerbildung IBL der Fachhochschule und der Lehreinheit Erziehungswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität erfolgen.
Die projektierten Entwicklungsaufgaben sollen die Qualität der Lehrerausbildung am Studienstandort erhöhen, die Kooperation zwischen Fachhochschule und Universität Münster vertiefen und damit auch Impulse für den weiteren Reformprozess der Lehrerbildung geben.
Das Infoportal „Betriebliche Praxisfelder erschließen“ findet sich auf den Internetseiten des IBL unter: http://www.fh-muenster.de/ibl/projekte/
informationsportal/Informationsportal_Praxisstudien.php
ADIEK, S./ STUBER, F. (Hrsg.) (2006): Berufsschullehrer praxisnah ausbilden. Kompetenzorientierte Praxisforschung. Schriftenreihe zur Lehrerbildung, Bd. II. Essen.
BOELHAUVE, U./ FRIGGE, R./ HILLIGUS, A./ VON OLBERG, H.-J. (2004): Praxisphasen in der Lehrerausbildun g. Empfehlungen und Materialien für die Umsetzung und Weiterentwicklung. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW. Online: www.bildungsportal.nrw.de/BP/Schulrecht/
Lehrerausbildung/PraxisphasenEmpfehlungen.pdf (20-03-2007).
EULER, D. (2005): Forschendes Lernen. In: WUNDERLICH, W./ SPOUN, S. (Hrsg.): Universität und Persönlichkeitsentwicklung. Frankfurt, New York, 253-272.
OBOLENSKI, A./ MEYER, H. (Hrsg.) (2006): Forschendes Lernen. Theorie und Praxis einer professionellen Lehrerausbildung. 2., aktualisierte Aufl., Oldenburg.
RAUNER, F. (Hrsg.) (2005): Handbuch Berufsbildungsforschung. Bielefeld.
REICHER, H./ STIGLER, H. (Hrsg) (2005): Praxisbuch Empirische Sozialforschung, Innsbruck.