|
| ||

 pdf 245kb | www.bwpat.de
pdf 245kb | www.bwpat.de




In zwei- bis vierjährigen Abständen entsenden die Bewohner einer kleinen Insel im Westen Europas einer ihrer Nationalmannschaften zu einem internationalen Turnier, zuletzt wurde das Dreilöwenteam nach Portugal geschickt. Die öffentliche Meinung im Vereinigten Königreich traute dieser Mannschaft wieder einmal zu, den Pokal gewinnen zu können. Wie so oft seit dem legendären und verdienten Erfolg von 1966 – das Wunder von Wembley – schied die Mannschaft vorzeitig aus. Beckham und der portugiesische Rasen...
Was hat dies mit Standards zu tun? Es ist wie mit PISA: in einem Land, einer Nation, allgemein in einer sozialen Gruppe kann man sich selbst gegenseitig gut bestätigen, dass man vorzüglich arbeitet, erfolgreiche Schulen und ein einmaliges Ausbildungssystem habe. Der direkte Vergleich mit den anderen – egal ob als internationaler Wettbewerb (Fußball) oder als Vergleichsstudie (PISA) angelegt – relativiert die oft selbstbewusste Sicht auf die eigene Leistungsfähigkeit. Englands Fußball und Fußballtradition ist selbstredend meisterhaft, Europameister wurde aber Griechenland; Deutschlands Bildungssystem und -tradition ist immer ein Vorbild gewesen, im direkten Vergleich mit anderen Systemen allerdings zurzeit nur Mittelmaß.
Bleiben wir noch einen Moment beim Fußball und lokalisieren wir, wie der Standard einer Mannschaft festgestellt wird: Es gibt eine externe Bewertung, nämlich das Turnier und eine durch den Erfolg definierte Rangfolge. Nach dem Turnier könnte ein Monitoring einsetzen, um herauszuarbeiten, was schlecht gelaufen ist, warum dies so war und was getan werden müsste, um beim nächsten Mal besser zu werden. Diejenigen, die extern prüfen, sind im Übrigen nicht diejenigen, die im Anschluss eine Verbesserung herbeiführen sollen.
Und nun zur Bildung: PISA war eine internationale Vergleichsstudie. Sie hat eine ähnliche öffentliche Wirkung wie das schlechte Abschneiden einer Mannschaft bei einem internationalen Fußballturnier. Sie relativiert das eigene nationale Selbstverständnis, erschüttert das Selbstbewusstsein und fordert dazu auf, das System zu verbessern. Schwierig dabei ist, dass die Verbesserungsbemühungen in einer Medienöffentlichkeit diskutiert und durch politische Interessen zum Teil überformt werden. Es sind vom Grundsatz her jedoch zwei Dinge prinzipiell auseinander zu halten: ein externer Vergleich und die darauf folgenden internen Verbesserungsmaßnahmen. Man sollte sich davor hüten, beides zusammenzulegen. Der Vergleich – der Wettbewerb – und seine ernüchternde Wirkung sind programmatisch notwendig. Wenn man dieses Element fortnimmt, begründet etwa in der Vorstellung man könne das eigene System von innen viel besser bewerten als von außen, besteht die Gefahr, eines Selbstbetrugs. Man ist dann – um wieder ins Sportliche zurückzukehren – gleichsam in der Situation in der die olympischen Spiele der Antike waren als Nero Olympiasieger wurde, obwohl der doch beim Wagenrennen stürzte. Einige Jahre später wurden die Spiele dann auch aufgrund ihres Status als heidnischer Ritus abgeschafft (vgl. o.V. 2005).
Wir werden auf das Klieme-Gutachten (vgl. Klieme et al. 2003) noch genauer eingehen und dort auch die entsprechenden Referenzen ausweisen. Einleitend möchten wir lediglich die Grundidee der nationalen Bildungsstandards zusammenfassend darstellen, wie wir sie auffassen. Es geht zum einen um den Ausweis unserer Rezipientensicht, zum anderen wollen wir – bevor wir in eine vertiefte Analyse des Gutachtens einsteigen – einige übergreifende Aspekte aufnehmen, die aber zugleich im Kontext des Gutachtens angesiedelt sind.
Bei den ‚nationalen Bildungsstandards' geht es darum, die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems festzustellen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die spezifische Leistung dieses Systems darin besteht, individuelle Kompetenzen zu fördern. Zwar ist das Bildungssystem allgemeinen Bildungszielen verpflichtet, diese sind jedoch zu allgemein und unspezifisch, um konkret und vergleichend gemessen werden zu können (vgl. Klieme et al. 2003, 13). Daher wird es notwendig, fach- resp. domänenbezogene Kompetenzmodelle zu entwickeln ( Klieme et al. 2003, 58 f.). I. S. eines kognitionstheoretischen Ansatzes wird davon ausgegangen, dass Kompetenzen individuelle Dispositionen sind, die Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Lösung von Problemen umfassen. Diese Fähigkeiten zeigen sich in der Leistung, konkrete Aufgaben lösen zu können (Performanz) (vgl. Klieme et al. 2003, 59). Die Kompetenzen sind zudem gestuft, d. h. es gibt eine Stufung von domänenspezifischen Teilkompetenzen (vgl. Klieme et al. 2003, 62). Die Abstufung gibt daneben Hinweise für eine systematische Kompetenzentwicklung und soll so zum kumulativen Lernen beitragen (vgl. Klieme et al. 2003, 16). Damit wird der Anspruch erhoben, dass Kompetenzmodelle „nicht nur Leistungsniveaus im Querschnitt, sondern auch Lernentwicklungen abbilden sollen“ ( Klieme 2004, 628).
Diesen Überlegungen folgend ist es möglich, Kompetenzen bzw. Teilkompetenzen mit Hilfe entsprechender Aufgaben empirisch zu erfassen (vgl. Klieme et al. 2003, 16 f.). Daraus wiederum ergibt sich ein spezielles vierphasiges Arbeitsprogramm, um die Leistungsfähigkeit eines Bildungssystems zu analysieren:
1. Phase: Entwicklung von domänen- resp. fachspezifischen Kompetenzmodellen
2. Phase: Entwicklung von Aufgabensätzen zur Leistungsmessung
3. Phase: Durchführung und Auswertung der Erhebung
4. Phase: Monitoring
Die Aufgabensätze sollen von einer unabhängigen Agentur entwickelt werden. Hierfür wurde bereits das ‚Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen' unter Leitung von Prof. Dr. Olaf Köller an der Humboldt-Universität zu Berlin gegründet. Dieses Institut soll maßgeblich an der Gestaltung von Bildungsstandards beteiligt werden (vgl. IQB o. J.).
Bei der Auswertung der Erhebung werden die Datensätze aggregiert. Auf dieser Grundlage erhält man die Kennziffern, die aus den TIMSS- und PISA-Studien bekannt sind. Sie ermöglichen ein internationales und innerhalb Deutschlands ein föderales Ranking.
Bildungsstandards zielen nicht unmittelbar auf eine diagnostische Betrachtung einzelner Schüler oder auf eine Evaluation einer konkreten Schule. Allerdings bilden sie eine Referenz für die einzelne Schule oder für die einzelne Lehrerin (Wir werden bei Personenbezeichnungen keine Wortschöpfungen wie LehrerInnen o. Ä. einführen. Vielmehr wird aus Gründen des Leseflusses immer nur ein Geschlecht, mal in der weiblichen, mal in der männlichen Form benutzt. Das jeweils andere Geschlecht ist dann vom Leser immer mitzudenken. Die Reihenfolge ist erratisch. B. D. und P. Sl.). So kann man in Schulen bzw. können einzelne Lehrer die jeweiligen Aufgabensätze auch selbst auswerten und dadurch Hinweise gewinnen, wie ihre Schule bzw. ihre Schüler im Vergleich zu den nationalen bzw. länderspezifischen Ergebnissen einzuordnen sind.
Durch Bildungsstandards entsteht eine Momentaufnahme des Systems. Die Idee der vierten Phase, des Monitorings, ist es nun, die Stärken und Schwächen des Systems zu analysieren, den augenblicklichen Zustand zu erklären, um Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten. So können solche Ergebnisse ein Referenzpunkt für schulinterne Evaluationen und Schulentwicklungsprozesse sein, sie sollten dazu motivieren, über Unterricht neu nachzudenken usw. Ob dies gelingen kann, hängt maßgeblich davon ab, wie das Konzept der Bildungsstandards implementiert und dissementiert wird resp. wie es bei der Implementation und Dissemination von den beteiligten Akteuren rezipiert wird.
Wir wollen in den nachfolgenden Ausführungen Dilemmata aufzeigen. Dilemmata sind Problemstellungen, die zu sich widersprechenden Lösungen führen; Dilemmata entstehen, wenn es jeweils gute Gründe für mindestens zwei sich ausschließende Lösungen gibt. Wir sprechen ausdrücklich nicht von Problemen der Bildungsstandards u. Ä. Vielmehr sind wir der Überzeugung, dass es ein konzeptionell sehr interessanter und bedenkenswerter Ansatz ist, der viele konstruktive Möglichkeiten eröffnet. Zugleich sind wir aber auch der Überzeugung, dass in der beruflichen Bildung einige sehr relevante Konzepte entwickelt und erprobt wurden. Die Übertragung und Verbreiterung des Konzepts der ‚nationalen Bildungsstandards' führt dazu, dass die erwähnten Dilemmata auftreten und gewisse konzeptionelle Unterschiede und z. T. Unvereinbarkeiten entstehen, ohne dass nun zugleich gesagt werden könnte, dass das eine oder andere Konzept damit widerlegt sei. Zu einem Dilemma gehört häufig, dass man auf etwas verzichten muss, was einem durchaus auch wichtig und lohnenswert erscheint. Dann gilt es, normativ begründete Entscheidungen zu treffen.
Für uns implizieren Bildungsstandards solche Dilemmata, insbesondere wenn man das Konzept der nationalen Bildungsstandards auf den Bereich der beruflichen Bildung übertragen möchte. Diese Dilemmata werden wir aufzeigen.
Standards sind ein Steuerungsinstrument, welches das Bildungssystem gleichsam vom anzustrebenden Ergebnis her normiert. Damit ist ein genereller Perspektivenwechsel von einer so genannten Input- zu einer Outputsteuerung verbunden (vgl. Klieme et al. 2003, 6). ( Etwas kritischer sieht Herrmann (vgl. 2003, 630) das Verhältnis von Input- und Outcome-Steuerung, werden mit der Normierung von Vorgaben für die Zielerreichung wiederum Inputs in das Bildungssystem eingeführt. ) Auf die Bedeutung eines solchen Wechsels, unter spezieller Betrachtung der beruflichen Bildung, wird nachfolgend eingegangen.
Im Bereich der Steuerung von Bildung hat in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden, der als Wechsel von Input- zu Outputsteuerung bezeichnet werden könnte. ( Andere Autoren sehen eher den Paradigmenwechsel von einer Kontext- hin zu einer Wirkungssteuerung gegeben (vgl. van Ackeren 2003).) Es geht hierbei um die Frage, welche inhaltlichen und/oder strukturellen Vorgaben gemacht werden, um Bildung zu lenken. Mithin geht es um Ordnungspolitik und es erscheint uns durchaus wichtig, diesen Bezugspunkt bei der Diskussion um Standards sehr genau zur Kenntnis zu nehmen, bedeutet dies doch auch, dass es in erster Linie um Steuerungsfragen des Systems und erst darauf aufbauend und weiterführend um didaktisch-organisatorische Fragen der Gestaltung von Schule und Unterricht geht. Gerade die Vermischung der Handlungsebenen: System – Schule – Unterricht ist problematisch.
Hintergründig ist hier auch ein Wechsel von einer erziehungswissenschaftlichen zu einer institutionentheoretischen Sichtweise verbunden (siehe unten). Betrachtet man Unterricht und Schule in einem an Rolf Dubs (vgl. 1998, 34) angelehnten Gedankenspiel als ‚Produktionsprozess', so lassen sich vier Phasen unterschieden: (1) Input, (2) Prozess, (3) Output, (4) Outcome (Die Trennung zwischen den Phasen ist analytisch. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Output und Outcome ist genau zu betrachten. Während Output sich unmittelbar auf die Ergebnisse von Unterricht bezieht, zielt Outcome für uns auf die Anwendung des Gelernten in Anwendungsfeldern ‚außerhalb' der Schule. Diese Vorstellung ist für die berufliche Bildung sicherlich einfacher zu vermitteln als für die allgemeine Bildung. Die Differenzierung wird auch von den Vertretern der allgemeinen Bildung vorgenommen (vgl. Herrmann 2003, 626). Der in der Expertise von Klieme et al. für die nationalen Bildungsstandards formulierte Anspruch (siehe hierzu unten) verweist genau auf die Verwertbarkeit des Gelernten in außerschulischen Praxen (vgl. Klieme et al. 2003, 7; Tenorth 2004, 654). Im Lichte des Anwendungsbezugs verweisen auch die bekannten Aufgaben aus PISA und TIMSS eben auf die allgemeine Anwendung des Wissens in den gesellschaftlichen Lebensräumen. ). Jede dieser Phasen hat konstituierende Merkmale und für jede dieser Phasen lassen sich Vorgaben formulieren:
Phasen |
(1) Input: Vorgaben |
(2) Prozess: Unterricht |
(3)Output: Lernergebnisse |
(4) Outcome: Anwendung des Gelernten |
Merkmale |
• Ressourcen • Rahmenbedingungen • Fächer/Fachpläne usw. |
• Unterrichtsformen • didaktische Konzepte usw. |
• Lernerfolg • Lernziele • Prüfungen usw. |
• berufliche Leistung • Praxiserfolg • Prüfungen usw. |
Vorgaben, z. B. |
fachliche Lehrpläne |
Festschreibung von Methoden |
lernzielorientierte Lehrpläne |
Lernfelder Standards |
(mögliche) Referenzkonzepte |
Curricula i. e. S. |
Qualifikation Kompetenzen |
||
Hintergründe der Referenzkonzepte |
Didaktik |
Arbeitsmarktorientierung Praxisorientierung usw. |
||
Abb. 1: Einordnung verschiedener Steuerungsinstrumente (Vorgaben) von Unterricht
Für jede der vier Phasen lassen sich Vorgaben formulieren. In der Berufs- und Wirtschafspädagogik lassen sich u. E. hier zwei grundlegende Referenzkonzepte unterscheiden: (1) Curricula i. e. S. und (2) Qualifikationen und Kompetenzen.
Ad (1) – Curriculum im engeren Sinn
Wir haben uns hier bewusst für den Begriff des Curriculum i. e. S. entschieden ( … wohl wissend, dass die Begriffe Curriculum, Curriculumtheorie wegen der vielen unterschiedlichen Definitionen, die in der Literatur zu finden sind, eher Verwirrung stiften. ) und definieren ihn in Anlehnung an Hameyer, Frey & Haft (1983, 21, vgl. auch Beauchamp 1968, 77): Demnach umfasst „'Curriculum' [.] im engeren Sinn sprachliche Produkte wie Unterrichtsvorbereitung, Lehrpläne usw., d. h. allgemein alle sprachlichen Kodifizierungen von Handlungen, die auf intendierte Lernprozesse zielen“.
Curricula i. e. S. sind Vorgaben für Unterricht. Sie werden didaktisch umgesetzt, d. h. werden bei der Planung, Durchführung und Kontrolle von Unterricht berücksichtigt. Die Entwicklung und Begründung von Curricula ist ein vorgelagerter Prozess. Dieser Prozess wird von einigen Autoren als ‚Curriculum i. w. S.' (vgl. Hameyer, Frey & Haft 1983, 21) oder als ‚Curriculumprozess' (vgl. Schmiel 1978, Sloane 1992, 139) bezeichnet. Die Entwicklung von Curricula folgt dabei einem didaktischen Programm, d. h. die entwickelten und begründeten Vorgaben sind didaktisch resp. fachdidaktisch begründet. ( Klafki (1976, 78) verwendet daher Curriculumtheorie und Didaktik synonym. Ähnlich strukturieren beispielsweise Schmiel (1978, 26) und Hameyer, Frey & Haft (1983, 17) Curricula nach didaktischen Strukturmerkmalen. )
Ad (2) – Qualifikationen und Kompetenzen
‚Qualifikation' und ‚Kompetenz' verweisen auf das Ergebnis von Bildungsprozessen. Insbesondere der Begriff der ‚Qualifikation' wird dabei vom Verwertungsaspekt her bestimmt. So definiert Baethge (1975, 308) diese als „die Gesamtheit der an ein bestimmtes Individuum gebundenen und auf sein Arbeitsverhalten bezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten […], die es dem einzelnen ermöglichen, innerhalb eines gegebenen Arbeitsprozesses bestimmte Funktionen zu erfüllen“. In der berufspädagogischen und arbeitspsychologischen Literatur wird dabei zwischen situationsvarianten und
-invarianten Qualifikationen unterschieden. Während situationsvariante Qualifikationen auf konkrete Arbeitsprozesse bezogen sind, werden situationsinvariante Qualifikationen im Konzept der ‚Schlüsselqualifikationen' (vgl. u. a. Mertens 1974) diskutiert.
Qualifikation und Kompetenz werden zum Teil überschneidend, synonym und abgrenzend verwandt. Sloane, Twardy & Buschfeld (2004, u. a. 207ff., insb. 208) legen Qualifikation bewusst eng und funktionalistisch als gefordertes Arbeitsverhalten aus. Demgegenüber beschreiben Kompetenzen die für die Bewältigung von spezifischen Aufgaben notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Subjekts. Diesem Begriffsverständnis folgend werden wir nur noch von Kompetenzen sprechen.
Im Rahmen beruflicher Bildung werden in Ausbildungsordnungen angestrebte Fertigkeiten und Kenntnisse (Outcome), konkret im Berufsbild, kodifiziert. Die Normierung der Bildungsarbeit geschieht über die Festlegung zu vermittelnder Kompetenzen. Ähnlich wird in den lernfeldstrukturierten Curricula für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule eine Orientierung an einem solchen Outcome vorgenommen. Hier wird explizit von Kompetenzorientierung im Sinne des Leitziels der Handlungskompetenz gesprochen (vgl. KMK 2000, 9).
Daher soll der Kompetenzbegriff kurz betrachtet werden: Er geht im deutschsprachigen Kontext auf Heinrich Roth (1971) zurück und wurde in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik insbesondere von Lothar Reetz (1984) rezipiert. Roth (vgl. 1971, 180) unterscheidet Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz. (Die KMK (vgl. KMK 2000) oder auch weitere Autoren (vgl. z. B. Achtenhagen 2004, 21f.) gliedern die methodische Kompetenz von der Fachkompetenz als eigenständige Dimension aus. ) Die Dispositionen von Subjekten werden in verschiedenen Perspektiven betrachtet:
• Gegenstandsbezogene Fähigkeiten wie Berufs- resp. Fachwissen und prozessbezogene Fähigkeiten wie Heuristiken und Methoden (Sachkompetenz),
• Selbstbezogene Fähigkeiten wie Motivation, Interessen, Metakognition etc. (Selbstkompetenz),
• Sozialbezogene Fähigkeiten wie Kommunikationsvermögen, Fähigkeit zur Arbeit in Gruppen usw. (Sozialkompetenz),
Kompetenzen generieren Handeln, d. h. auch: Kompetenzen können nur über konkrete Handlungen erfasst werden (Performanzbedingung). Hiermit hängt zugleich ein strukturalistisches Verständnis von Kompetenz und Performanz zusammen (vgl. z. B. Erpenbeck / Rosenstiel 2003), welches insbesondere von Chomsky (1957, 1965, 1969) als generatives Verhältnis ausgedeutet wurde.
Kompetenz in diesem strukturalistischen Verständnis muss daher als generatives Modell begriffen werden. Kompetenzen sind individuelle Fähigkeiten, die konkretes Handeln ermöglichen und empirisch aus der Beobachtung der jeweiligen Handlung und an der damit verbundenen Leistung gemessen werden können. Frank Achtenhagen (2004, 21f.) weist in Anlehnung an Boekaerts (2002) darauf hin, dass die jeweiligen Teilkompetenzen sich in konkreten Anwendungssituationen (Kontext) selbstregulativ organisieren und dass auf diese Weise konkrete Handlungen realisiert werden.
Im Lernfeldkonzept der KMK werden zwei Kompetenzbegriffe verwandt:
• Es gibt zum einen so genannte kompetenzbasierte Zielformulierungen. Hierbei handelt es sich um Beschreibungen von konkreten Handlungen, die vollzogen werden sollen. In den Lernfeldcurricula sind sie den jeweiligen Lernfeldern zugeordnet.
• Zum anderen wird in den jeweiligen Vorbemerkungen zu den Lehrplänen die berufliche Handlungskompetenz als Leitziel ausgewiesen, die sich als Fach-, Human- und Sozialkompetenz entfalten soll (vgl. Bader 2000; Bader / Müller 2002).
Wir haben den Eindruck, dass hier gleichsam als Folgeerscheinung europäischer Diskussionen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine angelsächsische Terminologie adaptiert wird. Gerade unter dem Stichwort ‚europäischer Bildungsraum' erfolgt eine Ausrichtung auf arbeitsplatznahe und arbeitsprozessbezogene Fähigkeiten. Solche – in der deutschen Tradition würde man sagen – Qualifikationen werden im angelsächsischen Kontext als skills oder competencies bezeichnet. Sie stellen Beschreibungen von Fähigkeiten dar. Demgegenüber entspricht das Konzept der Handlungskompetenz dem angelsächsischen Konzept der competence . Diese wäre ganzheitlich und generisch zu interpretieren, und zwar i. S. einer grundlegenden Disposition, die es dem Einzelnen ermöglicht, in Situationen sachgerecht und ethisch richtig (= adäquat) zu handeln. Man kann ein solches Modell durchaus auch in der deutschen Tradition eines ganzheitlichen Konzepts von Kompetenz deuten (vgl. Ertl / Sloane o. J.).
Michael Eraut (1994, 174) schreibt aus angelsächsischer Sicht zu diesen beiden Kompetenzbegriffen in der amerikanischen Diskussion:
„... we should note a useful distinction in the American literature between the term ‚competence', which is given a generic and holistic meaning refers to a person's capacity, and the term ‚competency', which refers to specific capabilities.“
Kompetenzen beschreiben Fähigkeiten eines Menschen jeweils im Anwendungskontext des Gelernten. Insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung verweist dies auf berufliche Praxis als Ort der Anwendung. Dort aktualisiertes Handeln und erbrachte Leistung lässt einen Rückschluss auf den ‚Zustand' zu.
Zwischenergebnis (1):
Der allgemein verfolgte Perspektivenwechsel von Input- zu Outputsteuerung bedeutet u. E., dass eine prinzipiell andere Art von ‚Vorgabe' für Schule und Unterricht entsteht, insbesondere dann, wenn durch die Einführung von Standards die Rolle der traditionell inputorientierten Lehrpläne in den Hintergrund tritt.
Curricula als Normierungen des Unterrichtsgeschehens sind didaktisch aufbereitet. Bei ihrer Entwicklung müssten lerntheoretische und instruktionslogische Überlegungen berücksichtigt werden. ( Dies ist in dieser Form eine sehr allgemeine und eher prinzipielle Aussage. Selbstverständlich müsste man empirisch überprüfen, ob dieser Anspruch tatsächlich eingelöst wird und wurde. Jedoch lässt sich u. E. der konzeptionelle Anspruch, dass es so sein soll, aus den curriculumtheoretischen Überlegungen, z. B. der 1970er Jahre heraus genauso belegen wie aus der älteren Tradition der Lehrpläne. Vgl. hierzu u. a. Schmiel (1978), der die normierenden Prinzipien der Lehrplankonstruktion herausarbeitet, die jeweils auf spezifische didaktische Ideen der Vermittlung von Inhalten bzw. Ziel-Inhalts-Komplexen basieren. ) Mit anderen Worten: In Curricula sollte eine didaktische Idee der Vermittlung inkorporiert sein. Demgegenüber beschreiben Kompetenzen die im Anwendungskontext des Gelernten als relevant erachteten Fähigkeiten. Ein Kompetenzmodell oder eine Kompetenzauflistung sagt in erster Linie etwas darüber aus, was im Praxis- bzw. Anwendungsfeld ‚gekonnt' werden soll. Offen bleibt, wie man diese Kompetenz erwirbt und was getan werden muss, um diese Kompetenz zu fördern. Solche didaktischen und organisatorischen Fragen werden in Schulen und Unterricht ausgelagert und müssen dort von den Lehrerinnen interpretiert und konzeptionell bearbeitet werden.
Allerdings muss relativierend angemerkt werden, dass im Konzept der nationalen Bildungsstandards nicht behauptet wird, dass damit eine Regulierung für Unterricht erfolgen solle, im Gegenteil, dies wird eigentlich durchgängig verneint. Problematisch ist, dass bei der Rezeption und Implementation durchaus der Weg bestritten wird, Curricula zu Gunsten von Bildungsstandards abzuschaffen, wie dies auch insbesondere im anglo-amerikanischen Kontext geschehen ist (vgl. Arbeitsgruppe intern. Vergleichsstudie 2003, 174 ff.) Eigentlich würde sich eine Verbindung von Input- und Outputsteuerung anbieten. In der Terminologie von Klieme et al. (2003, 76 ff.) ginge es um die Verbindung von Bildungsstandards mit einem nationalen Kerncurriculum.
Standards als Steuerungsgröße blenden die bisher für die deutsche Steuerung konstituierende Lernerperspektive aus der Steuerung des Bildungssystems aus. Die Frage des Kompetenzerwerbs wird von der Konstruktionsebene der Lehrpläne in die Schulen verlagert. Standards und andere outcomeorientiere Vorgaben für Schule und Unterricht benötigen keine Hinweise auf den Erwerb von Kompetenz. Sie fixieren angestrebte Kompetenzen. Die Frage, wie diese Kompetenzen erworben werden und ob es einen didaktischen Zusammenhang zwischen geforderten Kompetenzen gibt, muss vor Ort entschieden werden. Mit diesem Wechsel ist nicht nur eine Veränderung in den ‚Vorgaben' verbunden. Es liegt auch eine andere Art von Regulationstheorie vor.
Systeme werden gemäß der Institutionentheorie über „Normen“ reguliert; diese sind bewusst geschaffene und/oder spontane Regulative des Handelns (vgl. North 1990, 4; Sloane , Twardy & Buschfeld 2004, 307). Es handelt sich nach North um „Institutionen“. Diese stellen die Spielregeln einer Gesellschaft dar: Durch solche Regeln wird ein äußerer Handlungsrahmen für handelnde Subjekte definiert (vgl. North 1990, 3).
Für Picot, Dietl & Frank (1999, 11) sind Institutionen „sanktionierbare Erwartungen, die sich auf Verhaltensweisen eines oder mehrer Individuen beziehen […]. Sie dienen jedem einzelnen als Wegweiser bei der Aufstellung und Realisierung seiner Handlungspläne. Institutionen informieren über die eigenen Handlungsmöglichkeiten und -grenzen ebenso wie über die an andere zu stellenden Erwartungen“. Neben einer Erwartungsbildung haben sie schließlich einen konfliktmindernden Charakter. Sie bieten Ansatzpunkte für die Überwachung eines Systems und zielen insgesamt – ökonomisch betrachtet – auf eine Senkung von Organisations- und Koordinationskosten (vgl. Picot 1991, 144).
Bezogen auf (Berufs-)Bildung und Schule bedeutet eine solche Betrachtung, dass Institutionen gesellschaftlich gewollte Strukturvorgaben sind, die i. S. von Giddens (1988, 77) doppelt wirken: Einerseits werden Wahlmöglichkeiten festgelegt, andererseits werden Beschränkungen definiert. Der Hinweis auf ‚gesellschaftlich gewollt' impliziert dabei den Legitimationsaspekt.
Folgt man dem institutionentheoretischen Ansatz der Steuerung, so sind Institutionen als Vorgaben ausreichend für die Regulierung von Bildung. Der Grundgedanke wäre, dass über die Bildungsstandards die Erwartungen der Gesellschaft an Schule und Unterricht kommuniziert werden. Mit dieser Erwartung werden auch der Freiraum und die Begrenzung der pädagogischen Arbeit vermittelt. Diese Idee der Deregulierung würde alle weiteren Entscheidungen: Wahl der Lehrer, Wahl der Schulorganisation, Verwendung von Ressourcen usw. prinzipiell an die Schule verlagern.
In der erziehungswissenschaftlichen Theoriegeschichte ist eine solche Frage der Regulierung von Handeln sehr nachhaltig durch die Frage der Legitimation von Bildungszielen resp.
-normen geprägt. Diese Theorietradition auch nur ansatzweise adäquat darzustellen und mit entsprechenden Referenzen zu belegen, würde bei weitem dem Rahmen dieses Beitrags sprengen. Die erziehungswissenschaftliche Theorietradition greift diese Normenfrage (1) objekttheoretisch als Frage der Legitimation, Begründung und Ableitung von Erziehungszielen und (2) metatheoretisch als Frage der richtigen Argumentation bei der Legitimation, Begründung und Ableitung von Normen auf, wobei sich ‚Denkschulen' allein schon über die unterschiedlichen paradigmatischen Setzungen ergeben.
Der Grundfigur nach ist die erziehungswissenschaftliche Denkfigur dabei immer auf das Verhältnis von Educandus und Educator bezogen. Dies wird in didaktischen und schulpädagogischen Konzeptionen konkretisiert als Lehrer-Lerner-Beziehung und um die Frage der Schule als Vermittlungsort erweitert. Genau genommen ist jedoch mit der Ausrichtung auf Standards zugleich ein außer-erziehungswissenschaftlicher Fokus definiert. Der Erziehungsanspruch von Bildungseinrichtungen wird gleichsam durch eine Domäne finalisiert. Ohne hier den Domänenbegriff näher zu explizieren, wir werden ihn weiter unten aufgreifen, kann doch festgestellt werden, dass somit durch Standards eine Aufwertung der Fachdidaktik stattfindet. Der zu leistende Anspruch des Bildungssystems wäre daher nicht aus einem erziehungswissenschaftlichen, sondern viel stärker aus einer fachdidaktischen Konzeption heraus zu bestimmen.
Dies wird umso deutlicher, wenn man sich das Arbeitsprogramm vergegenwärtigt: Demnach sind Bildungsziele in Kompetenzmodelle zu übertragen. Sind solche Modelle einmal formuliert, werden Aufgaben entwickelt. Diese sollen i. S. der Outcomeorientierung anwendungsbezogen sein. Dies bedeutet zugleich, dass Fragen der Bildungsziele abgekoppelt werden von der Erstellung von Aufgabensätzen zur Leistungsmessung. Sie stehen allenfalls über die Kompetenzmodelle in einem formalen Zusammenhang zueinander. Relevante Situationsbezüge, die normativ nur über ein Bildungsziel begründet werden könnten, werden nunmehr über die Aufgabenentwicklung, gleichsam ohne curriculare Begründung, in Schule und Unterricht befördert. Entsprechend der erziehungswissenschaftlichen Tradition läge hier zumindest ein Legitimationsproblem vor.
Zwischenergebnis (2):
Eine institutionentheoretisch begründete Steuerung von Bildungssystemen reguliert die individuellen Handlungsstrategien von Akteuren der Praxis durch die Vorgabe von Regulativen. Diese normieren den Handlungsraum der Lehrer und führen zur Verlagerung aller Detailentscheidungen vor Ort. Würden Bildungsstandards zum alleinigen Regulierungsinstrument bzw. würden sie ausschließlich, etwa i. S. eines heimlichen Curriculums, die pädagogische Arbeit steuern, so würden hieraus folgende Konsequenzen entstehen:
• Zum einen würden die erziehungswissenschaftlichen Argumentationsmuster der Begründung von Normen aus der pädagogischen Praxis weitgehend verschwinden. Zugleich würde der fachdidaktische Zugang wichtiger werden, da eine Finalisierung über den Domänenbezug gefordert wird.
• Zum anderen würden die realen Aufgaben die pädagogische Arbeit praktisch regulieren, die Aufgabenentwicklung würde zu einem zentralen Instrument der Steuerung von Unterrichtsalltag. Aufgabensätze würden als heimliche Curricula fungieren. Die erziehungswissenschaftlichen Ansprüche einer Normenlegitimation würden dagegen ausgeblendet werden.
Die bisherigen Diskussionen und vorliegenden Entwürfe für die Bildungsstandards beziehen sich dabei auf den allgemein bildenden Teil des schulischen Systems. ( Vgl. hierzu die Expertise „Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards“, die durch die Autorengruppe um Klieme erstellt und vom BMBF in Abstimmung mit der KMK vorgestellt wurde (vgl. Klieme et al. 2003). Die Beschränkung erfolgt einerseits über die Wahl der beispielhaft formulierten Standards aber auch durch die postulierte Abgrenzung zu Konzepten der Berufs- und Wirtschaftspädagogik z. B. in der Auffassung des Kompetenzbegriffs (vgl. ebd., 15). ) Verbände wie auch Behörden fordern die Ausdehnung dieses Steuerungsmechanismus auch auf den Teil der beruflichen Schulen. Zum einen soll eine Abkopplung eines Teilsystems verhindert werden und zum anderen wird auch im Feld der beruflichen Bildung Handlungsdruck eingeräumt (vgl. z. B. Weichhold 2003, o. S.). (So weist Weichhold darauf hin, dass die „Diskussion um nationale Bildungsstandards auch für die Teilzeitberufsschule geführt werden muss“ ( Weichhold 2003, o. S.). Die bisherigen Vorgaben würden nicht ausreichen, um die Prüfungsinhalte für eine externe Abschlussprüfung zu formulieren (vgl. ebd.). ) So gehen die Überlegungen zur Reform des Berufsbildungsgesetzes auch dahin, dass für den Bereich der Berufsbildung die Diskussion um Kompetenzstandards geführt werden muss. Konkretisiert wird diese Überlegung in der Forderung der Bundesregierung nach: „Länderübergreifende[r] Definition von Kompetenzstandards im Bereich der berufsbildenden Schulen“ (BMBF 2004, 14). Parallel dazu ist im Kontext der Schulentwicklung und des Qualitätsmanagements an Schulen ebenfalls die Standardfrage eingebunden. „Fraglos sind Standards für die Qualitätssicherung vonnöten“ ( Rolff 2003, o. S.).
Insbesondere bei den Bildungsgängen, die nach der Rahmenvereinbarung der KMK (vgl. 2003) über die Berufsfachschulen geregelt werden und die sowohl Anteile beruflicher als auch allgemeiner Bildung vermitteln, tritt die Frage auf, wie die Bildungsstandards im Spannungsfeld zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung stehen. Konkret wird dort eingefordert: „ Das Anspruchsniveau für Deutsch, Fremdsprache, Mathematik richtet sich nach den von der Kultusministerkonferenz vereinbarten Standards zum Mittleren Schulabschluss (Beschluss der KMK vom 12.05.1995) unter Berücksichtigung des Berufsbezuges der jeweiligen Fachrichtung“ (KMK 2003a, 5). Damit wird einerseits deutlich, dass die Bildungsstandards der allgemein bildenden Fächer in den beruflichen Kontext einerseits übertragen und dort ggf. modifiziert werden (müssen).
Befürchtungen treten dann auf, wenn diese Formulierung des Anspruchsniveaus auf die Gleichartigkeit von Bildungsabschlüssen abzielt und die postulierte Gleichwertigkeit nicht ausreicht. Der Anspruch des gleichwertigen Bildungsabschlusses würde es zulassen, dass auch ein anderer Weg bei beruflichen Bildungsstandards beschritten würde. Der der Gleichartigkeit fordert zu einer Übertragung zumindest der Grundstruktur der Bildungsstandards in die berufliche Bildung auf.
Es sollen folgende ausgewählte Aspekte herausgearbeitet werden, die bei einer Übertragung des Konzepts der ‚nationalen Bildungsstandards' auf den Kontext der beruflichen Bildung u. E. diskussionsbedürftig sind bzw. Dilemma-Situationen hervorrufen: die unterschiedlichen Kompetenzkonzepte (3.1), die Domänenstruktur (3.2), die Skalierung (3.3), das empirische Konzept (3.4), der Situationsbezug resp. die Aufgabenstruktur (3.5).
Es wird zwischen Bildungszielen und Kompetenzen unterschieden. Während Bildungsziele als allgemeine normative Richtlinien verstanden werden, sollen Kompetenzen Konkretisierungen eben dieser Bildungsziele sein, die eine empirische Überprüfung möglich machen.
Kompetenzen sind Dispositionen. Sie beschreiben „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ ( Weinert 2001, 27f.).

Abb. 2: Kompetenz als Disposition und Aufgabenbearbeitung als Performanz
Bei diesem kognitionstheoretischen Ansatz, den Klieme et al. (vgl. 2003) vertreten, wird – vereinfacht ausgedrückt – Wissen als ‚im Kopf' vorhandene Fakten und Regeln angesehen. Weinert (2001, 27f.) spricht von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er als kognitive oder mentale Struktur auffasst, wobei volitionale und motivationale Aspekte berücksichtigt werden, also keine Reduktion auf eine ‚naive' Kognition vorgenommen wird. Diese Disposition ist gleichsam die Ursache für ‚richtiges' Handeln. Dies ist insofern wichtig als von der Kompetenz ausgehend Aufgaben entwickelt werden können, um diese empirisch zu verifizieren bzw. zu falsifizieren.
Im kognitionstheoretischen Ansatz findet sich ein generatives Verhältnis zwischen Kompetenz und Aufgabenbearbeitung (Performanz). Dispositionen zeigen sich in der Aufgabenbearbeitung; umgekehrt kann von der Aufgabenbearbeitung – der so genannten performativen Ebene – auf die Kompetenz zurück geschlossen werden (siehe Abbildung 2).
Zugleich wird die Annahme gemacht, dass in den Kompetenzmodellen unterschiedliche Niveaustufungen möglich sind. Dabei wird bei Klieme et al. (2003, 64) die Möglichkeit unterstellt, dass sich durch diese Stufung zugleich der Kompetenzerwerb abbilden ließe. Niveaustufen sind dabei i. S. eines Inklusionsprinzips aufgebaut. Höhere Stufen umschließen niedrigere Stufen. Das Vorhandensein einer Stufe gibt Auskunft darüber, dass die nächste Stufe erreicht werden könnte.
Relativierend weist Abs (2005) darauf hin, dass diese Stufung nicht wirklich entwicklungslogisch gedeutet werden kann. Vielmehr würde es sich um eine Zustandsbeschreibung handeln, man könne genau nicht festlegen, wie der Übergang von einer Stufe zur anderen erfolge. Mit anderen Worten: Bildungsstandards geben – gleichwohl das Prinzip der Kumulativität und Skalierung behauptet wird – keine Auskunft über den Kompetenzerwerb (ähnlich auch Tramm 2005).
Klieme et al. (2003) grenzen sich vom Kompetenzbegriff der Berufsbildung ab und führen aus: „Der hier [im Gutachten, B. D./P. Sl.] verwendete Begriff von ‚Kompetenzen ist […] ausdrücklich abzugrenzen von den aus der Berufspädagogik stammenden und in der Öffentlichkeit viel gebrauchten Konzepten der Sach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz“ ( Klieme et al. 2003, 15). Tenorth begründet dies in einem Gespräch beim Unterausschuss berufliche Bildung der KMK (vgl. UABB 2004) mit der fehlenden Bindung dieses Konzepts an eine Domäne. Dies ist sicherlich eine verkürzte Rezeption der berufs- und wirtschaftspädagogischen Literatur.
Im Rahmen der beruflichen Bildung hat sich ein handlungstheoretisches Kompetenzverständnis entwickelt, wobei in den älteren Beiträgen zwischen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz unterschieden wurde (vgl. Halfpap 1991). Dabei wurde vielfach eine Segmentierung der Teilkompetenzen vorgenommen und die Denkfigur aufgebaut, es werde in einer modernen Gesellschaft wichtig, verstärkt Methoden- und Sozialkompetenzen aufzubauen, während Fachkompetenzen zu vernachlässigen seien. In Bezug hierauf trifft insbesondere die Kritik von Tenorth (UABB 2004) zu. Allerdings wurde in der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung bereits vor Jahrzehnten der notwendige Gegenstandsbezug der Methodenkompetenz herausgearbeitet (vgl. Sloane 1996, 43f.). Die Göttinger Arbeiten zur Didaktik des Rechnungswesens schließlich zeigen explizit die notwendige methodische Erschließung betriebswirtschaftlicher Themen mit Hilfe von wirtschaftsinstrumentellen Verfahren (vgl. u. a. Preiß / Tramm 1990 sowie aktuell Achtenhagen 2004, 23).
Im Kontext der Diskussion von Lernfeldern wird eine Differenzierung in Fach-, Human- und Sozialkompetenz vorgenommen (vgl. u. a. KMK 2000, Bader 2000, Bader & Müller 2002). Hiermit werden drei Perspektiven für die Kompetenz aufgezeigt: die Domäne resp. das Fach, die Persönlichkeit und die soziale Gruppe. Methoden-, Lern- und kommunikative Kompetenzen stellen dabei ‚Querkompetenzen' dar, die sich in diesen Perspektiven entfalten. Hiermit wird im Übrigen die in der ‚alten Trias' von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz suggerierte Abgrenzbarkeit, insbesondere von Methoden- und Fachkompetenz, aufgelöst.
Diese Teilkompetenzen lassen sich als integrale Bestandteile eines Gesamtmodells beruflicher Handlungskompetenz interpretieren. Dabei wird von einem kategorialen Kompetenzmodell ausgegangen:

Abb. 3: Kategoriales Kompetenzgefüge (entnommen aus Sloane 2004a)
Mit Hilfe eines solchen Modells lassen sich Kompetenzen konkretisieren bzw. systematisieren. Das in Abbildung 3 dargestellte kategoriale Kompetenzgefüge verbindet dabei – in bildungstheoretischer Tradition die materielle mit der formalen Seite der Bildung. Anders als bei dem von Klieme et al. (2003) präferierten kognitionstheoretischen Ansatz, bei dem aus Dispositionen heraus Aufgabenstellungen generiert werden müssen, um die jeweilige Disposition zu überprüfen (falsifizieren), wird hier eine Systematisierung und Klassifizierung von realen Handlungen vorgenommen und so eine Domäne etabliert. Bei einer solchen handlungstheoretischen Konzeption wird davon ausgegangen, dass komplexe Handlungen sich in strukturell gleiche Teilhandlungen ausdifferenzieren lassen.
Dazu kann das kategoriale Kompetenzschema auf die Zielbeschreibungen eines Lernfeldes projiziert werden, d. h. auf eine konkrete Tätigkeitsbeschreibung hin werden die Teildimensionen der beruflichen Handlungskompetenz konkretisiert. ( Ein Beispiel hierzu ist bei Dilger (2004, 31f.) abgedruckt. Darin wird für ein Lernfeld aus dem Ausbildungsberuf Automobilkaufmann / -kauffrau das kategoriale Kompetenzraster mit Konkretisierungen in den Teildimensionen dargestellt. ) Ein kategoriales Kompetenzraster ist dabei nicht als additives Modell zu betrachten, in dem die einzelnen Teildimensionen in der Summe die Handlungskompetenz bezogen auf eine konkrete Tätigkeit darstellen. Ein solches Kompetenzgefüge erlaubt über die unterschiedlichen Knotenpunkte Schwerpunkte auszubilden. Auf der Basis einer solchen, auf eine Tätigkeit hin bezogenen Konkretisierung der beruflichen Handlungskompetenz, können Aufgaben konzipiert werden, die es ermöglichen, dass diese Teildimensionen zur Anwendung gelangen können. Für den Lernenden bedeutet dies, dass er mit einem Problem konfrontiert wird und er in dieser Problem- bzw. Aufgabenstellung die Handlungsnotwendigkeit, die Handlungsplanung, die notwendigen Informationen, den Handlungsvollzug und die Kontrolle auf der Basis seiner Kompetenzen herausfinden und umsetzen muss. Die Problem- bzw. Aufgabenstellung stellt die Anforderungen dar, die mit Hilfe der vorhandenen Kompetenzen bewältigt werden sollen. Dabei kann nicht von einem linearen Zusammenhang zwischen der Aufgabenstellung und bestimmten Kompetenzprofilen ausgegangen werden.
Zwischenergebnis (3):
Kompetenzen werden im Rahmen der nationalen Bildungsstandards kognitionstheoretisch gedeutet. In Anlehnung an Weinert (2001) geht es um die Kompetenzen als Dispositionen, die umfassende Problemlösungsprozesse beschreiben. Dieser Ansatz geht von einem generativen Verhältnis von Kompetenz und Performanz aus. Kompetenzen werden in gestuften Modellen strukturiert und für jede Stufe lassen sich Aufgabenstellungen entwickeln, um das Vorliegen der Stufe über eine erfolgreiche Handlung (Leistung) zu verifizieren.
Mit dem Nachweis der Kompetenzen wird ein Leistungsstand i. S. des erreichten Outcome auf einer Skala zurückgemeldet. Diese Information sagt, wo sich Lernende in einem skalierten Kompetenzmodell ‚befinden' und geben so eine Zustandsbeschreibung einer Lernleistung wieder; sie sagen nichts darüber aus, wie die jeweilige Kompetenzstufe erreicht wurde und wie der Übergang von einer Kompetenzstufe zur nächsten erfolgt.
Kompetenzen im Rahmen der beruflichen Bildung werden vielfach handlungstheoretisch interpretiert. Sie zeigen sich z. B. als Kompetenzmodelle, um konkrete Tätigkeiten zu systematisieren und zu klassifizieren. Konkret bedeutet dies, dass Aufgaben direkt aus einer beruflichen Domäne gewonnen werden und für die Aufgaben konkretisierende Kompetenzgefüge erstellt werden. Damit erfolgt keine Ableitung der Aufgaben aus den Kompetenzmodellen wie in der Expertise von Klieme et al. (2003) vorgesehen. Hiermit hängt auch eine andere Betrachtung von Domäne zusammen (vgl. 3.2).
Bildungsstandards werden fachbezogen interpretiert. Offen ist hierbei allerdings, welches Fachverständnis den Überlegungen zugrunde gelegt wird. Klieme et al. (2003, 18 f.) setzen Fach, Domäne und Lerngebiet gleich. Sie führen aus: „Unterrichtsfächer korrespondieren mit wissenschaftlichen Disziplinen, die bestimmte Weltsichten (eine historische, literarisch-kulturelle, naturwissenschaftliche usw.) ausarbeiten und dabei bestimmte ‚Codes' einführen (z.B. mathematische Modelle, hermeneutische Textinterpretationen)“ ( Klieme et al. 2003, 18). Tenorth (vgl. UABB 2004, 3) unterscheidet dabei die ‚traditionellen' Profile: sprachlich-literaturwissenschaftlich, mathematisch-naturwissenschaftlich, historisch-sozial und ästhetisch-expressiv.
Dies mag für traditionell gymnasiale Profile eine adäquate Interpretation zu sein. U. E. gibt es gerade im Hinblick auf die Übertragung in den Bereich der beruflichen Bildung drei Schwierigkeiten:
Erstens besteht ein ganz altes Problem in der Berufsbildung darin, eine Passung zwischen diesen Fachprofilen und den berufsbezogenen Fächern zu finden. Zweitens sehen wir das Problem der eindeutigen Zuordnung von Fächern und weitergehend von Lernfeldern zu solchen Profilen. So führt allein schon die Frage, ob ein betriebswirtschaftliches Teilgebiet wie ‚Marketing' mathematisch oder sprachlich profiliert werden müsse, zu ganz unterschiedlichen Interpretationen des Faches. So ist Tenorths Interpretation dann doch wohl wieder ein allgemein bildendes Artefakt, welches sich den praktischen Fragen von beruflicher Bildung durch einfache ‚Nicht-Passung' entzieht. Hiermit hängt dann drittens noch das Problem der Abstimmung zwischen diesen Profilen und der gleichzeitig geforderten Outcome-Orientierung zusammen, welches dann auch und insbesondere für die Allgemeinbildung gilt. So bleibt offen, ob nicht genau der Anwendungsbezug fachübergreifende resp. fächerverbindende Ausdeutungen erforderlich macht (vgl. Klieme et al. 2003, 20).
 Abb. 4: Bildungsstandards für das Fach Mathematik
Abb. 4: Bildungsstandards für das Fach Mathematik
In der Klieme-Expertise ( Klieme et al. 2003, 62) fordert man einen Domänenbezug, der sich in der Entwicklung domänenspezifischer Kompetenzmodelle niederschlägt. Dafür ist es erforderlich, (1) fachliche Kompetenzen zu formulieren, die zum einen in Verbindung gebracht werden mit (2) den Leitideen des Faches und die zum anderen zugleich in (3) verschiedenen Niveaus ausdifferenziert werden. Das Beispiel des Faches ‚Mathematik' macht deutlich, wie Standards entwickelt werden sollen (vgl. KMK 2003b):
Die Frage, die sich stellt, ist, wie Domänen bestimmt werden. Es geht konkret um die Bestimmung eines Gegenstandsbereichs. Dieser liegt nicht a priori vor, sondern muss definiert werden. So haben wohl gerade Beispiele aus der Mathematik deshalb eine hohe Überzeugungskraft, da die Domäne – zumindest für Außenstehende – sehr überzeugend definiert ist. Es geht hier nicht um eine wissenschaftspropädeutische Ausdeutung von Fächern bzw. um die Rekonstruktion universitärer Fächer. Eigentlich ist es die alte curriculare und fachdidaktische Frage nach dem Aufbau (nach der inneren konsistenten und möglichst eindeutigen Struktur eines Lernbereichs). Standards suggerieren das Vorliegen eindeutiger fachlicher bzw. domänenspezifischer Strukturen und blenden ein Stück weit aus, dass diese Strukturen vorausgehend festgelegt wurden oder festzulegen sind. ( Tenorth (2004) diskutiert dies unter ‚Kanonisierung', welche durch gesellschaftliche und politische Macht strukturiert sei und nach dem Prinzip der Inklusion und Exklusion funktioniert. „Die Konsequenz ist unvermeidlich Selektivität – des Curriculums in seiner Struktur und der Bildungsarbeit in ihren Wirkungen“ ( Tenorth 2004, 654). Im Gespräch im Unterausschuss für berufliche Bildung legt er wie auch die Autoren der Klieme-Expertise die Domänen auf die ‚traditionellen' Profile wie historische, literarisch-kulturelle, naturwissenschaftliche usw. fest, mit dem Hinweis, dass ansonsten die Anschlussfähigkeit an die Diskurse anderer Lebensbereiche verloren gehen würden (vgl. UABB 2004, 3 und Klieme et al. 2003, 19). Dass damit ein Lebensbereich wie der der beruflichen Bildung exkludiert wird, erscheint in dieser Sichtweise so als dass „kulturelle Selbstverständlichkeiten [die B.D. / P.Sl.] nicht begründungsbedürftig sind, sondern sich selbst rechtfertigen“ ( Tenorth 2004, 657). ) Genau genommen muss wohl bevor ein fachbezogenes Kompetenzmodell entwickelt werden kann, die Domäne selbst bestimmt und ihre innere Struktur konstruiert werden.
Damit ist gleichzeitig die implizite Forderung verbunden, dass es eindeutige Strukturen geben muss, etwa in der Festlegung einer Fachidee. Frank Achtenhagen (2004, 22ff.) geht bei der Bestimmung von Domänen im Bereich der beruflichen Bildung von einem übergeordneten sinnstiftenden, thematischen Handlungskontext aus. Damit verlässt er zugleich die strengen Vorgaben von Klieme et al. (2003) und lässt explizit die Möglichkeit zu, dass in beruflichen Domänen unterschiedliche fachliche Zugriffe (konkret nennt er betriebswirtschaftliche und rechtliche Inhalte) integriert sind. Dies ist im Übrigen kein genuines Problem der Lernfelder; die Integration unterschiedlicher ‚Fächer' in Domänen kennzeichnet auch die traditionellen inhaltlichen (inputorientierten) beruflichen Lehrpläne. Hier scheint es u. E. im Konzept der Bildungsstandards Klärungs- und Revisionsbedarf zu geben, was am folgenden Exkurs deutlich werden soll:
Exkurs: Anwendungsbeispiel aus der Domäne ‚Wirtschaft und Verwaltung'
Das nachfolgende Beispiel entstammt aus der Lehrtätigkeit eines der Autoren und wurde lange vor Einführung von Lernfeldern und der Diskussion von Bildungsstandards von ihm in einer Fachschule eingesetzt. Es handelt sich um eine typische ‚kaufmännische' Aufgabe:
Beispiel:
Ein Unternehmen produziert Stühle und verkauft sie für je 749 GE. Es verfügt über eine monatliche Kapazität von 10 Stück. Die Materialkosten betragen pro Stück 450 GE. Die monatlichen Fixkosten belaufen sich auf 1.000 GE. Im Februar werden erfahrungsgemäß immer nur 8 Stühle verkauft.
Lohnt es sich, die überschüssige Februarkapazität zu nutzen, um einem Interessenten Stühle zum Preis von je 499 GE zu verkaufen? Begründen Sie bitte Ihre Antwort!
Die Problematik ist bekannt. Es handelt sich um eine Deckungsbeitragsrechnung. Lehrerinnen, die ähnliche Aufgaben einsetzen, kennen das Spiel: Erst wenn die fixen Kosten richtig gedeutet werden, erscheint es sinnvoll, kurzfristig einen Verkauf unter der Gewinnschwelle, aber oberhalb der Verbrauchskosten pro produzierter Einheit zu realisieren.
Interessant ist beispielsweise, dass diese Aufgabe gerade von Mathematiklehrern als ein Anwendungsfall für den Mathematikunterricht angesehen wird. Traditionell wurden und werden solche Aufgaben aber als Beispiel für den kaufmännischen Unterricht angesehen. Analog des wirtschaftsinstrumentellen Ansatzes von Preiß & Tramm (1990) kann davon ausgegangen werden, dass mit Hilfe der Mathematik hier betriebswirtschaftliche Inhalte angesprochen und ‚bearbeitbar' gemacht werden. Achtenhagen (vgl. 2004, 23, Abb. 2a) spricht in Anlehnung an Getsch & Preiß (2003) von einem Prozess des Mathematisierens. Schüler erzielen Ergebnisse durch die Anwendung eines mathematischen Regelwissens. Somit ergäbe sich als erstes Ergebnis: „Der Verkauf lohnt sich!“ Diese Antwort verweist auf prozedurales Wissen (Regelwissen).
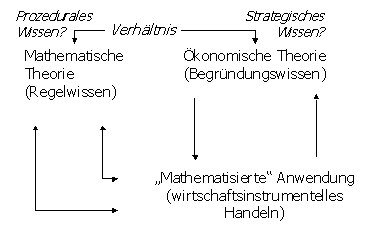
Abb. 5: Integration unterschiedlicher Fachprinzipien in kaufmännische Aufgaben
Ganz im Sinne eines fachübergreifenden Unterrichts bieten sich Anknüpfungspunkte zu weiteren Themen und Fragestellungen. So kann beispielsweise der ‚technisch' denkbare Vorteil eines Deckungsbeitrags mit Überlegungen zum Auftreten des Unternehmens am Markt diskutiert werden. Sehr schnell kommt man dann auch zu Fragen einer Produktdifferenzierung, z.B. im Hinblick auf eine Abschöpfung von Kapazitäten für No-Name-Marken usw. Damit stellt sich die Frage, ob der rechnerisch mögliche Deckungsbeitrag, der kurzfristig erzielt werden kann, mittel- und langfristig vernünftig ist? In diesem Fall müssten Schülerinnen dann ökonomische Theorien als Begründungswissen (als strategisches Wissen) heranziehen und eine Beurteilung vornehmen. Somit könnte sich als zweites Ergebnis ergeben: „Der Verkauf ist mittelfristig schädlich, weil er das Auftreten des Unternehmens am Markt schädigen und falsche, für das Unternehmen abträgliche Kundenerwartungen produzieren könnte!“ Eine solche Antwort würde auf strategisches Wissen (ökonomisches Begründungswissen) verweisen. Abbildung 5 verdeutlicht die Zusammenhänge im Überblick.
An diesem Beispiel werden einige sehr relevante Fragen deutlich: Was sind eigentlich die leitenden Prinzipien, die fachlichen Kernideen; was ist die Sprache des kaufmännischen Unterrichts? Beziehen wir uns hier auf die von Tenorth (vgl. UABB 2004) oder die in der Expertise (vgl. Klieme et al. 2003, 18 f.) angebotenen traditionellen – eher gymnasialen – Profile zurück, so bieten sich mathematisch-naturwissenschaftliche, sprachlich-literarische, ästhetisch-expressive oder historisch-soziale Profile an. Gemessen an diesen Strukturen ist der kaufmännische Unterricht immer schon fachübergreifend angelegt gewesen, weil er als traditionelles Fach juristische, volkswirtschaftliche [historisch-soziale?], sprachliche [sprachlich-ästhetische?] und mathematische [mathematisch-naturwissenschaftliche?] Modelle und Konzepte usw. immer schon integriert hat.
Exkurs Ende
Geht man auf die kognitionstheoretischen Grundlagen der Standards zurück, so stellt sich die Frage, welches Wissen in der obigen Aufgabenstellung angesprochen werden soll:
Im Rahmen der Aufgabe kommt zum einen ein mathematisches Regelwissen zur Anwendung. Es handelt sich hierbei um prozedurales Wissen, welches sich in wirtschaftsinstrumentellem Handeln niederschlägt. Der Begriff verweist auf die Göttinger Konzeption zum Rechnungswesenunterricht (vgl. u.a. Achtenhagen 1990; Preiß / Tramm 1990): In diesem Ansatz wird die Informationsverarbeitung (Dokumentation betrieblicher Prozesse und deren Auswertung) als ‚Arbeitstechnik' angesehen, um komplexe betriebswirtschaftliche Probleme zu bearbeiten. Vom Grundgedanken her werden wirtschaftliche Inhalte in den Rechnungswesenunterricht integriert.
Die Lösung der Aufgabe kann daher mit Hilfe eines mathematischen Regelwissens erfolgen. Damit ist aber nicht gleichzeitig verbunden, dass Lernende verstehen, warum es zu der Lösung kommt und wie sich dies aus einer betriebswirtschaftlichen Vorstellung heraus begründen ließe. Hierfür ist ein strategisches Wissen im Sinne eines betriebswirtschaftlichen resp. ökonomischen Wissens erforderlich. Neben dem Know-how (prozedurales Wissen, mathematisches Wissen) ist für das Verständnis der Aufgabe ein Know-why (Begründungswissen, betriebswirtschaftliches Wissen) erforderlich (vgl. auch Sloane 1996, 79f.).
Zwischenergebnis (4):
Bei den nationalen Bildungsstandards wird von domänenspezifischen Kompetenzmodellen ausgegangen. Die Übertragung auf den Bereich der beruflichen Bildung macht deutlich, dass sowohl für die Lernfelder als auch für traditionelle Fächer vorausgehend geklärt werden muss, wie die Domäne aufgebaut ist. Dies ist u. E. wahrscheinlich nicht nur ein Problem im beruflichen Bereich sondern ein generelles Implementationsproblem.
U. E. muss daher die Domäne konstruiert werden. Folgen wir dem Vorschlag Achtenhagen s (2004, 22) und gehen von einem übergeordneten sinnstiftenden thematischen Handlungskontext aus, so entsteht die Domäne durch Klassifizierung von Tätigkeiten in einem ‚gesetzten' Handlungskontext.
„Die Standards legen aber nicht nur eine ‚Meßlatte' an, sondern differenzieren zwischen Kompetenzstufen, die über und unter bzw. vor und nach dem Erreich des Mindestniveaus liegen“ ( Klieme et al. 2003, 18). Damit wird eine Skalierung innerhalb der Kompetenzmodelle notwendig. Die Abstufung von Kompetenzen oder Teilkompetenzen stellt einen zentralen Aspekt für die Formulierung von Kompetenzmodellen dar, um so die Erwartung kriteriumsorientierter Interpretationen von Testergebnissen zu erfüllen (vgl. Klieme et al. 2003, 62). In der Expertise werden für die Abstufung von Kompetenzniveaus zwei Hinweise gegeben: erstens, dass sich die einzelne Kompetenzstufe durch „kognitive Prozesse und Handlungen von bestimmter Qualität spezifiziert, die Schülerinnen und Schüler auf dieser Stufe bewältigen können, nicht aber auf niedrigeren Stufen“ ( Klieme et al. 2003, 62) und zweitens, dass sich die Kompetenzstufen je nach Domäne sehr unterschiedlich darstellen.
Bisherige Modelle von Niveaustufen werden insbesondere aus den internationalen Vergleichsstudien entlehnt. Am Beispiel der Bildungsstandards für den mittleren Bildungsabschluss im Fach Mathematik lässt sich dann auch die Übernahme der Skalierungslogik erkennen, jedoch wurde aus einer fünfstufigen Skalierung, wie sie im PISA-Test verwendet wurde, eine dreistufige (Reproduzieren – Zusammenhänge herstellen – Verallgemeinern und Reflektieren) für die Bildungsstandards für den mittleren Bildungsabschluss. Problematisch an dieser Übernahme ist, dass die grundlegenden Fragestellungen der PISA-Studie mit normorientierten Messwerten beantwortbar sind (vgl. Rost 2004, 663), für die Bildungsstandards jedoch der Anspruch an eine Kriteriumsorientierung erhoben wird (vgl. Klieme et al. 2003, 62). U. E. ist es notwendig, dass für die Skalierung eine Vergewisserung und konzeptionelle Klärung (1) in der Frage der Anzahl der Dimensionen, (2) der Frage der Bezugspunkte und (3) der Orientierung der Bewertung vorgenommen wird.
Ad (1) Anzahl der Dimensionen: eindimensional - mehrdimensional
Der Begriff der Stufen oder des Niveaus legt bereits nahe, dass grundlegend die Idee verfolgt wird, auf einer Kompetenzdimension verschiedene Ausprägungen abzubilden. Dies erfordert jedoch ein Modell einer eindimensionalen Kompetenz, d. h. es müsste gelingen, Kompetenzen bzw. Aufgaben zu entwickeln, die mit einem unterschiedlichen Leistungsniveau korrespondieren und damit müssten auch alle Faktoren, die den Schwierigkeitsgrad einer Anforderung definieren, ein Cluster bilden (vgl. Rost 2004, 664). Die Ergebnisse zur Prüfung der Testaufgaben im PISA-Test stellen jedoch dar, dass sich Items einer Testaufgabe nicht in einem Kompetenzniveau wieder finden lassen, sondern über unterschiedliche Kompetenzniveaus hinweg streuen (vgl. Prenzel et al. 2001). Ein Ausweg aus dieser Schwierigkeit besteht in der Einführung mehrerer Teildimensionen zur Konkretisierung von Kompetenzmodellen oder Aufgabenschwierigkeitsgraden. Bei mehrdimensionalen Kompetenzmodellen bedarf es der Entwicklung von Komponenten- oder Teildimensionen-Modellen. Problematisch daran ist die Frage nach der inneren Struktur bzw. des Zusammenhangs zwischen den Komponenten. Für messtheoretische Annahmen werden solche Komponenten oftmals als gewichtete Faktoren zu einem Gesamtergebnis aufaddiert und in einem linearen Modell abgebildet. Dies setzt jedoch eine trennscharfe Zuordnung voraus, wie sie in kategorialen Kompetenzmodellen (vgl. 3.1) nur schwer definiert werden können.
Ad (2) Bezugspunkte der Messung: Person – Aufgabe – Lösungsweg
Der Bezugspunkt der Messung wird in den bisher vorliegenden Kompetenzmodellen vorrangig in der Kompetenz der Person und damit in dem Fähigkeiten- und Fertigkeiten-Profil einer Person gesehen. Weitere mögliche Bezugspunkte für die Frage der Skalierung stellen die Aufgabenstellung selbst und mögliche Lösungswege dar. Vielfach wird der Bezugspunkt zwischen den beiden Varianten der Kompetenz einer Person und der Aufgabenstellung vermischt. Die Aussage über das Erreichen einer Kompetenzstufe durch eine Person wird in den internationalen Vergleichsstudien wie auch in der Klieme-Expertise (vgl. 2003, 62) indirekt über die Ergebnisse der Beantwortung von Aufgabenstellungen unterschiedlicher Niveaus getroffen, jedoch als Kompetenzniveau der Person interpretiert. Mit der Wahl des Bezugspunktes sind verschiedene Annahmen für die Generalisierung der Ergebnisse verbunden. Spricht man von dem Erreichen eines Kompetenzniveaus oder einer
-stufe durch eine Person, so wird angenommen, dass die Person generell ein Kompetenzniveau ‚besitzt' welches dieser Stufe entspricht. Werden hingegen die Aufgabenstellungen in ihrem Schwierigkeitsgrad graduiert, so kann zunächst nur die Aussage getroffen werden, ob die Aufgabe durch eine Person erfolgreich bearbeitet wurde oder nicht. Generalisierungen lassen sich dabei zunächst nur auf die Bearbeitung von Aufgabentypen beziehen.
Zieht man die Überlegungen zur Entwicklung von Aufgaben hier hinzu, werden unterschiedliche Strukturierungslogiken sichtbar. Im Sinne der Expertise werden die Aufgaben aus den gestuften Kompetenzmodellen abgeleitet, bzw. die Aufgaben werden für die einzelnen Stufen der Kompetenzmodelle entwickelt. Die Erfahrung aus den internationalen Vergleichsstudien zeigt eine umgekehrte Vorgehensweise auf, hier wurden zunächst Aufgaben entwickelt und über deren empirische Überprüfung Kompetenzniveaus definiert, denen die Aufgaben dann wiederum ex-post zugerechnet wurden (vgl. Prenzel et al. 2001). Ein handlungstheoretisches Kompetenzverständnis, wie es sich in der beruflichen Bildung, insbesondere im Kompetenzverständnis des Lernfeldkonzepts wieder finden lässt (vgl. 3.1 und 3.2), stellt zunächst die Entwicklung der Aufgaben aus den beruflichen Tätigkeiten der Domäne in den Vordergrund. Damit sind zunächst die Aufgabenstellungen in ihrem Schwierigkeitsgrad zu graduieren, bevor in einem zweiten Schritt, die entsprechenden Kompetenzanforderungen beschrieben werden können.
Ein bis dato relativ wenig berücksichtigter Bezugspunkt für die Messung stellt der Lösungsweg bzw. bestimmte Lösungsprofile dar. Der Anspruch, der in der Expertise an die Unterscheidbarkeit von Kompetenzstufen gestellt wird, liegt in der Spezifität kognitiver Prozesse und Handlungen (vgl. Klieme et al. 2003, 62). Lösungsverhalten oder – in umgekehrter Logik – typische Fehler bei der Bearbeitung von Aufgaben geben Einblicke in das Denken und Handeln der Lernenden und würden so eine stärker prozessorientierte Beurteilung erlauben als das Ergebnis von Aufgaben (vgl. Rost 2004, 672 ff.). Es ist somit erforderlich, dass Aufgaben entwickelt werden, die unterschiedliches Lösungsvorgehen und damit qualitative Aussagen über den Lösungsweg erlauben. Hierzu müssten weitere Überlegungen sowohl im Kontext der allgemeinen als auch der beruflichen Bildung unternommen werden.
Ad (3) Beurteilungsmaßstab: Norm-, Kriteriums- und individuelle Orientierung
Hinsichtlich der Überführung der Messung in eine Beurteilung gilt es dann, das Anspruchsniveau festzulegen und die beobachtete Messung damit zu vergleichen und einzuordnen. Die Definition des Leistungsmaßstabs ist eine normative Entscheidung, die sich auf Kriterien (kriteriumsorientiert), die Gruppe (normorientiert) oder den einzelnen Lerner (individuell) beziehen kann (vgl. Breuer / Hermann-Wyrwa & Propach 2000, 11). Die individuell an der Entwicklung der einzelnen Person orientierte Bewertung spielt bei der Frage der Bildungsstandards, die ja explizit nicht zur individuellen Diagnose herangezogen werden sollen, sondern zum System-Monitoring, keine Rolle (vgl. Klieme et al. 2003, 39). Viel wichtiger ist die Unterscheidung zwischen Kriteriums- und Normorientierung. Es wird betont, dass die Kompetenzmodelle kriteriumsorientiert gemessen und bewertet werden sollen (vgl. Klieme et al. 2003, 62), eine Tendenz zur Normorientierung lässt sich bereits in den ersten Implementationserfahrungen erkennen. „Das Problem der Setzung des Kriteriums beim kriteriumsorientierten Testen ist ein Problem der Integration von qualitativer und quantitativer Messung. Angestrebt wird ein qualitativer Messwert der Art: Schüler X hat das Kriterium erreicht, Schülerin Y erfüllt den Bildungsstandard. Zur Verfügung steht ein quantitativer Messwert: das Abschneiden in einem Test“ ( Rost 2004, 663).
In der Zusammenschau der möglichen Ansatzpunkte für die Skalierung lassen sich unterschiedliche Dimensionierungen, Bezugspunkte und Bewertungsmaßstäbe erkennen, die oftmals zu Mischmodellen zusammengestellt werden. Die derzeit vorgestellten Niveaustufen (z. B. für Mathematik: Reproduzieren – Zusammenhänge herstellen – Verallgemeinern und Reflektieren) ( Der Leserin mag die Ähnlichkeit zur Taxonomie nach Bloom auffallen (vgl. Bloom et al. 1976). Dieses Konzept von Inklussionsklassen für die kognitive Entwicklung wurde hinsichtlich seiner Einengung auf kognitive Entwicklung, der empirischen Nichthaltbarkeit der Kummulativitätsannahme und der definitorischen Festlegung auf fünf Stufen kritisiert (vgl. Euler 1989). ) deuten u. E. inhaltlich eher auf den Bezugspunkt des Lösungsweges hin, werden jedoch in der Interpretation der Person als Kompetenzprofil bzw. Fähigkeitenprofil zugerechnet. Schwieriger als die Frage des Bezugspunktes stellt sich jedoch die Erwartung in der Expertise dar, dass die Logik des Wissenserwerbs und der Kompetenzentwicklung in den Kompetenzstufen berücksichtigt werden (vgl. Klieme et al. 2003, 62). (Eine kritische Haltung dazu nimmt Neuweg ein: „Als didaktischer Kategorienfehler (…) nun lässt sich der Übergang von solchen Lernziel beschreibungen zu Vorstellungen darüber bezeichnen, welche Lernwege zur Erreichung dieser Lernziele führen“ (Herv. im Orig., Neuweg 2005, 12). ) Damit wird die Entwicklung dem Zustand gleich gesetzt, eine Annahme deren lerntheoretische Basis eher in einem behavioristischen denn in einem kognitiv-konstruktivistischen oder handlungstheoretischen Lernparadigma zu verorten wäre (vgl. Sloane / Twardy & Buschfeld 2004, 114 f.).
Zwischenergebnis (5):
Bei der Frage der Skalierung treten in der Konzeption der Bildungsstandards im Sinne der Klieme-Expertise (vgl. Klieme et al. 2003) Vermischungen auf, die u. E. für die Entwicklung von Kompetenzmodellen stärker konzeptionell fundiert und differenziert werden müssen.
Bei der Übertragung des Skalierungsaspektes in den Kontext der beruflichen Bildung ist einerseits die eher enge kognitionsorientierte Ausrichtung bisheriger Niveaustufen zu problematisieren, die weitere Teildimensionen beruflicher Handlungskompetenz nicht ausreichend erfassen helfen. Andererseits erweist sich die angedeutete Gleichsetzung von Kompetenzanwendung und Kompetenzentwicklung als vor einem in der beruflichen Bildung verfolgten eher konstruktivistisch bzw. handlungstheoretisch orientierten Lernverständnis als nicht haltbar.
Der kognitionstheoretische Kompetenz-Ansatz wird in der Expertise mit einem empirischen Zugang verbunden bzw. gleichgesetzt (vgl. Klieme et al. 2003, 16). Tatsächlich lassen sich aber durchaus unterschiedliche empirische Konzepte lokalisieren.
So existiert beispielsweise bei gemäßigten Vertretern der Kognitionstheorie – insbesondere jedoch bei Vertretern des Tacit-Knowledge-Ansatzes (Tacit Knowledge ist nur teilweise mit implizitem Wissen gleichzusetzen. Genau genommen geht es bei diesen Ansätzen darum, die Denkprozesse und nicht das Wissen von intuitiv handelnden Experten zu erfassen. ) (vgl. Neuweg 2001) – die Vorstellung, dass man Kompetenzen weder als Ursache für erfolgreiches Handeln (Performanz) ansehen kann, noch dass davon auszugehen ist, dass sich diese in Form von Fähigkeiten und Fertigkeiten resp. als reales Wissen fixieren lassen.
Die hier angedeutete Unterscheidung wird deutlich, wenn man die in Abbildung 2 durch Pfeile angedeutete Beziehung zwischen Disposition (Kompetenzebene) und Aufgabenbearbeitung (Performanz) genauer untersucht. Versteht man die Kompetenz kognitionstheoretisch als Wissen, so kann die Aufgabenlösung als wissensbasierte Tätigkeit gedeutet werden. Mit anderen Worten: Die Bearbeitung der Aufgaben durch Probanden ist eine Frage der Wissensanwendung. Wissen geht dem Können voraus. Wissen ist real ‚im Kopf' vorhanden. Dies wäre die konzeptionelle Voraussetzung dafür, dass Kompetenzen über Aufgabenstellungen verifiziert bzw. falsifiziert werden können (vgl. Neuweg 2005).
Begreift man hingegen Kompetenz als inneren Prozess der Handlungsregulierung, so ist Kompetenz nicht material ‚im Kopf' als Disposition lokalisierbar, sondern lediglich als ‚hypothetische Konstrukte' beschreibbar. Mit Hans-Georg Neuweg (vgl. 2005, 5) handeln Menschen ‚kompetent' als ob sie eine Handlungskompetenz hätten. ‚Als-ob'-Klassifizierungen von empirisch beobachtbaren Aufgabenlösungen indizieren Handeln und führen so zu hypothetischen Konstrukten. Kompetenzen sind dann nicht zwingend die Ursache für Leistung. Der kompetenten Aufgabenlösung liegt gemäß dieser Vorstellung nicht Wissen zugrunde, sondern inneres Handeln: Denkhandeln, ein Denkprozess etc.
Zwischenergebnis (6):
Es werden zwei methodologische Zugänge sichtbar: ein kognitionstheoretischer, der von Wissensstrukturen ausgehend zu Aufgabentypen gelangt, und ein handlungstheoretischer, der von Aufgabentypen ausgeht und zu beobachtbaren Klassifizierungen kommt.
So gesehen umschiffen die Protagonisten der Standardmessung ein sehr grundlegendes methodisches Problem der empirischen Erforschung von Lernen, indem sie sich auf eine Richtung festlegen: Wissensstruktur – Aufgabenbearbeitung – Zuschreibung von Wissen.
In den Curricula für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule dominiert das Konzept der Lernfelder. Diese sind Schneidungen von Inhalten und beruflichen Aufgaben. In Form einer Matrix lassen sich dabei fachliche bzw. domänenspezifische Inhalte mit berufsbezogenen Aufgaben verbinden, wie in Abbildung 6 beispielhaft für die Domäne Management angedeutet.

Die Aufgaben sind performativ und konkretisieren die beruflichen Tätigkeiten. Achtenhagen (2004, 23f, u. a. Abbildung 1) spricht hier von konkreten Aufgabenanforderungen.
Demgegenüber lassen die Inhalte den Bezug zu (wissenschaftlichen) Fächern zu. Dabei geht es nicht um ein reduziertes begriffliches Fachwissen, sondern – ähnlich den Überlegungen zu den Bildungsstandards – um fachliche Prinzipien, Leitideen, Verfahren, Begriffe etc.
In beiden Konzepten – Bildungsstandards und Lernfelder – sind Aufgaben konstituierend.
Im Konzept der Standards werden Aufgaben zur empirischen Überprüfung von Kompetenzen als notwendig angesehen. Damit ist aber eine sehr grundlegende Entscheidung getroffen worden, die auf der Ebene der Bildungsziele angesiedelt ist. Klieme et al. (2003) explizieren dies nicht wirklich. Sie weisen lediglich darauf hin, dass Bildungsziele in fachlichen Kompetenzmodellen umgesetzt resp. anhand dieser präzisiert werden sollen. Auf den ersten Blick ist dies eine Entscheidung für ein wissenschaftsorientiertes Vorgehen. Die gleichzeitig getroffene Entscheidung, outcome-orientiert zu steuern und anwendungsbezogene Aufgaben zu formulieren, macht deutlich, dass ein weiteres curriculares Prinzip eingeführt wird (das Situationsprinzip, vgl. Reetz 1984), was im Hinblick auf die Ausgestaltung der Standards genau genommen auch eine intentionale Qualität hat. Die Aufgabenentwicklung ist daher im Konzept der Bildungsstandards mehr als nur die empirische Prüfbasis; sie beinhaltet zugleich eine curriculare Festlegung auf einen bestimmten Aufgabentypus (vgl. hierzu auch Dilemma 2 in Kapitel 2, Absatz 2.2).
Im Lernfeldkonzept sind Aufgaben zum einen auf der Ebene der Lernfelder curricular angesiedelt. Sie greifen auf berufliche Tätigkeiten zurück, sind also nicht fach-, sondern anwendungsbezogen im Hinblick auf Lebenswelten. Die Aufgaben werden dann zum anderen in Lernsituationen übertragen. Dies bedeutet letztlich, dass Lernsituationen Anwendungsbeispiele für Kompetenzen im Konzept der Bildungsstandards sein könnten. Sie müssten dann zweifach betrachtet werden: zum einen als Anwendungsfall für fachliche Strukturen und zum anderen als Anwendungsfall beruflicher Tätigkeiten. Dies ist kein Widerspruch. Im Lernfeldkonzept findet immer auch eine fachliche Analyse statt, bei der es darum geht, die Sprache, die Konzepte und Modelle einer Domäne zu berücksichtigen (vgl. Tramm 2002; Sloane 2005).
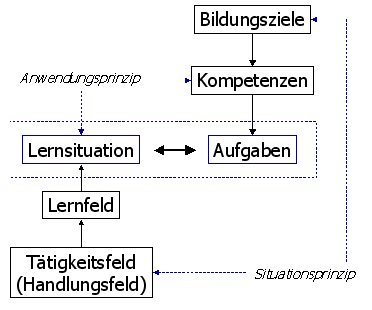
Abb. 7: Aufgabenorientierung als gemeinsamer Fokus von Bildungsstandards und Lernfeldern
In Abbildung 7 wird diese gemeinsame Verankerung von Lernfeldern und Bildungsstandards in der Aufgabenorientierung aufgezeigt, wobei zugleich auch die unterschiedlichen Bezugssysteme deutlich werden.
Hierbei kann allerdings nicht in der Form verfahren werden, Lernsituationen mit Aufgaben für Bildungsstandards gleichzusetzen. Ausgehend vom Konzept der Bildungsstandards geht es darum, für fachliche bzw. domänenspezifische Kompetenzmodelle anwendungsbezogene Aufgaben zu entwickeln. Standards sollen sich dabei – hieran sei erinnert – am Outcome des Bildungssystems orientieren. Damit findet das Situationsprinzip Eingang in das Konzept: eine intentionale Festlegung im Konzept der Bildungsstandards. Einen solchen Situationsbezug bekommt man nur durch Hinwendung zu Praxisräumen, in denen das Gelernte seine Anwendung finden soll.
Zwischenergebnis 7:
Lernfelder und Bildungsstandards ergänzen sich:
• Bildungsstandards ‚transportieren‘ ein fachbezogenes Anwendungsverständnis in den Unterricht!
• Lernfelder sind keine Bildungsstandards (im Sinne von Klieme et al.), sondern curriculare Grundlagen für die Entwicklung von realistischen Aufgaben zur Prüfung von Standards!
• Lernsituationen sind demnach Performanzbedingungen einer für das Subjekt objektiv vorhandenen ökonomisch-technischen Welt!
Diese Überlegungen fordern dazu auf, den Anwendungsbezug von Standards genauer zu prüfen. Mit Blick auf die – für die berufliche Bildung konstitutive – berufliche Anwendungssituation des Gelernten stellt sich die Frage, ob und in welcher Form sich dieser ‚Lebenszusammenhang' in fachliche Kompetenzmodelle einbinden lässt. In dem Maße wie Aufgaben –den Anforderungen der Bildungsstandards entsprechend – outcome-orientiert sind, erschweren sie die Zuordnung zu eindeutigen fachlichen Profilen. Es würden ggf. Aufgaben entstehen, die nicht eindeutig einem fachlichen Kompetenzprofil zuzuordnen wäre. So würden in kaufmännischen Aufgaben – wie angedeutet – mathematische, juristische und betriebswirtschaftliche Kompetenzbereiche angesprochen werden.
Zum Ende möchten wir kurz nochmals die von uns analysierten Dilemmata zusammenfassen und gruppieren, bevor wir eine konstruktive Wendung vornehmen und u. E. notwendige Schritte zur Adaption des Konzepts der Bildungsstandards für die berufliche Bildung vornehmen.
a) Dilemmata im grundlegenden Wirkmechanismus von Standards im Bildungssystem
Dilemma 1: Die Auslagerung der Lernperspektive aus der Steuerung
Dilemma 2: Die Auslagerung der Legitimationsfrage und die Aufwertung der Fachdidaktik
b) Dilemmata in der Übertragung des Konzepts der ‚nationalen Bildungsstandards' in den Kontext der beruflichen Bildung
Dilemma 3: Divergente Annahmen über und die Ausgestaltung von Kompetenzmodellen
Dilemma 4: Domänen zwischen Fachlichkeit und Beruflichkeit
Dilemma 5: Die Skalierungsfrage
Dilemma 6: Das empirische Konzept
Dilemma 7: Situationsbezug resp. Aufgabenorientierung
Die dargestellten Dilemmata verweisen u. E. insbesondere auf konzeptionelle offene Fragestellungen wie auch Brüche hin. Dies soll jedoch kein Argument dafür liefern, Bildungsstandards für die berufliche Bildung als nicht notwendig oder nicht umsetzbar zu deklarieren. Für die konstruktive Arbeit mit Bildungsstandards im beruflichen Kontext sehen wir Arbeitsschritte als notwendig an, die geleistet werden müssen, bevor eine Implementation im Kontext der beruflichen Bildung vorgenommen werden kann. Insbesondere sehen wir in dem Konzept der Bildungsstandards eine Anreicherung der didaktischen Arbeit, die dazu beitragen kann, spezifische Felder nochmals konkret zu bearbeiten. Den didaktischen Gesamtzusammenhang, in dem wir die Bildungsstandards eingebettet sehen, verdeutlicht Abbildung 8.
In der praktischen Umsetzung stellen sich folgende Anforderungen/Aufgaben:
• Präzisierung der Domäne, z. B. Wirtschaft und Verwaltung oder als beruflich sinnstiftender Kontext in Form eines input-orientierten Kerncurriculums oder in Form von Lernfeldern
• Formulierung eines Kompetenzmodells, z. B. wie Achtenhagen (2004) mit Hinweisen auf Skalierung
• Gewinnung von Aufgabenanforderungen als Performanzbedingungen – exemplarische Lernsituationen als Bindeglied zwischen Standard und Curriculum mit Interventionshinweisen.
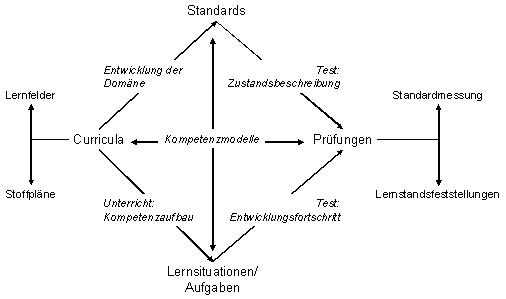
Abb. 8: Didaktischer Gesamtzusammenhang
Griechenland wurde Europameister – aber heißt dies nun wirklich, der griechische Fußball sei besser als der englische. Soll man den Trainer ins Vereinigte Königreich holen? Nicht mehr am Turnier teilnehmen? …
Abs, H. J. (2005): Vortrag im Rahmen der Abschlusstagung des Modellversuchs FIT, Frankfurt.
Achtenhagen, F. (1990) (Hrsg.): Didaktik des Rechnungswesens. Programm und Kritik eines wirtschaftsinstrumentellen Ansatzes, Wiesbaden.
Achtenhagen, F. (2004): Prüfung von Leistungsindikatoren für die Berufsbildung sowie zur Ausdifferenzierung beruflicher Kompetenzprofile nach Wissensarten. In: BMBF (Hrsg.): Bildungsreform Band 8: Expertisen zu den konzeptionellen Grundlagen für einen Nationalen Bildungsbericht – Berufliche Bildung und Weiterbildung / Lebenslanges Lernen. Online: http://www.bmbf.de/pub/expertisen_zd_konzept_grundlagen_fn _bildungsbericht_bb_wb_lll.pdf , Stand: August 2005.
Arbeitsgruppe ‚internationale Vergleichsstudie' (2003): Vertiefender Vergleich der Schulsysteme ausgewählter PISA-Staaten hrsg. Vom BMBF, Online: http://www.bmbf.de/pub/pisa-vergleichsstudie.pdf , Stand: August 2005.
Bader, R. ( 2000): Konstruieren von Lernfeldern – eine Handreichung für Rahmenlehrplanausschüsse und Bildungsgangkonferenzen in technischen Berufsfeldern. In: R. Bader / P. F. E. Sloane (Hrsg.): Lernen in Lernfeldern. Theoretische Analysen und Gestaltungsansätze im Lernfeldkonzept. Beiträge aus den Modellversuchsverbünden NELE & SELUBA, Markt Schwaben.
Bader, R. / Müller, M. (2002): Leitziel der Berufsbildung: Handlungskompetenz: Anregungen zur Ausdifferenzierung des Begriffs. In: Die berufsbildende Schule, Heft 6, Jg. 54 2002, 176-182.
Baethge, M. (1975): Die Integration von Berufsbildung und Allgemeinbildung als Forschungskonzept für die Berufsbildungsforschung. In: Roth, H. / Friedrich, D. (Hrsg.): Bildungsforschung. Teil 1. Stuttgart, 256-302.
Beauchamp, G. A. (1968): Curriculum Theory. 2 nd edition, Illinois.
Biehl, J. / Hopmann, S. / Ohlhaver, F. (1996): Wie wirken Lehrpläne? Modelle, Strategien, Widersprüche. In: Pädagogik 5, 33-37.
Bloom, B. S. et al . (1976): Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich, 5. Aufl. Weinheim.
BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (2004): Eckwerte Reform berufliche Bildung, Stand: 09.02.2004 Online: http://www.bmbf.de/pub/eckwerte_bbig_reform.pdf , Stand: Mai 2004.
Boekaerts, M. (2002): Bringing about change in the classroom: strengths and weaknesses of the self-regulated learning approach. In: Learning and Instruction, 12, 589-604.
Breuer, B. / Hermann-Wyrwa, B. / Propach, S. (2000): Leistungsbeurteilung in offenen Unterrichtsphasen, Essen.
Chomsky, N. (1957): Syntactic Structures, Mouton.
Chomsky, N . (1965): Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge .
Chomsky, N. (1969): Aspekte der Syntax-Theorie, Frankfurt / Main.
Dilger, B. (2004): Kompetenz als Standard der Bildung (von Standards). In: Köln WP, 19. Jg., Heft 36 2004, 11-35.
Dubs, R. (1998): Qualitätsmanagement für Schulen. Hrsg. vom Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen, St. Gallen.
Eraut, M. (1994): Developing Professional Knowledge and Competence, London .
Erpenbeck, J. & von Rosenstiel, L. (Hrsg.) (2003). Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis. Stuttgart.
Ertl, H. / P. F. E. Sloane (o. J.): Einführende und zusammenführende Bemerkungen: Der Kompetenzbegriff in internationaler Perspektive. In: H. Ertl / P. F. E. Sloane (Hrsg.): Kompetenzerwerb und Kompetenzbegriff in der Berufsbildung in internationaler Perspektive, Paderborn (im Druck), 19-42.
Euler, D. (1989): Kommunikationsfähigkeit und computerunterstütztes Lernen, Köln.
Getsch, U. / Preiß, P. (2003): Modellunternehmen Kettenfabrik A & S GmbH – Grundkurs Rechnungswesen – belegorientiert. Geschäftsjahre 2010 – 2014. Belege und Grafiken zum Bearbeiten und Lösungsheft, Troisdorf.
Giddens, A. (1988): Die Konstitution der Gesellschaft, Frankfurt.
Hameyer, U. / Frey, K. / Haft, H. (1983): Handbuch der Curriculumforschung, Weinheim.
Halfpap, K. (1991): Ganzheitliches Lernen im Unterricht kaufmännischer beruflicher Schulen. In: Erziehungswissenschaft und Beruf, 39. Jg. 1991, Heft 3, 235-252.
Herrmann, U. (2003): „Bildungsstandards“ – Erwartungen und Bedingungen, Grenzen und Chancen. In: Zeitschrift für Pädagogik, 49. Jg. Heft 5, 2003, 625-639.
IQB - Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (o. J. ): Ziele, Online: http://www.iqb.hu-berlin.de/institut/ziele , Stand: August 2005.
Klafki, W. (1976): Aspekte kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft. Weinheim.
Klieme, E. (2004): Begründung, Implementation und Wirkung von Bildungsstandards: Aktuelle Diskussionslinien und empirische Befunde. In: Z. f. Päd, 50. Jg. Heft 5, 2004, 625-634.
Klieme, E. / Avenarius, H. / Blum, W. / Döbrich, P. / Gruber, H. / Prenzel, M. / Reiss, K. / Riquarts, K. / Rost, J. / Tenorth, H.-E. / Vollmer, H. (2003): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Berlin.
KMK – Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2000): Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz (KMK) für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihrer Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe, Online: http://www.kmk.org/doc/publ/handreich.pdf , Stand: August 2005.
KMK - Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2003a): Rahmenvereinbarung über die Berufsfachschulen. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997 i.d.F. vom 22.10.2004. Online: http://www.kmk.org/doc/beschl/RVBFS04-10-22.pdf , Stand: August 2005.
KMK – Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2003b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Bildungsabschluss, Beschluss vom 04.12.2003. Online: http://www.kmk.org/schul/Bildungsstandards/Mathematik_MSA_BS_04-12-2003.pdf , Stand: August 2005.
Mertens, D. (1974): Schlüsselqualifikationen. In: Mitt. d. Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 7. Jg. 1974, 36-43.
Neuweg, G. H. (2001): Könnerschaft und implizites Wissen. Zur lehr-lerntheoretischen Bedeutung der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis. 2., korr. aktual. Aufl. Münster.
Neuweg, G. H. (2005): Der Tacit Knowing View. Konturen eines Forschungsprogramms, unveröffentlichtes Manuskript.
North, D. C. (1990/92): Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge ; dt.: Institutionen, institutio neller Wandel und Wirtschaftsleistung, Tübingen 1990/1992.
o. V. (2005): Olympische Spiele der Antike. Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spiele_der_Antike , Stand: August 2005).
Picot, A. ( 1991): Ökonomische Theorie der Organisation – Ein Überblick über neuere Ansätze und deren betriebswirtschaftliches Anwendungspotenzial. In: Ordelheide, D. / Rudolph, B. / Büsselmann, E. (Hrsg.): Betriebswirtschaftslehre und ökonomische Theorie, Stuttgart, 143-170.
Picot, A. / Dietl, H. / Franck, E. (1999): Organisation, Stuttgart.
Preiß, P. / Tramm, T. (1990): Wirtschaftsinstrumentelle Buchführung – Grundzüge eines Konzepts der beruflichen Grundqualifizierung im Umgang mit Informationen über Mengen und Werte. In: Achtenhagen, F . (Hrsg.): Didaktik des Rechnungswesens. Programm und Kritik eines wirtschaftsinstrumentellen Ansatzes, Wiesbaden, 13-94.
Prenzel, M. / Rost, J. / Senkbeil, M. / Häußler, P. / Klopp, A. (2001): Naturwissenschaftliche Grundbildung. Testkonzeption und Ergebnisse. In: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich, Opladen, 192-250.
Reetz, L. (1984): Wirtschaftsdidaktik: Eine Einführung in Theorie und Praxis wirtschaftsberuflicher Curriculumentwicklung und Unterrichtsgestaltung, Bad Heilbrunn.
Rolff, H.-G. (2003): Bildungsstandards sind attraktiv – und problematisch. In: Frankfurter Rundschau online vom 12.03.2003, Online http://www.ggg-nrw.de/Presse/FR.2003-03-12.Rollf.html , Stand: Mai 2004.
Rost, J. (2004): Psychometrische Modelle zur Überprüfung von Bildungsstandards anhand von Kompetenzmodellen. In: Z. f. Päd. 50. Jg., Heft 5, 2004, 662-678.
Roth, H. (1971 ): Pädagogische Anthropologie. Bd. II. Entwicklung und Erziehung. Grundlagen einer Entwicklungspädagogik. Hannover.
Schmiel, M. (1978): Einführung in fachdidaktisches Denken. München.
Sloane, P. F. E. (1992): Modellversuchsforschung, Köln.
Sloane, P. F. E. (1996): Didaktik des Rechnungswesens, Pfaffenweiler.
Sloane, P. F. E. ( 2004a): Betriebspädagogik. In: Handwörterbuch des Personalwesens, Hrsg. von E. Gaugler und W. Weber , 3. Aufl., Stuttgart.
Sloane, P. F. E. (2005): Kompetenzen und Kompetenzniveaus in der beruflichen Domäne von Wirtschaft und Verwaltung: Bildungsstandards, Kompetenzorientierung und Lernfelder. In: Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen, Landesverband NRW e.V. (Hrsg.): Bildungsstandards für die berufliche Bildung II. Handlungserfordernisse. Dokumentation der 2. Tagung vom 17. Januar 2005 in Duisburg. Düsseldorf.
Sloane, P. F. E. / Twardy, M. / Buschfeld, D. (2004): Einführung in die Wirtschaftspädagogik, Paderborn.
Tenorth, H.-E. (2004): Bildungsstandards und Kerncurriculum. Systematischer Kontext, bildungstheoretische Probleme. In: Zeitschrift für Pädagogik, 50. Jg. Heft 5, 650-661.
Tramm, T. (2005): Vortrag im Rahmen der Abschlusstagung des Modellversuchs FIT, Frankfurt.
Tramm, T. (2002): Zur Relevanz der Geschäftsprozessorientierung und zum Verhältnis von Wissenschafts- und Situationsbezug bei der Umsetzung des Lernfeldansatzes im kaufmännischen Bereich. In: R. Bader / P. F. E. Sloane (Hrsg.): Bildungsmanagement im Lernfeldkonzept – curriculare und organisatorische Gestaltung, Paderborn.
UABB (2004): Gespräch zwischen Herrn Prof. Dr. Tenorth (Humboldt Universität Berlin) und dem Unterausschuss für Berufliche Bildung über Bildungsstandards in beruflichen Bildungsgängen anlässlich seiner 244. Sitzung am 17. / 18.06.04, Ziffer 2. Abgestimmtes Wortprotokoll, unveröffentlichtes Protokoll. Bonn.
Van Ackeren, I. (2003): Zur Diskussion um Bildungsstandards in Deutschland: Internationale Erfahrungen wahrnehmen und nutzbar machen. Beitrag für die GEW. Online: http://www.gew.de/Binaries/Binary3766/Bildungsstandards_in_Deutschland.pdf, Stand: August 2005.
Weichhold, M. (2003): Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss. Online: http://www.vlw.de, Stand: Mai 2004.
Weinert, F. E. (2001): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: F. E. Weinert (Hrsg.): Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim, 17-31.