|
| ||



Zusammenfassung: Ausgehend von der Konzeption einer Betriebspädagogik im Rahmen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik durch Karl Abraham in den fünfziger Jahren wird in diesem Beitrag versucht, die Möglichkeiten einer verstärkt erfahrungswissenschaftlichen Sichtweise auf den Betrieb herauszuarbeiten. Für die Erarbeitung der Möglichkeiten und Probleme eines erfahrungswissenschaftlichen Zugangs wird exemplarisch das diagnostische Problem der betrieblichen Bildungsbedarfsanalyse einer näheren Betrachtung unterzogen.
Auch wenn die Berufs- und Wirtschaftspädagogik durch ihre Geschichte hindurch und gerade auch im Rahmen der Reformdebatten mindestens der letzten zwanzig Jahre ihr besonderes Augenmerk auf die schulische Berufsbildung gerichtet hat, bleibt die Untersuchung des Betriebs eines ihrer zentralen, wenn nicht sogar konstitutiven Themenfelder. Als Subsystem des sozialen Funktionssystems „Wirtschaft«“ lässt sich der Betrieb disziplinär aus dem Verhältnis der strukturellen Größe „Wirtschaft“ zum Vorgang des „Erziehens“ fassen. Zugleich kann der Betrieb auch dahingehend gestaltet werden, dass eine in einer spezifischen Form gestaltete „Erziehung“ (mit-)bestimmend für die im Betrieb ablaufenden Prozesse des „Wirtschaftens“ aufgefasst werden kann (vgl. zur Diskussion der fachlichen (Re-)Konstitution der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Bank 2004, Kap. 2.1).
Die prägende Figur schlechthin ist im Themenfeld der Verhältnisse von „Wirtschaft“, „erziehen“, „wirtschaften“ und „Erziehung“ ursprünglich Karl Abrahams gewesen. Er hat als einer der Protagonisten unter jenen Berufs- und Wirtschaftspädagogen gewirkt, welche den Betrieb aus der Perspektive ihres Faches in den Blick genommen haben (Dies gilt bei allen Bedenken, die man gegen ihn sonst völlig zu Recht hegen mag. So fand Seubert hinreichend Anlass zur Feststellung, Abraham sei ein „Lobredner der nationalsozialistischen Ordnung“ gewesen (1977, 184 ff., hier 186). Auch andere Berufs- und Wirtschaftspädagogen sind zu ABRAHAM auf Distanz gegangen.). Aus diesem Grunde sollen von ihm vorgelegte Texte und die von ihm angestoßene Diskussion zur Betriebspädagogik zum Ausgangspunkt der Untersuchung gemacht werden, um dann in einem weiteren Schritt zu überlegen, welche Entwicklungslinien für eine Betriebspädagogik aufzuzeigen sind, die dem hier explizit formulierten erfahrungswissenschaftlichen Anspruch genügen können. Eine Annäherung an diese Fragestellung soll erfolgen, indem exemplarisch ein relevantes Problem der Betriebspädagogik herausgegriffen wird.
Dieses Vorgehen ist nicht zuletzt dadurch begründet, dass ein genereller Beitrag zum state-of-the-art bei der in jüngerer Zeit durchaus zu konstatierenden Zerfaserung der „Betriebspädagogik“ kaum im vorgegebenen Rahmen zu leisten ist: Die kontemporäre Betriebspädagogik zerfällt nach Beiträgen zur „Betriebspädagogik eo ipso “, zur „Personalentwicklung“, zur „betrieblichen Weiterbildung“ und neuerdings zur „lernenden Organisation“ nebst weiteren wechselnden metaphysischen Modeformeln. Angesichts dieser Polyvalenz nimmt es nicht Wunder, wenn es zu kritischen Einwänden gegen den subdisziplinären Anspruch der Betriebspädagogik kommt, etwa indem Huisinga & Lisop feststellen, dass „keine in sich geschlossene Teildisziplin“ vorläge (1999, 104), und Arnold in seinem Lehrwerk 1997 beklagt, dass es, „immer schwieriger [werde] ..., eine einheitliche Theorie betrieblicher Bildungsarbeit vorzulegen“ (8).
Bei einer Begrenzung auf eine textimmanente Betrachtung sind Abraham s Schriften wie das Pionierwerk „Der Betrieb als Erziehungsfaktor“ von 1953 wohl auch heute noch mit Gewinn zu lesen. Dies betrifft vor allem anderen den Gedanken, den Betrieb nicht bloß von seinen pagatorisch-betriebswirtschaftlichen Kategorien ausgehend wissenschaftlich zu betrachten. Damit ist er wohl der erste, der die von Geck formulierte Perspektive der „Bildung in einer Wirtschaftssphäre“ (1932, 17) in der Betrachtung des Betriebes über die wenig konkreten Vorstellungen der Spranger schen Kulturpädagogik hinausgehend formuliert hat.
Eine fruchtbare Relektüre betrifft namentlich auch jene Kernaussagen einer nunmehr für das betriebliche Geschehen aufgeschlossenen Berufs- und Wirtschaftspädagogik, dass die für den Betrieb typische funktionale Erziehung gleichfalls einem dezidierten, wenn auch nicht notwendig deklarierten erzieherischem Anspruch folgen kann. Zur Würdigung dieser Leistung ist es vielleicht nicht überflüssig darauf hinzuweisen, dass international die fachliche Diskussion einer informal education heute, ein halbes Jahrhundert später, auf ihren Höhepunkt noch hinstrebt.
Abraham würdigt die Erziehungsleistung des Betriebes in diachroner Hinsicht auf ein Geschichtsbild, in synchroner Hinsicht jene auf ein Ordnungsbild (1953, 28). Mit ihrer in diesem Sinne sozusagen naturbelassenen Ganzheitlichkeit könne dies ausdrücklich auch in affektiven und nicht nur ausschließlich psychomotorischen oder exklusiv kognitiven Lernkategorien im Sinne Bloom s geschehen. In diesen Punkten zumindest überschreiten Abraham und später 1971 noch deutlicher Alfons Dörschel in weitaus weniger mißverständlicher Form als Eduard Spranger (und mit ihm andere) jene Grenze, welche die Neuhumanisten Humboldt scher Prägung bewusst und ausdrücklich für das Feld der bildungsbewussten Erziehung abgesteckt hatten. Sie hatten jegliche ‚Brotbildung‘ ausdrücklich geächtet. Selbstverständlich muss im hermeneutischen Zugriff auf die Texte Abraham s auch unter dem Primat einer textimmanenten Betrachtung namentlich die historisch-kontextuelle Gebundenheit berücksichtigt und auf kontemporäre Problemstellungen und zeitgemäße Terminologie hin befragt werden. Dies kann man sich etwa so wie hier eben angedeutet vorstellen, denn der Begriffsapparat der Bloom schen Lernzieltaxonomien und Lernzielbereiche ( Bloom 1956, Bloom et al. 1964) stand Abraham ja noch nicht zu Gebot.
Legt man die Tatsache zugrunde, dass institutionale Bildung Ausdruck einer fortschreitenden funktionalen Differenzierung der Gesellschaft ist, so kann man mit der Ausdifferenzierung der Betriebspädagogik von einer Wieder entdeckung des Betriebs als Lernort sprechen – denn vor der Ausbildung spezialisierter Subsysteme, die ganz und ausschließlich der Erziehung gewidmet sind, war berufliches und weitgehend auch ökonomisches Lernen ja ohnehin Sache des Betriebes. Nunmehr aber kann man wissenschaftssoziologisch wohl mit Recht von einer „differentiellen Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ sprechen, die den Namen „Betriebspädagogik“ führt. Formal betrachtet macht sich deren Gründung auf die Verhältnisse von „Betrieb“ und „erziehen“ eben mindestens zwei Relationen des für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik konstitutiven Verhältnisfeldes zu eigen – in beiden Richtungen zu lesen als „Erziehen durch den Betrieb“ und „Erziehen für den Betrieb“ (vgl. oben; vgl. auch noch einmal Geck 1932). Es genügt dann, für diese Verortung den Betrieb als wirtschaftlich handelndes System oder Subsystem zu bestimmen – sicher keine sehr gewagte Annahme.
Nach der Wiederbegründung eines disziplinär geschlossenen Erkenntnisinteresses vermittels der schon von Geck begründeten Relationalitäten von Bildung (respektive Erziehung) und Wirtschaft (respektive Betrieb) soll nun aber der Betrieb ausdrücklich in einer erfahrungswissenschaftlichen Perspektive berufs- und wirtschaftspädagogisch untersucht werden.
Die Betrachtungsweise Abraham s, Dörschel s und letztlich auch Arnold s zu diesem Ende zunächst einmal wieder aufgegeben werden. Eine analoge Aufforderung zu einem solchen Schritt findet sich etwa in den Schriften zur methodologischen Erneuerung der Pädagogik bei Wolfgang Brezinka , zunächst 1968 in einem Beitrag zur „Zeitschrift für Pädagogik“, dann in seiner folgenreichen Monographie von 1971. Er bringt dies nach außen zum Ausdruck, indem er einen terminologischen Übergang vom Begriff der „Pädagogik“ auf den der „Erziehungswissenschaft“ vorschlägt, um die praktische Ausübung ebenso wie die spekulative Mutmaßung aus der Disziplin zu verbannen. Abraham s Betriebspädagogik – obzwar keineswegs ohne eigene Anschauung – hätte nach diesen Bestimmungen ihren Platz vermutlich nur als eine metaphysische, als eine spezielle Philosophie der Erziehung beanspruchen können.
Um den Betrieb im erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnisinteresse zu betrachten, sollen die Möglichkeiten eines solchen Zugriffs anhand eines Beispiels entworfen werden, welches im Zusammenhang eines Forschungsprogramms implementiert zu werden vermöchte. Dafür soll hier das diagnostische Problem der Betriebspädagogik in der Bildungsbedarfsanalyse gewählt werden.
Eine der unbezweifelbar zentralen Aufgaben, der sich die betriebliche Bildung zu widmen hat, ist die Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen, mithin die gezielte Aufhebung der funktionalen Ganzheitlichkeit der betrieblichen Abläufe (vgl. Müller 1975, 170 u. 175 (Zitiert nach Husinga & Lisop 1999, 106 (Beleg nicht rekonstruierbar).)). Diese temporäre Reinstitutionalisierung der Lernzusammenhänge entspricht der Einführung eines didaktischen Schutzraumes, den der Lernort „Betrieb“ sonst nicht gewähren kann. Die Verlagerung der individuellen Weiterentwicklung durch Institutionalisierung der Lehr- und Lernvorgänge macht indessen eine Legitimierung gegenüber dem im allgemeinen ausschließlich ökonomisch begründeten Oberziel eines Unternehmens notwendig, denn dieses wird direkt oder mittelbar an der Finanzierung dieser Bildungsmaßnahme beteiligt. Dem versucht die Betriebspädagogik vermittels einer Bedarfsanalyse nachzukommen.
Im Interesse der Verfolgung des ökonomischen Gewinnziels, der Betriebserhaltung oder vergleichbarer Vorgaben ergeben sich zwingend die folgenden Grundfragen der Bedarfsermittlung (vgl. so zuerst in Bank 2003, 155):
• Welche Beschäftigten erfüllen ihre Aufgaben infolge von Ausbildungsmängeln nur unzureichend? Also: Worin bestehen die Handlungsdefizite jetzt ?
• Welche Beschäftigte sollen woanders eingesetzt werden, werden mit neuen organisatorischen Verfahren oder technischen Gerätschaften konfrontiert und werden infolge dieser Veränderungen in Zukunft ihre Aufgaben nicht mehr zufriedenstellend ausfüllen können? Worin werden mithin die Handlungsdefizite zukünftig bestehen?
Während die erste Fragestellung die bereits eingetretenen Defizite ergründet und damit Weiterbildungsmaßnahmen auslöst, die unbezweifelbar den ökonomischen Vorgaben genügen, ergibt sich aus der zweiten Fragestellung ein Weiterbildungsbedarf, der in der Literatur mit Prädikaten von „avantgardistisch“ über „antizipativ“ bis „proaktiv“ bedacht wird (vgl. Döring 1988, 40; Arnold 1997, 49). Dies ist sicher etwas übertrieben, doch kann man nicht bezweifeln, dass auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine vorausschauende Analyse zu befürworten ist. Allerdings verschärfen sich für die proaktive Bedarfsanalyse die methodologischen Probleme erheblich.
In der Literatur zur Organisationspsychologie und zum Bildungsmanagement werden eine Reihe von diagnostischen Verfahren angeboten, um Antworten auf die Fragen der Bedarfsanalyse zu finden. Dazu gehören zum einen Verfahren der Prognose über Entwicklungen der Zuordnung von Beschäftigten und Stellen (z.B. Portfolioanalysen, vgl. Papmehl 1990; Skill-Board-Analysen, vgl. IBM/ Hofmann 1992), und zum anderen die Erstellung von Soll-Ist-Profilen (vgl. dazu ausführlich Bank 1997, 77 ff. sowie die dort verarbeitete Literatur).
Portfolioanalysen können überhaupt nur insoweit Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben, als die Form der graphischen Darstellung betroffen ist – denn die strenge graphische Transformation verschleiert eher die Form der mehr oder weniger intuitiven Datengewinnung. Die Profilanalysen arbeiten vor allem mit der Gegenüberstellung von Messgrößen einerseits des Stellenprofils und andererseits des Stelleninhabers. Alle Verfahren weisen indes einen gemeinsamen Pferdefuß auf: Die Festlegung der Merkmale wie der Merkmalsausprägungen sowohl für die Stellen als auch für die Beschäftigten sind rein subjektgebunden möglich. Ferner ist bezüglich eines Merkmals das Skalenniveau der Ordinalskala nur selten einmal zu überschreiten. Zusätzlich geht es fast immer um die Bestimmung latenter Größen, jedenfalls soweit die betroffenen Menschen Gegenstand der Diagnostik sind. Diese Überlegungen deuten darauf hin, dass eine erfahrungswissenschaftliche Umorientierung nicht nur zwei methodologischen Problemen gegenübersteht (Messvorgang, Messmodellierung), sondern auch einem weitreichenden epistemologischen Problem hinsichtlich der Objektivität des Erkannten.
Für den Pädagogen kann sich das Legitimitätsproblem betrieblicher Bildungsentscheidungen nicht in einer Antwort erschöpfen, die nur auf ein allenfalls nominal skaliertes Merkmal „rentabel“/ „nicht rentabel“ reagiert. In systemtheoretischer Hinsicht ist völlig klar, dass ein Beschäftigter nicht einfach ein hierarchisch eingegliedertes Subsystem des Systems „Betrieb“ ist, und damit eine Identität der Ziele bestünde – dafür brauchte man noch nicht einmal so weit zu gehen wie Luhmann, und die Menschen ganz aus dem sozialen System „Betrieb“ herauszudefinieren (vgl. 1984, 76 f.).
Der Pädagoge denkt vom Individuum ausgehend. Legitim ist in dieser Sicht eine Weiterbildungsmaßnahme genau dann, wenn sie – je nach wissenschaftstheoretischem Bekenntnis –
• einen Beitrag zu seiner individuellen Persönlichkeit leistet,
• seine Handlungsmöglichkeiten als mündiges Glied der Gesellschaft ausweitet oder
• seine Fähigkeiten stärkt, sich aus fremdbestimmten Abhängigkeiten zu befreien.
Die Frage des wirtschaftlichen Erfolges mag langfristig Bedingung sein – für die Entscheidung über die Anregung einer Bildungsmaßnahme ist sie jedoch auf dieser Ebene im Grundsatz gerade so irrelevant, wie es die pädagogischen Zielkategorien für die Weiterbildungsmanager in den Betrieben heute faktisch sind. Wollte man aber die Weiterbildungsbedarfsanalyse pädagogisch formulieren, dann müsste man fragen:
Welche Beschäftigten können ihre durchaus befriedigenden Leistungen zum Nutzen des Betriebes oder auch zu ihrem eigenen Frommen noch weiter ausbauen? Worin bestehen ihre Entwicklungschancen?
Schließlich mögen die pädagogische wie die betriebswirtschaftliche Sichtweise den betroffenen Beschäftigten völlig egal sein: ein solches zeigt schon ein flüchtiger Blick auf die Motivationstheorie (wie etwa von Heckhausen 1980 dargestellt). Die Motive der Beschäftigten können intrinsisch von sachlichem Interesse und thematischer Neugierde zum Bedürfnis reichen, die eigene Leistungsfähigkeit in den Produkten der Erwerbsarbeit zu entwickeln; sie können aber auch einfach extrinsischen Motiven wie Vermeidung von Arbeit, Vermeidung von Sanktionen, betrieblichem Aufstieg und ähnlichem folgen.
Diesbezüglich ist nüchtern festzustellen, dass eine sogenannte empirische „Bedürfnisanalyse“, die der Ermittlung der Weiterbildungsinteressen der einzelnen Beschäftigten eines Betriebes gelten, ebenso einfach in Form einer Befragung durchzuführen ist, wie die Qualität der Befragungsergebnisse vom Ausmaß der sozial erwünschten Antworten abhängt (vgl. auch hier Bank 1997, 186 ff. und die dort verarbeitete Literatur).
Es ist jedoch unbestreitbar, dass niemand anderes als der Inhaber einer Stelle besser darüber Auskunft geben kann, welche Weiterbildungsnotwendigkeiten sich für seine Arbeit ergeben. Und so nimmt es schon Wunder, dass nach meiner Kenntnis nur ein einziges Mal in der einschlägigen Literatur ein Versuch dargestellt wird, die möglicherweise stark interessenbedingte Verzerrung einer direkten Abfrage der Variablen zu vermeiden. Dies war 1982 im „Handbuch der Weiterbildung für die Praxis in Wirtschaft und Verwaltung“ bei Reinhard Leiter et al . Die von den genannten Autoren eingesetzte Fragetechnik lehnt sich nicht ausdrücklich, doch offenbar an das von Rensis Likert vorgeschlagene Messkonzept zur Ermittlung von Einstellungen an. Ihr Verfahren bezeichnen Leiter et al. als „personenbezogene Soll-Ist-Analyse“ mit „Problemvorgabelisten“ (30 ff.; vgl. die sog. „Likert-Skalen“ aus dem Jahre 1932 bei Schnell et al. 1995, 179, oder Anderson 1990 ).
Das Verfahren der Soll-Ist-Analyse mit Problemvorgabelisten sei kurz vorgestellt: Potentielle ‘Weiterzubildende' werden aufgefordert, bestimmte Aspekte ihres betrieblichen Handelns auf einer Ratingskala einzuschätzen, die fünfgeteilt zwischen „immer erfüllt“ und „im allgemeinen (!) nie erfüllt“ ist. Hierzu einige Beispiele aus entsprechenden Fragebögen:
Aus einer „einfachen Problemvorgabeliste“: |
„2. Sind Sie sich bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters relativ (!) sicher, was seine spätere Leistung und sein Verhalten betrifft? [...] 8. Kennen Sie die (!) Möglichkeiten der Mikroelektronik?“ ( Leiter et al. 1982, 30) |
Aus einer „detaillierten Problemvorgabeliste“: |
„1. Definieren Sie Ihre Ziele und den Grad Ihrer Zielerreichung in allen (!) Details exakt schriftlich? 2. Prüfen Sie, ob Ihre Zieldefinitionen Ihrer Meinung nach vollständig sind? [...] 5. Schöpfen Sie alle (!) Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aus, um das Ziel zu erreichen? 6. Kennen Sie nach Ihrem jetzigen Wissensstand alle (!) Gründe für die derzeitige Abweichung?“ ( Leiter et al. 1982, 31) |
Ein solcher, mehr oder weniger ‚handgestrickter‘ Fragebogen kann vor dem Begriff Brezinka s von erfahrungswissenschaftlicher Erziehungswissenschaft nicht bestehen, dessen Maßgeblichkeit für berufs- und wirtschaftspädagogische Probleme hier unterstellt wurde.
Weder lassen die Fragen eine operable Aussage über tatsächliche Handlungsdefizite zu, noch kann man davon ausgehen, dass die Bögen nicht im sozial erwünschten Sinne ausgefüllt werden. Die steten Aufweichungen der zu bewertenden Propositionen wie auch der Skala an sich durch Attribute wie „relativ“, oder „im allgemeinen“ erzwingen von dem Befragen die Setzung eines nicht zu offenbarenden subjektiven Referenzrahmens. Im Gegensatz dazu stehen sprachliche Verhärtungen wie „alle“ oder „vollständig“, die zu einer links- oder rechtsverschobenen Datenverteilung führen müssen. Inhaltlich ist zu kritisieren, dass die Betroffenen bei einigen Fragen das Ausmaß ihrer eigenen Unkenntnis zu beurteilen verstehen müssen: Taxonomisch betrachtet wird hier das Lernzielniveau der „Stufe der Evaluation“ als erreicht unterstellt, was es aber gerade doch herauszufinden gilt.
Nichtsdestoweniger sei Leiter s Versuch einer Annäherung als Anregung aufgenommen, sich mit erziehungswissenschaftlichem Anspruch der Bedarfsanalyse erneut zu stellen: Die Likert -Skala ist geeignet für die Untersuchung latenter Variablen, sie ist hinsichtlich eines Items kostengünstig einzusetzen, wenn auch die Abarbeitung der zur Messung einer oder gar mehrerer latenter Variablen notwendigen Fragebatterie insgesamt wiederum aufwendig ist.
Ziel einer solchen Befragung sei es, einen konkreten Weiterbildungsbedarf zu ermitteln, z.B. in Folge einer Unternehmensfusion . Dafür bedarf es zunächst der Erzeugung und operationalisierten Ausformulierung einer entsprechenden Hypothese, die dann zu prüfen wäre. Es wird etwa vermutet, dass bei einer bestimmten Mitarbeitergruppe wie den mittleren Führungskräften oder in einer bestimmten Abteilung Handlungsdefizite aufgetreten sind, welche die Durchführung einer Weiterbildungsmaßnahme bei den Betroffenen nahelegen. Diese Vermutungen mögen auf der Grundlage bestimmter Controllingdaten erwachsen sein, wie dem Ansteigen des Krankenstandes als Ausdruck einer Verweigerungshaltung, einem ‚aus-dem-Felde-gehen‘ nach einer Fusion. Das Abfallen des Gewinnbeitrages wird auch als naheliegender Indikator genommen.
Ohne eine erziehungswissenschaftlich verstandene Betriebsdiagnostik würden diese Daten allein schon aufgrund eines intuitiv positivistischen Weltbildes handlungsauslösend wirken – was heutzutage wohl den Normalfall in der betrieblichen Praxis darstellt. Da bei den „kritischen Rationalisten“, bei welchen die Erziehungswissenschaft paradigmatisch anknüpft, die Hypothesenbildung eigentümlich unbestimmt bleibt, würde gemäß der Konzeption der hypothesenbildenden Abduktion nach Peirce zu formulieren sein (vgl. dazu 1878, § 623):
[Regel] Alle Mitarbeiter mit Weiterbildungsbedarf sind ‚krank‘ (gehen ‚aus dem Feld‘)
[Ergbn.] Diese Mitarbeiter sind ‚krank‘ (statisch)
(dynamisch: ‚Der Krankenstand ist überraschend gestiegen‘)
[Beob.] Diese Mitarbeiter weisen einen Weiterbildungsbedarf aus.
Das Resultat wäre hypothetisch und bedürfte der Überprüfung. Nun müssen zwei weitere Schritte hinzukommen: Zum einen ist die Feststellung über das Vorliegen eines Weiterbildungsbedarfs auf eine bestimmte Person hin zu treffen, zum anderen ist der Forschungsauftrag durch Transformation auf der sprachlichen Ebene so zu operationalisieren, dass die Hypothese falsifizierbar wird. Als sogenannte Nullhypothese liest sich das als:
[H 0] Herr Ixx (Organisationsabteilung) hat Vorbehalte gegen die Fusion. Es besteht für ihn in diesem Punkt Weiterbildungsbedarf in affektiven Lernzieldimensionen.
Die Formulierung in dieser Weise hat zwei Gründe: (1) Hinsichtlich der Ermittlung des a-Fehlers ist es wahrscheinlicher, dass die Hypothese verworfen wird, als ihre Negation. Der a-Fehler hieße hier: H 0 trifft in Wahrheit zu (d.h. es gibt Weiterbildungsbedarf), wird aber aufgrund der Messung abgelehnt (d.h. es wird trotz Bedarfs keine Weiterbildung durchgeführt). (2) Es gilt, das Falsifikationsprinzip methodisch einzuhalten. Damit gibt es nur einen Bereich des ‚Nicht-Verwerfens‘, wobei in der negierenden Formulierung (Vorbehalte = keine Unterstützung) somit nicht klar wird, was zu tun ist. Wird sie nicht verworfen ist „Weiterbildung“ jedoch legitimiert, muss indes nicht zwingend durchgeführt werden.
Natürlich hätte man auf die Tatsache reflektieren können, dass im gewählten Beispiel einer Unternehmensfusion ein Weiterbildungsbedarf allein schon dadurch zu erwarten ist, dass z.B. in der neu gebildeten Organisationsabteilung für die eine Hälfte der Beschäftigten ein völlig anderes Verwaltungsprogramm zu bedienen sein wird. Bei diesen und ähnlichen Aufgabenstellungen jedoch ist in theoretischer wie praktischer Hinsicht klar, dass im Prinzip alle Betroffenen weiterqualifiziert werden müssen – die wenigen, die beispielsweise aus einem früheren Beschäftigungsverhältnis heraus mit dem neuen Programm vertraut sind, werden sich schon melden ... Wie für diesen kognitiven Fall sind auch die Lösungen für psychomotorischen Lernbedarf bei dem untersuchten Fusionsproblem nicht selten ähnlich offensichtlich und für den Praktiker handhabbar.
Im Gegensatz dazu sind die affektiven Komponenten des betrieblichen Handelns weder direkt zu beobachten, noch manifestieren sich etwaige Defizite unmittelbar. Zugleich weist die Fusionsforschung nach, dass ein wesentlicher Scheiterungsgrund von Fusionen gerade im Auftreten des sogenannten (Post-)Merger-Syndroms verborgen liegt (vgl. zur Fusionsproblematik Picot 2005; vgl. für die Merkmale des Post-Merger Syndroms Jaeger 2001, 52 ff, bes. 54, sowie Brockdorff & Kernstock 2001, 56). Das Merger-Syndrom zeigt sich in fusionsbedingtem Identitätsverlust, Autonomieschwund und Orientierungslosigkeit. Es ist damit naheliegend, eine Menge von Items zu formulieren, die auf der Grundlage eines Parametermodells die Nullhypothese testen.
Beispielsweise müssten die Items wie folgt formuliert sein, wobei die Anker (d.h. die vorgegebenen Antworttexte) – wie es Likert vorgesehen hat – auf einer fünfgliedrigen Ratingskala von „trifft vollständig zu“ über „trifft eher zu“, „trifft teilweise zu“, „trifft eher nicht zu“ bis „trifft gar nicht zu“ reichen.
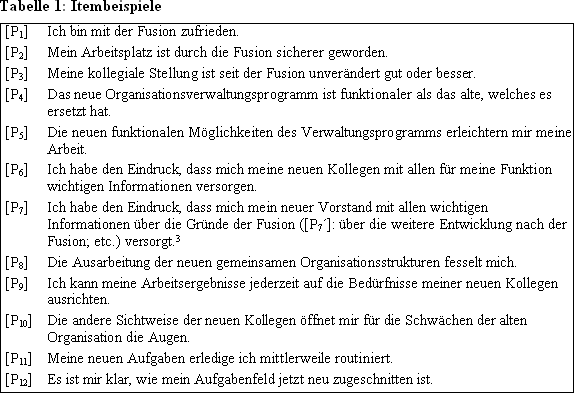
Bevor „Herr Ixx“ als Person untersucht werden könnte, müsste der Fragebogen methodisch überprüft werden. Die Items werden auf ihre Trennschärfe untersucht, indem der Trennschärfekoeffizient als das Maß der Korrelation zwischen Itembeantwortung und Gesamttestwert bestimmt wird. Damit würden letztlich nur die Items aufgenommen, die eine hohe Trennschärfe aufweisen. (Es ist darauf hinzuweisen, dass der Abschneidewert für die Entscheidung, was noch eben als „trennscharf“ gilt, nur subjektiv festzulegen ist.)
Es wird aber auch vorgeschlagen, mit einem t-Test zu prüfen, ob die Mittelwerte der Punktsummen der Probanden im oberen und im unteren Quartil signifikant verschieden sind. Obwohl die dafür nötige Annahme einer Student- oder Normalverteilung für die Grundgesamtheit nicht unplausibel ist, bleibt jedoch die bloß ordinale Datenstruktur inpraktikabel (es ist z.B. erforderlich, arithmetische Mittel zu errechnen). Möglicherweise kann man für die Datenstruktur eine Binomialverteilung unterstellen, die dann aber bei einer genügend feingliedrigen Unterteilung eine Annäherung an eine normalverteilte Datenstruktur erlaubte. Diese Approximation ist möglich, wenn Stichprobengröße n ? (1- ?) = 9 (d.h. bei ? = .5 ab n = 36 ; bei ?= .9 ab n = 100 ), wobei ? die Ereigniswahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses und n die Stichprobengröße darstellt (vgl. Bleymüller et al. 1998, 65). Hier aber ist die Wahrscheinlichkeit für Weiterbildungsbedarf und für keinen Bedarf ungleich verteilt – nach einer Fusion zugunsten der Weiterbildung, sonst zuungunsten der Weiterbildung.
Abschließend ist noch der Summenwert zu ermitteln, ab dem die Nullhypothese zu verwerfen wäre. Wird sie nicht verworfen, bedeutet dies, dass die Durchführung einer Weiterbildungsmaßnahme angezeigt ist. Die unterschiedlich beantworteten Items können bei der Lernzielformulierung für diese Maßnahme herangezogen werden.
Je nach Formulierung des Items kann jedoch noch eine weitergehende Spezifikation erforderlich werden. Wird zum Beispiel die Proposition [P 5 ] (Die neuen funktionalen Möglichkeiten des Verwaltungsprogramms erleichtern mir meine Arbeit.) mit der Antwort „trifft eher nicht zu“ oder mit „trifft teilweise zu“ bedacht, wäre noch zusätzlich herauszufinden, welche Programmteile lediglich auf kognitiver Ebene nicht hinreichend bekannt sind, oder welche davon konkret emotional abgelehnt werden. Allerdings besteht die Gefahr, dass durch diese doppelte Stoßrichtung in der Formulierung der Proposition das Item durch den Trennschärfetest fällt, nämlich dann, wenn ein kognitives, aber kein affektives Lernziel noch uneingelöst wäre.
Soweit die Skizze eines denkbaren erfahrungswissenschaftlichen Zugriffs auf den „Betrieb“ als berufs- und wirtschaftspädagogisches Erkenntnisinteresse. Eine mögliche nähere Bestimmung des Erkenntnisinteresses bestünde exemplarisch somit darin, Itembanken zur Bestimmung des Bedarfs an betrieblicher Bildung zu entwerfen und zu validieren. Auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse wäre dann eine weitere Aufgabe der Berufs- und Wirtschaftspädagogik, die entsprechenden curricularen Entwürfe für betriebliche Weiterbildung durchzuführen.
Ein erfahrungswissenschaftlicher Zugriff auf das Erkenntnisobjekt „Betrieb“ erfordert nach der hier vorgestellten Auffassung mithin (1) eine kontrollierte Hypothesenbildung – auch unter Nutzung der im Sinne Brezinka s als ‚spekulativ‘ apostrophierten Ergebnisse der Betriebspädagogik. Es bedarf (2) eines sorgfältig ausgearbeiteten methodischen Zugriffs auf das empirische Relativ. Es ist (3) die Begrenztheit der Methoden der empirischen Sozialforschung anzuerkennen, um die Validität der Interpretation der Ergebnisse nicht zu gefährden.
Die wesentlichen Kritikpunkte, die ich an den Konzepten des Bildungscontrollings geübt habe (vgl. Bank 1997 u.ö.), bleiben dem Grunde nach auch hier bestehen: Die Rationalität der Entscheidung im Sinne einer Reduktion subjektiver Willkür wird nicht substantiell hergestellt, sondern nur graduell angenähert. Dieses ist durch eine Vergrößerung des Aufwandes, hier eine Ausdifferenzierung der inhaltlichen Bezüge der Propositionen, sicher zu verbessern (vgl. dazu Cronbach & Gleser 1965 unter dem Stichwort des bandwidth-fidelity-dilemma ). Zu vermuten ist indessen auch hierfür die Gültigkeit des Gossen schen Gesetzes vom abnehmenden Grenznutzen (vgl. Gossen 1854, 4 f.): Mit zunehmender Menge an erhobenen Daten nimmt deren jeweiliger Grenznutzen ab. Das Bemühen um eine detailgenaue Erfassung bedroht folglich die Ökonomität des Messvorgangs (vgl. Jongebloed 2005, 350).
Ein solches aber hat wiederum Brezinka der Wissenschaft erlaubt: Mit der fachlichen Trennung von der Praxis, in anderen Worten mit dem Verzicht, sogleich und unmittelbar der Praxis dienlich sein zu müssen, können in der Forschung auch Lösungsansätze untersucht werden, die zumindest prima vista allenfalls zu unökonomischen Ergebnissen führen. Dergestalt wird eine erfahrungswissenschaftliche Betrachtung des Betriebes die bisher weitgehend geisteswissenschaftlich betriebene Betriebspädagogik im doppelten Sinne überwinden (Überwinden: i.S.v. besiegen; vor allem aber i.S. des Erreichens eines höheren Niveaus, indem man etwas hinter sich oder unter sich lässt. ) können.
In jedem Fall muss für die Interpretation der Ergebnisse der Mensch das Maß aller Dinge bleiben – und in diesem Punkte ist die kritisch-rationale Ablehnung des Normativen nicht zu teilen, die nach der paradigmatischen Schrift Brezinka s auch für die kritisch-rational betriebene Wissenschaft zu gelten habe:
„Werturteilsfreiheit ... erleichtert es, wissenschaftliche Satzsysteme von weltanschaulichen Bekenntnissen freizuhalten. Sei hat jedoch nichts mit einer Geringschätzung von Wertungen, Normen und Weltanschauungen zu tun. [...] Sie dient nur dazu, die Wissenschaft gegenüber den zwangsläufig weltanschaulichen Satzsystemen, die aus solchen Versuchen hervorgehen, abzugrenzen.“ ( Brezinka 1978, 77).
Auch sie bedarf des von ihr als ‚vorwissenschaftlich‘ bezeichneten Zugriffs auf Normen – wenn schon nicht bezüglich des Erkenntnisobjektes, so doch bezüglich des verfolgten wissenschaftlichen Interesses. Eines ist in jedem Falle zu bedenken zu geben: Die Likert -Skala – wird sie nur hinreichend kryptisch angewandt – eignet sich vorzüglich nicht nur zum Aufspüren von Weiterbildungsbedarf, sondern auch als Instrument der innerbetrieblichen ‚Gedankenpolizei‘:
„Eine ... [erfahrungswissenschaftlich; Erg. aus dem voranstehenden Absatz] verstandene Betriebspädagogik wird zur Sozialtechnologie (oder exakter: zur Sozialtechnokratie), die über Objektivierung der betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozesse, über die damit verbundene Instrumentalisierung der Vernunft die technische Verfügungsgewalt derjenigen erhöht, die auf der Basis dieser Informationen ... in diese Entscheidungsprozesse steuernd ... einzugreifen trachten.“ ( Müller 1973, 181; im Original mit Hervorhebungen).
Technokratischen oder totalitaristischen Konzepten in betrieblichen oder auch anderen Kontexten Handreichungen zu bieten, stellt fraglos ein schwerwiegendes Verantwortungsproblem für alle Wissenschaft dar. Dieses sollte stets bewusst gehalten werden.
Abraham , K. ( 2 1957): Der Betrieb als Erziehungsfaktor. Die funktionale Erziehung durch den modernen wirtschaftlichen Betrieb (Wirtschaftspädagogische Schriften, Band 3). Freiburg i.Br.
Abraham , K. (1978): Betriebspädagogik. Grundfragen der Bildungsarbeit der Betriebe und der Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft. Berlin .
Anderson , L.W. (1990). Likert-Scales. In: Walberg , H.J. & Haertel , G.D. (Hg.), The International Encyclopedia of Educational Evaluation. Oxford u.a., 334-335.
Arnold , R. ( 2 1997): Betriebspädagogik (Ausbildung, Fortbildung, Personalentwicklung, Band 31). Berlin.
Bank , V. (1997): Controlling in der betrieblichen Weiterbildung. Über die freiwillige Selbstbeschränkung auf ein zweckrationales Management quasi-deterministischer Strukturen (Wirtschafts-, Berufs- und Sozialpädagogische Texte, Band 27). Köln.
Bank , V. (2003): Problems of Planning and Control in Educational Processes . In: Oelkers , J. (Hg.): Futures of Education II, Essays from an Interdisciplinary Symposium . Frankfurt a.M. u.a., 151-175.
Bank , V. (2004): Von der Organisationsentwicklung zum „systemischen Change Management“. Der Umgang mit Innovationen als didaktisches Problem der Führung in sozialen Systemen (Moderne der Tradition, Band 2). Kiel u. Norderstedt.
Bleymüller , J., Gehlert , G. & Gülicher , H. ( 11 1998): Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. München: Vahlen.
Bloom , B.S. (Hg.; 1956): Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain. New York .
Bloom , B.S., Krathwohl, D.R. & Masia, B.B. (1964): Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals, Handbook II: Affective Domain. New York .
Brezinka , W. (1968): Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft. Vorschläge zur Abgrenzung. In: Zeitschrift für Pädagogik 14 (1968), Nr. 5, 435-475.
Brezinka , W. (1971): Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft, Weinheim u.a.
Brockdorff, B . & Kernstock, J. (2001): Brand Integration Management – Erfolgreiche Markeneinführung bei Mergers & Acquisistions. In: Thexis 4/ 2001, 54-59.
Cronbach, L.J. & Gleser , G.C. ( 2 1965): Psychological Tests and Personnel Decisions. Urbana u.a.
Döring , K. (1988): Weiterbildung im System. Zur Professionalisierung des quartären Bildungssektors (Neuausgabe). Weinheim.
Dörschel , A. (1975): Betriebspädagogik (Ausbildung und Fortbildung, Band 11). Berlin.
Geck , L.H.A. (1932/ 1967): Zur Grundlegung der Wirtschaftspädagogik. In: Röhrs, H. (Hg.): Die Wirtschaftspädagogik – eine erziehungswissenschaftliche Disziplin? (org. in: Zeitschrift für Handelsschulpädagogik 4 (1932), 145-158 u. 220-231). Frankfurt a.M., 16-35.
Gossen , H.H. (18 54/ 1967): Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln (Reproduktion des Originals: Braunschweig 1854). Amsterdam.
Heckhausen , H. (1980): Motivation und Handeln. Lehrbuch der Motivationspsychologie Berlin u.a.
Hofmann , L. (1992): Qualifikationsplanung in der IBM Deutschland – Schlüssel einer erfolgreichen Personalentwicklung. In: von Landsberg , G. & Weiß , R. (Hg.): Bildungs-Controlling. Stuttgart, 77-93.
Huisinga , R. & Lisop, I. (1999): Wirtschaftspädagogik. Ein interdisziplinär orientiertes Lehrbuch. München.
Jaeger , M. (2001): Personalmanagement bei Mergers & Acquisieitions. Neuwied und Kriftel.
Jongebloed , H.-C. (2005): Die Messung schulischer und betrieblicher Leistungen in bildungsökonomisch-modellhafter Sicht. In: Bank , V. (Hg.): Vom Wert der Bildung. Bildungsökonomie in wirtschaftspädagogischer Perspektive neu gedacht. Bern u.a., 331-353.
Leiter , R., Runge , Th., Burschik , R. & Grausam, R. (1982): Der Weiterbildungsbedarf im Unternehmen. Methoden der Ermittlung, (Handbuch der Weiterbildung für die Praxis in Wirtschaft und Verwaltung, Band 2), München.
Müller , K.R. (1973): Entscheidungsorientierte Betriebspädagogik. Die Erforschung von Erziehungsproblemen in Betrieben. München u. Basel.
Papmehl , A. (1990): Personal-Controlling. Human-Ressourcen effektiv entwickeln, (Arbeitshefte Personalwesen, Band 19), Heidelberg
Peirce , Ch. S. (1878/ 1932): Element of Logic (Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vol. 2.). Cambridge / MA: Harvard University Press.
Picot , G. (Hg.; 3 2005): Handbuch Mergers & Acquisitions. Planung –Durchführung – Integration. Stuttgart: Schäfffer-Poeschel.
Preyer, K. (1978) : Berufs- und Betriebspädagogik. Einführung und Grundlegung. München u. Basel.
Schnell , R., Hill , P.& Esser , E. ( 5 1995). Methoden der empirischen Sozialforschung. München u. Wien.
Seubert, Rolf (1977) : Berufserziehung und Nationalsozialismus. Das berufspädagogische Erbe und seine Betreuer (Berufliche Bildung und Berufsbildungspolitik, Band 1). Weinheim u. Basel: Beltz.