|
| ||



Betriebliche Weiterbildung in den 1920er und 1930er Jahren war das Ergebnis eines längeren kontinuierlichen historischen Prozesses, in dessen Verlauf sich das betriebliche Interesse an einer weitgehenden Selbstversorgung mit Qualifikationen der Mitarbeiter und an einem Medium umfassender betriebsinterner arbeitskräftepolitischer Strategien durchgesetzt hat (vgl. Büchter 2002).
Verschiedene Impulse wirkten seit Ende des 19. Jahrhunderts auf die allmähliche industriebetriebliche Ausgestaltung von solchen Erziehungs- und Bildungsformen, die von betriebsexternen Zugriffen weitgehend abgeschirmt, unbürokratisch gestaltet, ausschließlich von Betrieben gesteuert werden konnten und auf den betrieblichen Bedarf zugeschnitten waren:
• sozialpolitische und bildungsökonomische Erwägungen und Initiativen der Industrie sowie ihre Aufmerksamkeit gegenüber Erziehung und Bildung von Beschäftigten als Medium zur Sicherung ihres politischen und ökonomischen Einflusses (vgl. Baethge 1970; Görs 1999);
• die Funktionalisierung von an Industriearbeit geknüpfter Erziehung und Bildung als Symbolform, um die Verbindung zwischen dem autonomen industriellen Agieren, dem Volkswohl und der „Volksgemeinschaft“ zu legitimieren und zu unterstreichen;
• ein industriespezifischer Qualifikationsbedarf; dieser hat einerseits die Anfänge industrieller Ausbildung im 19. Jahrhundert begründet, andererseits suchten Betriebe – angesichts des Kosten- und bürokratischen Aufwandes bei der Erstausbildung (vgl. Tollkühn 1926, 6) – nach unaufwendigen Modi der Qualifikationsversorgung;
• die Ausdifferenzierung betriebsspezifischer Tätigkeiten und Positionen infolge komplexer, hierarchisch gegliederter Organisationsstrukturen, von Lohndifferenzierungen nach Anforderung und Leistung und die „vertikale Beweglichkeit der Arbeitskraft“ im Betrieb ( Schumpeter 1916, 67); zudem war die industrielle Nutzung unterschiedlicher Optionen beim Technikeinsatz und bei der Gestaltung von Arbeitsorganisationen ein entscheidender Auslöser für die Heterogenität in der Qualifikationsstruktur im industriellen Vergleich, die nur durch betriebsspezifische Qualifizierungsprozesse (re-)produziert werden konnte;
• der Ausbau betriebsinterner Arbeitsmärkte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (vgl. Lutz 1984, 64f.), in dessen Kontext betriebliche Weiterbildung neben der Leistungswirtschaft, der Entlohnung und Sozialpolitik zu einem Instrument der nach außen hin relativ abgeschirmten, unter betrieblicher Eigenregie verfolgten Strategie der Arbeitskräftepolitik wurde. Aus dieser Sicht trug (und trägt) betriebliche Weiterbildung zur Sicherung betrieblicher Autonomie und Bindung bestimmter, in der Regel schwer ersetzbarer Belegschaftsgruppen an den Betrieb bei;
• die Sozialpolitik und die Vergemeinschaftungsstrategien (vgl. Krell 1994) der Industrie, in die betriebliche Weiterbildung als ausbildungsübergreifende Form der Interessenharmonisierung und der Erziehung zur „Werks-“ und „Volksgemeinschaft“ einbezogen wurde.
In diesem Beitrag soll ein Einblick in die Praxis betrieblicher Weiterbildung zur Zeit der Weimarer Republik gegeben werden. Dabei stehen die Aspekte Betriebsorganisation, Arbeitsteilung und Qualifikationsbedarf, Weiterbildung im Kontext betrieblicher Personalpolitik und vor dem Hintergrund der „Verschulung Deutschlands“ im Vordergrund, bevor im Einzelnen auf Funktionen und Formen betrieblicher Weiterbildung eingegangen wird.
Im Innern der Industriebetriebe fan den in mehr oder minder systematisierter Form unterschiedliche fachliche Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte aus dem kaufmännischen und technischen Bereic h statt.

Seit der Industrialisierung hat sich in den Betrieben eine Reihe an organisatorischen Veränderungsprozessen vollzogen, denen eine Auffächerung von Positionen und Tätigkeiten folgte. Mit dem Wachstum der betrieblichen Organisationen, dem Ausbau der Bürokratien, der Arbeitsteilung und den veränderten Kooperationsformen in der Hierarchie trat quer zur skalaren Ordnung (Lehrling-Geselle-Meister) von Positionen die „funktionale Differenzierung“ ( Dahrendorf 1965), die durch wissenschaftliche Vorschläge zur Rationalisierung von industrieller Arbeit und Verwaltung zu Beginn des 20. Jahrhunderts forciert wurde. Kennzeichnend für die funktionale Differenzierung war eine zunehmende Vielfalt an Positionen (z. B. Ingenieure, Betriebsbeamter, Werkmeister, Facharbeiter, Vorarbeiter, Werkhelfer, u.ä.), deren Ausübung nicht durch eine einfache Übernahme der Tätigkeit nach Eintritt in den Betrieb und durch eine einmal abgeschlossene Berufsausbildung gewährleistet werden konnte. Das für die Großindustrie der Weimarer Republik charakteristisch werdende „aufgaben-diskontinu ierliche Status-System“ ( Offe 1970, 24) war gekennzeichnet durch eine Heterogenität von Arbeitsfunktionen und Qualifikationen in horizontaler und vertikaler Rangfolge. Für die Industrie hatten die funktionale Differenzierung und die aufgaben-diskontinuierliche Status-Organisation nicht nur den Effekt, betriebliche Abläufe und Kommunikationsprozesse im Zuge des Wachstum der Betriebe zu rationalisieren, sondern die Differenzierung von Positionen und Funktionen förderte zudem den Prozess der „Re-Individualisierung bzw. Vereinzelung sozialer Beziehungen und Strukturen, um dem Problem der Vermassung der Arbeiterschaft in Fabrikhallen, Mietskasernen und politischen Versammlungen, die als Nährboden für soziale Unruhen angesehen werden, zu begegnen“ ( Staehle 1989, 15).
Besonders im Produktionsbereich haben sich unterschiedliche Aufgabenfelder und Qualifikationen mit enger Bindung an den Betrieb herauskristallisiert. Dies zeigt sich am Beispiel einzelner Industriezweige (vgl. Schudlich 1994), besonders in der Hütten- und Metallindustrie, die über zahlreiche „Spezialarbeiter“ verfügten. Konnten beispielsweise noch die Metallgrundberufe in einer handwerksmäßigen Lehre gelernt werden, so konnte die Ausbildung für die qualifizierten Spezialberufe nur an den Maschinen selbst stattfinden und war damit auf den Industriebetrieb beschränkt (vgl. Homburg 1991, 97).
Die Betriebsspezifizität der Qualifikationsstruktur und die damit einhergehende „Illiquidität von individuellem Arbeitsvermögen“ ( Offe 1970, 22) spezialisierter Arbeiter waren Ausdruck von unterschiedlichen Produktionsanforderungen und -bedingungen, verschiedenen technischen Möglichkeiten und arbeitspolitischen Strategien im zwischenindustriellen Vergleich. Dies führte dazu, dass die Zahl und der Grad qualifizierter Arbeit, die quantitative Relation zwischen gelernter, spezialisierter, angelernter und ungelernter Tätigkeit zwischen unterschiedlichen Industriezweigen variierten. Waren in bestimmten Industriebereichen überwiegend Strategien der Arbeitszerlegung und Dequalifizierung, wie z. B. die in der Textil- und Chemieindustrie, anzutreffen, setzten andere Industriezweige auch darauf, durch den Einsatz einer größeren Anzahl gelernter und spezialisierter Beschäftigter „Qualitätsarbeit“ zu leisten und hierdurch am Markt zu bestehen. Selbst innerhalb einer Branche, im zwischenbetrieblichen Vergleich, fielen Qualifikationsdifferenzierungen unterschiedlich aus (vgl. Homburg 1991, 142). Auch innerhalb eines Industriebetriebes existierten verschiedene technische Reifegrade, Formen der Produktion und Arbeitsorganisation nebeneinander. So trat die industrielle Fertigung zwar immer massiver neben die handwerksmäßige, die Maschinenarbeit ersetzte diese in einigen Bereichen, eliminierte sie jedoch nicht zwangsläufig. Anders: Veränderte Arbeitstechniken und Arbeitsorganisationen führten zwar in der Regel zu Veränderungen in der Qualifikationsstruktur der Belegschaften, jedoch betrafen diese Entwicklungen nicht jeden Arbeitsbereich bzw. -platz zur gleichen Zeit und in gleicher Weise, und deren Ergebnisse ließen sich nicht auf einen Nenner bringen. In unterschiedlichen Betriebsbereichen und Abteilungen gab es innerhalb der Gruppen der Gelernten und Un- und Angelernten eine Vielzahl an Abstufungen der Qualifikationen.
Die komplexe industriebetriebliche Qualifikationsstruktur wurde dadurch begünstigt, dass in vielen Großbetrieben neben der Hauptproduktion einige Subabteilungen bzw. „Nebenbetriebe“ mit Beschäftigten unterschiedlicher Aufgabenbereiche und Qualifikationen zu finden waren. Deutlich wird dies am Beispiel der Farbenfabriken Bayer Leverkusen, die neben der chemischen Produktion ein Konglomerat verschiedener, der chemischen Herstellung zuarbeitender Satellitenindustrien umfassten. So gab es hier eigene Kaianlagen, eine eigene Fabrikbahn, Wasserwerk, Gasfabrik und elektrische Gaszentrale. Ferner eine eigene Buchdruckerei und -binderei, eine Kartonagenfabrik, Bücherfabrik, Küferei und Holzbearbeitungswerkstätten, in denen die benötigten Behälter produziert wurden. Zudem gab es noch Metallbearbeitungswerkstätten, in denen die chemischen Anlagen installiert und repariert wurden (vgl. Stolle 1980, 26). Neben den Chemiearbeitern waren dort „Hafen- und Kranarbeiter, Lokomotivführer, Rangierer, Heizer, Maschinisten, Buchdrucker und -binder, alle Arten von Holzarbeitern und Zimmerern, Anstreicher, Schlosser, Dreher, Fräser, Zuschläger, Bleilöter, Installateure und Transportarbeiter der Ladekolonnen, Lagerarbeiter der Farben- und technischen Läger [beschäftigt]. Zusätzlich gab es noch Kehrer, Boten, Kaffeestubenwärter, Sicherheitsdienstler und Feuerwehrleute, die als Werkschutz fungierten“ (ebd.). In den unterschiedlichen Abteilungen der eigentlichen Chemieindustrie, der Anorganischen Abteilung, der Zwischenprodukte-, Farben- und Pharmaabteilung, waren jedoch überwiegend un- und angelernte Arbeiter beschäftigt, die sich aber auch nicht einfach in diese zwei Untergruppen unterteilen ließen, sondern innerhalb dieser Gruppe existierte eine breit gefächerte Differenzierung: „So entstanden z. B. in den ‚kontinuierenden', großchemischen Betrieben der Anorganischen Abteilung, auf Grund der dort weit fortgeschrittenen Mechanisierung, neben niedrigen auch anspruchsvollere Qualifikationsanforderungen als z. B. in den Farbenbetrieben. In den Farbenbetrieben können Arbeiter kaum nach verschiedenen Funktionen unterschieden werden, sondern höchstens, und auch das ist recht problematisch, nach dem Grad der Einarbeitung in identische Funktionen“ (27). Deutlich wird hieran, dass selbst in der chemischen Industrie, die in der Weimarer Republik zu den Industriezweigen mit hohem Anteil Geringqualifizierter gehörte, eine überaus komplexe Qualifikationsstruktur anzutreffen war, mit der betriebsspezifische Qualifizierungsprozesse verbunden waren.
Aufgrund der funktionalen Differenzierung und der betriebseigenen Produktionsökonomie und -gestaltung, Aufgaben- und Qualifikationsschneidung gab es kaum qualifizierte Tätigkeiten, für die ausschließlich betriebsextern, etwa in Anlernungsprozessen in anderen Betrieben, in einer Erstausbildung oder im Ingenieurstudium erworbene Qualifikationen genügten. Unterschiedliche Formen betrieblicher Weiterbildung erfüllten vor diesem Hintergrund die Funktion eines betrieblich gesteuerten Regulativs bzw. Scharniers zwischen dem individuellen Qualifikationsvermögen der Beschäftigten und den betriebsspezifischen Qualifikationsanforderungen (vgl. Büchter 1999, 45).
Die Arbeitgeber waren auf die betriebsspezifische kontinuierliche Qualifizierung von Beschäftigten angewiesen, förderten daher die breitere, geschweige denn überbetriebliche Anwendbarkeit der Qualifikationen nicht, sondern offerierten ausgewählten, betrieblich qualifizierten und erfahrenen Arbeitern innerbetriebliche Karrieremöglichkeiten.
Die Strategie der Rekrutierung von Personal für höhere Positionen über betriebliche Weiterbildung bzw. der Steuerung von betriebsinternen Karriereleitern, die wesentlich von der Entscheidungsmacht der Vorgesetzten abhing, war in den 1920er Jahren ein zentraler Bestandteil der Werksgemeinschaftspolitik. Dank der Kombination – arbeits- und betriebsspezifische Qualifizierung und Aufstieg über betriebsinterne Karriereleiter - konnte in einigen Industriezweigen die regulierte Ausbildung für Facharbeiterberufe umschifft, in Betrieben, in denen die industrielle Ausbildung bereits zu einem festen Bestandteil betrieblicher Qualifizierungspolitik gehörte - wie im Maschinenbau, der Metall- und Elektroindustrie (vgl. Greinert 1998, 65) - wesentlich ergänzt werden. Ein Vorteil dieser Äquivalenzlösung lag aus der Sicht der Industrie nicht nur in der raschen, unbürokratischen und kostengünstigen Form der Qualifikationsbeschaffung, gleichzeitig konnte damit die Bezahlung nach Facharbeiter-Lohn umgangen werden, ohne dass Betriebe auf fachlich qualifizierte Beschäftigte verzichten mussten. Zudem „bewahrten sich die Unternehmungen die Kontrolle über ihre Arbeiter. Denn nur eine offiziell anerkannte, abgeschlossene Ausbildung konnte der Arbeiter als erworbenen Anspruch behaupten“ ( Zollitsch 1990, 60). Auch war es möglich, dass Arbeiter aufgrund von Anlernung und daran anschließender umfassenderer Weiterbildung und von Erfahrungen in, bezogen auf Anforderungen und Qualifikationsniveau, dem Facharbeiterstatus vergleichbare betriebsgebundene Funktionsgruppen hineinwuchsen. So konnte – wie in der Chemieindustrie – mit einer äußerst geringen Zahl an Arbeitern mit regulärer Ausbildung eine qualifizierte Stammbelegschaft entstehen (vgl. 47).
Solche spezialisierten Qualifikationsgruppen mit quasi Gelerntenstatus fanden sich auch in anderen Industriezweigen (vgl. Muth 1985; Hachtmann 1989; Schudlich 1994). Dieser Politik des Arbeitereinsatzes und der betriebsspezifischen Qualifizierung entsprach es, dass die industrielle Beteiligung an der Erstausbildung insgesamt betrachtet schleppend verlief. Die Lehrlingsbildung bildete nur einen kleinen Teil im Gesamt der betrieblichen Personal- und Qualifizierungspolitik. Selbst am Ende der Weimarer Republik hatte die industrielle Lehrlingsausbildung nicht das Niveau erreicht, was die Arbeitgeber einige Jahre zuvor in Aussicht gestellt hatten (vgl. Schütte 1992, 61f.). Hingegen gab es Qualifizierungsprozesse für unterschiedlich Vorqualifizierte, sei es in Form von Anlernkursen, Aufbaukursen, Lehrgängen, Vorträgen, Arbeitsgemeinschaften bis hin zu „Studiengängen“ an Werkfach- oder -hochschulen.
Aufgrund der Auswahl von Teilnehmern durch Vorgesetzte und die Zuweisung von Karriere- und Statuschancen reproduzierte betriebliche Weiterbildung die Beschäftigtensegmentierung. Sie war ein wesentliches Instrument betrieblicher Stammarbeiterpolitik.
Seit der Hochindustrialisierung bestand ein besonderes Ziel betrieblicher Sozialpolitik darin, die erfahrenen, qualifizierten und loyalen Arbeiter im Betrieb sesshaft zu machen (vgl. Kaelble 1983, 84). Alfred Krupp legte aus diesem Grund Wert darauf, dass das Eintrittsalter der ersten Generation nicht zu niedrig ausfiel und damit die Neigung zum Betriebswechsel gering war. Die darauf folgende Generation sollte frühzeitig durch sozialpolitische Maßnahmen an den Betrieb gebunden werden (vgl. Schmiede 1994, 78f.).
Die Bedeutung eines Arbeiterstammes wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den unterschiedlichen Industriezweigen häufiger betont (vgl. Schudlich 1994, 90ff.) und fand ihren praktischen Ausdruck „in dem außerordentlich hohen Durchschnittsalter und der starken Besetzung der höheren Altersgruppen“ (90). Die betriebliche Relevanz des längerfristig beschäftigten Arbeiterstamms lag nicht nur in seiner sozialen Betriebsverbundenheit, sondern auch darin, dass seine Mitglieder über jene Qualifikationen verfügten, die auf dem externen Arbeitsmarkt selten oder nicht zur Verfügung standen.
Die Mitglieder der Stammbelegschaft bildeten eine wichtige Zielgruppe in der betrieblichen Weiterbildung. So handelte es sich bei der betrieblichen Weiterbildung bei Siemens „um ein Maßnahmebündel, das auf berufserfahrene, beständige bzw. ‚sesshafte' Arbeitskräfte [...] zugeschnitten war. Die Leistungen waren zwar als generelles Angebot formuliert, blieben aber durch besondere Zugangsvoraussetzungen und/oder interne, meist mehrstufige Selektion des Empfängerkreises letztlich auf eine relativ kleine Gruppe von Beschäftigten beschränkt. Sie zielten aufgrund ihres spezifischen Charakters insbesondere auf die Herausbildung und Förderung einer betriebsbezogenen, leistungsmotivierten und hochqualifizierten Stammarbeiterschaft“ ( Homburg 1991, 594).
Aufgrund der personalpolitischen Strategie, bestimmte Beschäftigte, die über jene für die Betriebe unverzichtbaren Verhaltens-, Wissens- und Erfahrungsressourcen verfügten, an sich zu binden, wurde es den Bewerbern auf dem externen Arbeitsmarkt, der großen Gruppe der Arbeitslosen, erschwert, Eingang in das reguläre Beschäftigungssystem zu bekommen, es sei denn, sie besaßen aufgrund ihrer Ausbildung und beruflichen Erfahrungen jene speziellen Qualifikationen, die ein Betrieb gerade suchte. Oder aber sie konnten aufgrund eines betrieblichen Bedarfs an Ungelernten vorübergehend auf nicht anspruchsvolle, instabile Arbeitsplätze gelangen. Vielmehr trachteten Betriebe aber danach, sich personalpolitisch weitgehend selber zu versorgen und anhand ihrer Definitionsmacht über Selektions- und Rekrutierungskriterien auf dem internen Arbeitsmarkt nach außen hin abzuschirmen. Arbeitslose wurden so lange wie möglich von der betriebsinternen Arbeitsmarktpolitik und Schließungsstrategie ausgegrenzt.
Das Interesse der Wirtschaft, d.h. der Einzelbetriebe sowie ihrer Verbände und Körperschaften, daran, ihre Position „gegenüber den Ansprüchen eines sich zunehmend ausprägenden Interventionsstaates und in Auseinandersetzung mit den sozial- und bildungspolitischen Forderungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen“ ( Gladen 1979, 57) zu behaupten, fand seinen Ausdruck in Bemühungen um die weitgehende Selbststeuerung in der Personal-, Sozial- und Berufsbildungsverwaltung und -organisation, der Weiterbildungsangelegenheiten subordiniert waren.
Die staatlichen Anstrengungen zur Regulierung des Arbeitsmarktgeschehens, staatliche Appelle an die industrielle Unterstützung bei der Beseitigung des Arbeitslosigkeitsproblems und die Anforderungen an die Gestaltung beruflicher Bildung sowie die arbeits- und lohnpolitischen Forderungen der Gewerkschaften waren Herausforderungen für die Autonomie der Unternehmer im Hinblick auf die freie Verfügung über den Produktionsfaktor Arbeit.
Die Industrie reagierte auf diese Herausforderungen auch mit Neuansätzen und Umstrukturierungen der Personalarbeit und -verwaltung. Die ersten wirtschaftlichen Betriebslehren (vgl. z. B. Dietrich 1914; Nicklisch 1922; Seyffert 1922), die sich mit dem „Mensch im Betrieb“ und Fragen der „Menschenwirtschaft“ auseinandersetzten, gaben der betrieblichen Personalpraxis weitere Impulse. Konsens bestand darin, dass die Personalarbeit der wichtigste Kern der Gemeinschaftsbildung im Betrieb wäre, und dass diese mit ihren unterschiedlichen Aufgabenfeldern dafür zu sorgen hätte, die Leistung der Arbeitskräfte aufrechtzuerhalten und zu fördern, Konfliktpotential in der Belegschaft auszuschalten und die betriebliche Ordnung zu sichern.
Die Betriebe der Kernindustrie besaßen bereits in der Weimarer Republik institutionalisierte Personalabteilungen mit hauptamtlichen Beschäftigten. Zu den zentralen Aufgaben gehörten personalrechtliche, lohnpolitische und andere Verwaltungsaufgaben. In zusätzlichen, meist angegliederten sozial- oder wohlfahrtspolitischen Abteilungen wurden Fragen der Pensionierung, Gesundheitsfürsorge, Wohnungsfürsorge, Spareinrichtungen, Kinderfürsorge, des Vorschlagswesens und der Freizeitgestaltung behandelt. In unmittelbarer Nähe gab es gesonderte Bildungsabteilungen, die zuständig für das Lehrlingswesen, die Begabtenförderungen, die Weiterbildung, das Werkzeitungswesen und die Werkbibliotheken waren.
Zu den Anstößen für den Ausbau betrieblicher Personal-, Sozial- und Bildungsarbeit gehörte nicht zuletzt auch die Kritik der Industrie und ihrer Vertreter an der staatlichen Bildungs- und Schulpolitik, der ein Aufbau betriebsinterner Schulen folgte. Besonders kritisiert wurde die Leistungsfähigkeit der Volksschule, die den betrieblichen Anforderungen nicht gerecht würde. Ende der 1920er Jahre wurden einige Untersuchungen (vgl. Arnhold/Senft 1929; Heilandt 1929) durchgeführt, die die Unzufriedenheit der Wirtschaft mit den Kenntnissen der Jugendlichen bestätigen sollten.
Insbesondere die Berufsschule geriet in die Kritik der Wirtschaft. Sie wäre eine Störung für den Betriebablauf. Der Ausdehnung der Berufschulpflicht auf alle volksschulentlassenen Jugendlichen unter 18 Jahren stand die Wirtschaft ablehnend gegenüber. Befürchtet wurde zudem der Einfluss der Berufsschullehrerschaft und eine damit verbundene Entfremdung der Schule von der Wirtschaft. Anfang der 1930er Jahre kam in Industriekreisen die Idee auf, die Verwaltung der Berufsschulen den Kammern zu übertragen, mit dem Argument, „daß durch die Fehlentwicklungen der Vergangenheit eine Gefahr für den Bestand des gesamten Berufsschulwesens entstanden wäre, der nur durch die Übernahme der für die Arbeitgeber interessanten Teile durch die Wirtschaft selbst begegnet werden könnte“ ( Muth 1985, S, 520). Dieser Vorschlag wurde von Seiten der Kammern abgelehnt, da seine Realisierung den Aufbau eines Verwaltungsapparates bedeutet hätte, der aufgrund fehlender Kapazitäten als unmöglich eingeschätzt wurde (vgl. ebd.). Schließlich hat die zu dieser Zeit sukzessiv erfolgte Einschränkung an Ressourcen im Berufschulwesen auch dazu geführt, dass diese weniger als Bedrohung für den wirtschaftlichen Einfluss auf die Jugendlichen angesehen wurden.
Der Schulkritik folgte in der Weimarer Republik der großindustrielle Ausbau von betriebsinternen Stätten und Schulen für die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten.
Um die Lehrlingsausbildung weitgehend selbst steuern zu können, begannen Großbetriebe bereits im 19. Jahrhundert, verstärkt seit Beginn des 20. Jahrhunderts, Lehrwerkstätten und Werkschulen einzurichten. Die Zahl der Lehrwerkstätten, an die die Hoffnung geknüpft wurde, dass sie die „Mängel und Hemmungen bisher üblicher Systeme zu beseitigen und geeignetere Voraussetzungen für eine sorgfältige Ausbildung zu schaffen“ ( Tollkühn 1926, 82) vermöchten, nahm in der Weimarer Republik zu.
Gleichzeitig stieg die Zahl der Werkschulen. Auch für ihre Einrichtung war Betriebsnähe ein zentraler Grund. In der Werkschule wäre eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis (in der Lehrwerkstatt) und eine stärkere Berücksichtung betriebsspezifischer technischer und arbeitsorganisatorischer Entwicklungen im Unterricht gewährleistet. Das werkseigene Lehrpersonal verfüge über Kenntnissen über die Besonderheiten des Werkes und der Produktion. In den Werkschulklassen wäre die Schülerschaft hinsichtlich ihres Ausbildungsziels weniger unterschiedlich, sondern hier wären Lehrlinge gleicher oder ähnlicher Berufe vereint. Der theoretische Unterricht, der in der öffentlichen Berufsschule nur drei Jahre betrug, könnte mit der Werkschule viel besser an die praktische Lehrzeit (vier Jahre) angepasst werden. Im Vergleich zu den öffentlichen Berufsschulen wären die Werkschulen technisch weitaus besser ausgestattet. Zudem könnte eine Zeitersparnis durch den Wegfall längerer Schulwege erfolgen, ebenso wie die Anpassung der Unterrichtszeit an die Werksbedürfnisse. Nicht zuletzt stünden die Lehrlinge unter der permanenten Aufsicht der Betriebe. Äußerer erzieherischer Einfluss könnte reduziert und damit die Integration der Schüler in die Werksgemeinschaft begünstigt werden (vgl. Tollkühn 1926, 102f.; Muth 1985, 551f.).
Von Beginn an waren die Lehrlinge nicht die ausschließliche Adressatengruppe der Werkschulen. In den meisten Betrieben waren sie auch Stätten der Weiterbildung anderer Beschäftigtengruppen. Ein vorrangiges Ziel dabei war es, „möglichst die gelernten, hochwertigen Facharbeiter zu fördern, um geeigneten Nachwuchs für Qualitätsarbeit heranzubilden“ (Stolzenberg 1929, 189).
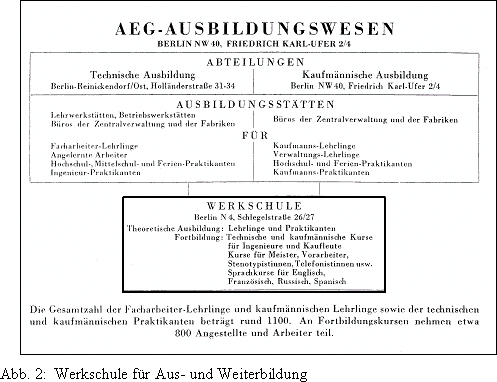
Die erfolgreiche Werkschularbeit führte in der Weimarer Republik nicht nur dazu, dass die Zahl der Betriebe, die Werkschulen einrichteten, zunahmen, sondern auch, dass „einzelne Firmen [...] auf Grund dieser Erfahrungen sogar dazu übergegangen [sind], besondere Ausbildungsmöglichkeiten für vorwärtsstrebende, nicht mehr schulpflichtige Facharbeiter zu schaffen“ ( Stolzenberg 1929, 195). Aufgrund des Mangels an öffentlichen Fachschulen, insbesondere im mechanischen Bereich, haben größere Firmen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts besondere Werkfachschulen zur Weiterbildung vor allem in speziellen Berufen eingerichtet. So gründete die Robert-Bosch AG 1924 eine „auf ihre Erfordernisse zugeschnittene“ ( Ottmann 1926, 149) eigene Werkfachschule, „deren Aufgabe es ist, unter möglichster Beschränkung auf praktische Bedürfnisse, aus geeigneten Angehörigen unserer Firma, Technikern, Meistern, Kalkulatoren, Arbeitsstudienleuten, aber auch befähigten Facharbeitern, ausgesuchte tüchtige Betriebsbeamte für die besonderen Erfordernisse unserer feinmechanischen und elektrotechnischen Massenfabrikation heranzubilden“ (ebd.).
Zu den Werkfachschulen zählten auch die in einigen Großbetrieben eingerichteten Verkaufs- und Serviceschulen, wie die Verkäuferschule der Robert-Bosch AG oder die Serviceschule der Adam-Opel AG. Die im März 1931 von Opel gegründete Service-Schule war Bestandteil des Kundendienst-Programms. Begründet wurde ihr Aufbau mit dem Hinweis auf die Produktion und den Verkauf neuer Automobilmodelle, die Anwendung neuer Spezialwerkzeuge bei der Reparatur und die Bedeutung einer systematischen Organisation des Ablaufs von Reparaturarbeiten. Da weder die fachliche Vorbildung noch die praktischen Erfahrungen der leitenden Personen in den Automobil-Reparatur-Werkstätten ausreichten, wurden insbesondere Meister von Reparaturwerkstätten in zweiwöchigen Kursen theoretisch und praktisch unterwiesen.

Wie eine betriebsinterne Variante der Volkshochschule mutet die von der Adam-Opel AG im Jahre 1931 gegründete „Werkhochschule“ an. In der Zielformulierung spiegelt sich die Diktion der damaligen Volksbildungsbewegung wider: „[...] unseren Werkangehörigen über die engen Grenzen ihrer Berufstätigkeit hinaus Wege zu weisen zur persönlichen Lebensgestaltung, zum klaren Erfassen der Grundlagen von Beruf und Arbeit, zur Mitarbeit an der Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft, und zur Erkenntnis der schicksalhaften Verbundenheit mit Heimat, Volk und seiner Kultur“ ( Der Opel-Geist 1931, 2). Neben dem Fachwissen sollte die Werkhochschule „auch Verständnis und Freude an den Schätzen der Kunst und Literatur vermitteln. So verstanden, sei die Gründung ein Bekenntnis zu einem festen Lebenswillen, so dunkel auch die Zukunft vor uns liege, ein Ausdruck der Zuversicht, aber auch des Glaubens an die eigene Kraft“ (ebd.).
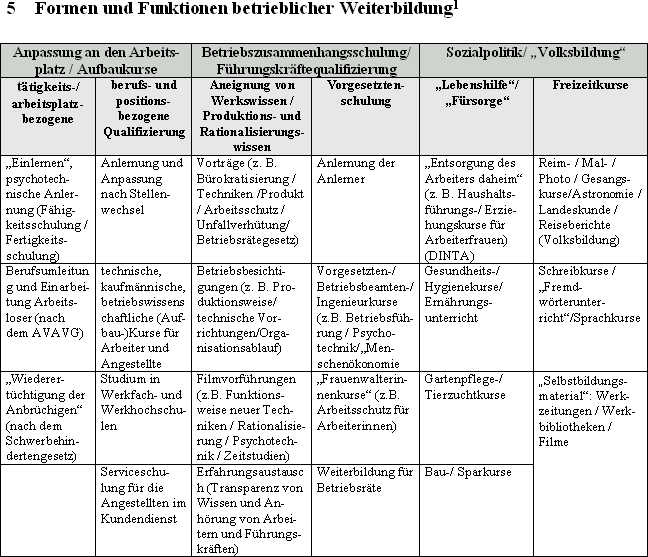
(Die Tabelle ist das Ergebnis einer Auswertung von Archivmaterialien großer Industriebetriebe und deren Werkzeitungen aus den Jahren 1919-1933: „Der Bosch-Zünder. Zeitschrift für alle Angehörigen der Robert-Bosch A.G.“, „Werkzeitung der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen“, „Borsig-Zeitung“, „Zeiss-Werkzeitung“, „Der Opel-Geist“, „Osram-Nachrichten. Mitteilungsblatt für die Angehörigen der Osram G.m.b.H.“, „Siemens-Mitteilungen“, „AEG-Zeitung“, „Kruppsche Mittelungen mit der Beilage‚ Nach der Schicht'“, „DEMAG-Werkzeitung“, „ Telefunken–Zeitung“ und „Daimler-Werkzeitung“.)
In der Spannweite zwischen planloser arbeitsplatzbezogener Einweisung von Arbeitskräften in neue Tätigkeiten und systematisierter Qualifizierung für betriebliche Spezialarbeiten gehörte die Anlernung zu einem wesentlichen Bestandteil betrieblicher Arbeitskräftepolitik, die täglich im Kontext von Neueinstellungen, Tätigkeitsveränderungen oder Stellenwechseln statt fand. Mit der Arbeit war sie in zweierlei Hinsicht eng verzahnt: einmal aufgrund der inhaltlichen und prozessualen Nähe, andererseits als sozialer Integrationsmodus, an dem auch „Arbeitsethos“ und „Arbeitswille“ der Anzulernenden abgelesen werden konnten. Als betriebsspezifische Form der Qualifizierung war die Anlernung nicht unwesentlich für Positionsverbesserungen auf dem internen Arbeitsmarkt: Je nach Intensität der Anlernung und kombiniert mit Erfahrungen konnten Un- und Angelernte hierdurch auf Angelernten- bzw. Spezialarbeiter- und in Ausnahmen auf facharbeiteräquivalente Positionen gelangen, (vor-)qualifizierte Belegschaftsmitglieder konnten anspruchsvollere Tätigkeiten übernehmen oder aufsteigen.
Als betriebliches Rekrutierungsmedium wurde die Anlernung in der damaligen Theorie nicht diskutiert. Die Berufsbildungstheorie hatte solche Qualifizierungsformen aus ihrer Diskussion ausgeklammert, weil sie keine Vorbereitung auf den „eigentlichen“ Beruf waren. Der DATSCH war bemüht, die Anlernung zu systematisieren und von der Ausbildung abzugrenzen. Die Arbeitspädagogik und -psychologie betrachteten Anlernung unter den Aspekten der Psychotechnik und Erziehung.
Das DINTA sah in der Anlernung ein wesentliches Instrument der „Bewirtschaftung der Ungelernten“ ( Bäumer 1930, 75). Arbeitspädagogen und -psychologen waren um die Erstellung von wissenschaftlichen Regeln für die Anlernung bemüht. So wurde eine länger dauernde Beobachtungsphase vorgeschlagen, die die Mängel der kürzeren Einweisung in der Produktion ausgleichen sollte und in der Lage war, „das ‚beste' Verfahren mit allen Einzelheiten einzudrillen“ ( Riedel 1925, 93). Ein „Lehrarbeiter“ sollte darauf achten, dass der Arbeiter jeden einzelnen Griff „nach der besten und praktischsten Methode“ ausführt. In einem sich abseits vom Produktionsprozess befindenden besonderen Vorschulungs- oder Einübungsraum sollte der Arbeiter sich nach einem auf arbeitspsychologischer Grundlage aufgebauten Übungsplan Griff für Griff auf seine Tätigkeit vorbereiten. Ziel dieser „vorbereitenden Anlernung“ sollte es sein, bei den Lernenden eine Fertigkeit zu erreichen, die der „mittleren Leistung“ im Betrieb entspricht, die durch einen Vergleich von errechneten Zeitwerten mit den Registrierungen aus dem Betrieb ermittelt wurde (ebd.).
Innerhalb der Diskussion um die Systematisierung und Rationalisierung der Anlernung ist ferner zwischen zwei psychotechnischen Schulungstypen unterschieden worden: der „Fertigkeits-“ und der „Fähigkeitsschulung“. Unter Fertigkeitsschulung wurde das Einüben von mechanisiertem und routinisiertem Handeln verstanden. Auch bei der Fähigkeitsschulung ging es um Leistungsoptimierung. Hierbei sollte das Wesentliche der Berufsausübung nachgeahmt werden, so dass der Übende möglichst die gleiche „innere Einstellung wie bei der wirklichen Arbeit hat“ (ebd.). Das Besondere an dieser Schulung war, dass bestimmte Schwachstellen beim Arbeitsvollzug so lange geübt werden mussten, bis die höchste Leistungsfähigkeit erreicht war. Neben den Beschäftigten der unteren betrieblichen Hierarchieebene wurden auch Lehrlinge wurden in kurzen Anlernkursen für zusätzliche Bereiche qualifiziert, ebenso wie Facharbeiter im Sinne einer „Nachschulung“ für spezielle Tätigkeiten.
Betriebliche Weiterbildung in Form von institutionalisierter Qualifizierung war in Kreisen der Großindustrie und ihrer Vertreter in den 1920er Jahren keine Besonderheit mehr.

Bereits in den Vorschlägen des DATSCH, dessen Konzeptionen sich in erster Linie auf das technische Schul- und Hochschulwesen und auf die Lehrlingsausbildung in der mechanischen Industrie konzentrierten, war auch von beruflicher Weiterbildung für technische Berufe, die möglichst betriebsnah ausgerichtet werden sollte, die Rede.. So heißt es in der Abhandlung des DATSCH (1912) über die „Weiterbildung des industriellen Facharbeiters“: „Was wir wollen, ist die Heranziehung einer Klasse besonders guter Arbeiter, die sich leichter dem heutigen Zuge unserer Werkstatttechnik: schärfste Ausnutzung der vorhandenen menschlichen und maschinellen Kräfte anpasst“ (74). Die Weiterbildung sollte in Kursen „ohne Unterbrechung der Berufstätigkeit“ stattfinden, also in Sonntags- und Abendkursen, die „jede den jeweiligen Bedürfnissen entsprechende Entwicklung ohne Schwierigkeiten und mit verhältnismäßig geringen Kosten [ermöglichen]“ (71), sowie in Kursen „mit Unterbrechung der Berufstätigkeit“ (74), d.h. in Maschinenbauschulen, Werkmeisterschulen o.ä.. In den Ausführungen des Fabrikbesitzers Gustav Wagner (1919) für den DATSCH über „die Weiterbildung der Facharbeiter im Maschinenbau“ heißt es: „Die richtige Durchführung der Weiterbildung der Facharbeiter hätte ferner den Vorteil, daß, wie dies schon seit Jahren in Amerika der Fall ist, ein gewisser Wettbewerb zwischen den Arbeitern in Höchstleistung stattfinden und die Freude am Beruf gehoben werden müßte“ (114). Die Weiterbildung hätte durch besonders tüchtige Fachleute in Fortbildungswerkstätten zu geschehen, welche größeren Betrieben oder Maschinenschulen angegliedert sind und im ersten Fall der Kontrolle der Betriebsleiter, andernfalls der Aufsicht besonders bewährter Fachleute unterstellt sind. Der theoretische Unterricht hätte sich dabei nur auf technische Weiterbildung zu beschränken, auch wäre der Selbstunterricht durch Stellung guter Lehrbücher und Freilassung der Abendstunden zu unterstützen, überhaupt durch möglichst wenige gesetzliche Vorschriften dem Tüchtigen freie Bahn zu lassen“ (113).
Berufliche Anpassungs- und Aufbaukurse fanden neben der Arbeit in den meisten Großbetrieben statt. Hierbei handelte es sich um einzelne Vorträge, Vortragsreihen, Unterrichtskurse bis hin zu längerfristigen Lehrgängen. Sie wurden entweder durch die Personalabteilung, die Vorgesetzten oder mitunter auch durch die Beschäftigten selbst angeregt. Eine besondere Bedeutung hatte das betriebliche Vortragswesen, das der Ergänzung von beruflichem Wissen dienen sollte. Hier hatten sie die Möglichkeit, nach der Arbeit Unterricht in Fachkunde für Metallarbeiter, Rechenschieberechnen und technische Zeichenkurse zu besuchen.
Außer den in den meisten Großbetrieben durchgeführten technischen Kursen wurden vor allem auch kaufmännische Weiterbildungsmaßnahmen angeboten sowie Sprach-, Stenographie- und Schreibmaschinenkurse. So spielten beispielsweise die „Ertüchtigungsmaßnahmen für Stenotypistinnen und Maschinenschreiberinnen, deren Arbeiten in jedem Wirtschaftsbetriebe für das Buchungs- und Nachrichtenübermittlungsverfahren von Bedeutung sind“ ( Elbel 1930, 28), bei Siemens und AEG eine bedeutende Rolle.

Auch die Sprachkurse für die kaufmännischen Angestellten nahmen an Bedeutung zu. Die lässt sich auch aus den betrieblichen Aufforderungen an die Belegschaft, an Englisch- und Französischkursen teilzunehmen, die seit Mitte der 1920er Jahre immer häufiger in den Werkzeitungen zu lesen waren, schließen.

Die technischen und kaufmännischen Anpassungs- und Aufbaukurse waren karriererelevant, auch wenn ihnen nicht in jedem Fall ein Aufstieg folgte. Sie waren in Relation zur arbeitsbezogenen Anlernung auch weit stärker berufsspezifisch ausgerichtet und damit überbetrieblich tansferierbar. Die Amortisierung der Weiterbildungsinvestition war aber oftmals dadurch gesichert, dass die ohnehin betriebsgebundene und loyale Stammbelegschaft Zielgruppe solcher Maßnahmen war.
Neben der Förderung technischer und kaufmännischer Vorträge, den Unterrichtskursen und Lehrgängen hatte die „Selbstschulung“ und „Selbstbildung“ der Beschäftigten eine nicht wesentliche Bedeutung. Vor allem, so der betriebliche Tenor, wäre es wichtig, wenn sich die Beschäftigten selber um die Erweiterung ihrer Fachkenntnisse kümmerten: „Aber auch der Industrieangestellte und -arbeiter steht in einem Beruf, der es von jedem einzelnen immer mehr erfordert, sich das beste berufliche Rüstzeug zu schaffen und zu erhalten. Dieses Rüstzeug ist neben der persönlichen Tüchtigkeit das berufliche Wissen, das sich keiner heute ohne stetige Selbstschulung erhalten kann [...]. Der Strebsame wird sich durch Selbststudium immer fördern können“ ( Weisser 1928, 217f.). Die durch die Betriebe zur Verfügung gestellten Selbstbildungsmedien waren Werkzeitungen mit ihren fachlichen Berichten sowie Bücher aus den Werkbibliotheken. Gerade den Werkzeitungen wurde ein hoher Fortbildungs- und Erziehungswert beigemessen.
Eine besondere Aufmerksamkeit erfuhr im Laufe der 1920er Jahre jene betriebsspezifische Weiterbildung, in der den Beschäftigten „Zusammenhangswissen“ über betriebliche Bereiche und Prozesse vermittelt und Einblicke in den „Gesamtorganismus“ Betrieb gegeben werden sollten. Die Belegschaft sollte „im Ganzen“ denken, Werkstreue, Firmenstolz und die Überzeugung von der Richtigkeit und Bedeutsamkeit der Betriebspolitik sollten hierdurch gefördert werden (vgl. Borst 1925, 258): „Durch Werkschulen, Vorträge und Führungen sind die viel verzweigten Zusammenhänge zu zeigen. Es muss Verständnis dafür geweckt werden, warum die heutige Arbeitsweise notwendig ist, warum jeder einzelne, auch der kleinste Teil der fertigen Ware, gut, genau und auswechselbar gefertigt sein muss, und wie sehr das Schicksal des Betriebes davon abhängt, dass jeder einzelne auch im Kleinsten treu seine Pflicht tut“ (ebd.). Hieraus sollte sich „ein besonderes Verhältnis zur Gesamtaufgabe, zu dem großen Betriebskörper“ entwickeln (ebd.).
Diese Schulung konzentrierte sich auf bestimmte Beschäftigtengruppen. Der Bedarf an Zusammenhangswissen, so die Vorstellung des Siemens Konzerns, erfordere vor allem die betriebliche Weiterbildung der Werkmeister, Ingenieure und Facharbeiter sowie der Angestellten im kaufmännischen und Verwaltungs- und Sekretärinnenbereich (vgl. Elbel 1930, 27).
Zur Schaffung von Transparenz in Werksgeschehnisse wurde auch der Erfahrungsaustausch gefördert, der nach dem Ersten Weltkrieg zunächst die Funktion der industriellen Selbsthilfe erfüllte. So forderte beispielsweise der Berliner Bezirksverein des VDI, der BBVDI, in dem die Großbetriebe der Berliner Metallindustrie, wie Borsig, AEG, Siemens-Schuckert , Ludwig-Loewe & Co. , vertreten waren, gegen Ende des Ersten Weltkrieges einen „Erfahrungsaustausch unter den Betrieben“, um die unverzügliche qualifikatorische Anpassung der Arbeiter an die aus der Rationalisierung der Fertigung und der Arbeitsvorgänge resultierenden veränderten Arbeitsanforderungen voranzutreiben. Diskussionsabende wurden eingerichtet, um Ratschläge, Anregungen, Berichte über Erfolge und Misserfolge zur Anlernung von Facharbeitern auszutauschen, mit dem Ziel, die heraus gewonnenen Erkenntnisse zu verallgemeinern. Nach dem Krieg institutionalisierte der BBVDI den „Erfahrungsaustausch“, und es kam zur Gründung verschiedener Ausschüsse, die neben dem „Ausschuß für das Anlernen von Facharbeitern“ existierten (vgl. Homburg 1991, 258f.). Diese Ausschüsse boten für Meister und Ingenieure der Berliner Werke Möglichkeiten der Weiterbildung, wie die „technischen Sonderkurse“ (260), an.
Neben dem Austausch von Wissen sollte der Erfahrungsaustausch auch der Pflege sozialer Beziehungen und der Gemeinschaftsförderung dienen, wie bei Krupp , wo er als „Arbeitsgemeinschaft“ konzipiert war, bei der die „Förderung der Erkenntnis, nicht Anhäufung von trockenem Wissensstoff, sondern [...] warmes Erleben wahren Menschentums in unermüdlicher kameradschaftlich geistiger Arbeit“ ( Kruppsche-Mitteilungen 1920, 200) im Mittelpunkt stehen sollte.
Für den „laufenden Erfahrungsaustausch“ als Bestandteil betrieblicher Weiterbildung plädierte Riedel (1925), um dem „Zustand des Mißtrauens aller gegen alle ein Ende zu machen“ (337). Der Erfahrungsaustausch habe einen „unmittelbar wirtschaftlichen Wert“. Als noch wichtiger schätzte er den sozialpflegerischen Wert ein, denn durch ihn würden „selbständige und selbstbewußte Mitarbeiter an Stelle ausführender Organe erzogen werden. Es wird vielfach gerade in den Kreisen der geistig hochstehenden und deshalb wertvollsten Arbeiter darüber geklagt, daß ihre Anregungen unbeachtet bleiben und ihr Wirkungsstreben künstlich beschränkt wird“ (ebd.). Im Hinblick auf die „Organisation des Erfahrungsaustauschs“ schlug Riedel zwei Stufen vor: Erfahrungssammlung (Motivieren der Arbeiter zur Preisgabe ihrer Erfahrungen, Sammeln von Beamtenberichten etc.) und Erfahrungsverwertung (z. B. schriftliche Aufzeichnungen für Anlernung und Fähigkeitsschulung) zur Optimierung von Arbeitsprozessen und „Vervollkommnung der Leistungsfähigkeit der im Betrieb Tätigen“ (339).
In den meisten Werkzeitungen der Großbetriebe wurde über Erfahrungsaustausche, die mehr oder weniger längerfristig institutionalisiert waren, berichtet. Beispielsweise hat Mitte 1931 die Robert-Bosch AG den so genannten „Technischen Erfahrungsaustausch“ ins Leben gerufen, um Möglichkeiten zur „regelmäßigen Aussprache“ ( Huber 1931, 270) zu schaffen: „Diese Zusammenkünfte, in denen von Werksangehörigen Vorträge mit Themen aus ihrem Arbeitsgebiet gehalten werden, dienen hauptsächlich dazu, die Erfahrungen einzelner Stellen den anderen zu übermitteln. Sie sind von dem Grundsatz getragen: Fehler dürfen nur einmal gemacht werden, besondre Erfahrungen einzelner Stellen sollen allen zugute kommen. Diese Zusammenkünfte sollen auch das Zusammengehörigkeitsgefühl wecken und die Gemeinschaftsarbeit fördern“ (270f.).
Von zunehmender Bedeutung war auch die Vorgesetztenschulung, die Betriebsorganisations- und Führungsfähigkeiten fördern sollte. Die Schwerpunkte der Vorgesetztenschulung lagen auf unterschiedlichen Ebenen: Zum einen gehörten hierzu solche Kurse und Lehrgänge, in denen mittleren und höheren Führungskräften das zur Einhaltung von Standards rationalisierter Betriebsorganisation notwendige Wissen vermittelt wurde. In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Betriebsingenieure (ADB) und dem Reichsausschuss für Arbeitszeitvermittlung (REFA), die um die „Bestgestaltung“ von Arbeiten und Lernen bemüht waren, organisierte die Industrie Kurse für Betriebsbeamte, Ingenieure, Meister und Vorarbeiter. Zu den Hauptthemen gehörten Zeitstudien, Differentiallohn, Auslese, Eignungsprüfung und Anlernung von Personal. An den REFA-Kursen bei Siemens sollten vorrangig jene Arbeiter teilnehmen, „die gleichsam die Rationalisierung insgesamt und der Maschinenprozesse im besonderen durch ihr fachliches Wissen, ihre Arbeitserfahrung, ihre Flexibilität und Lernbereitschaft mit- und vorantrugen [...]. Dabei überwogen die (gelernten und hochwertigen angelernten) Metallfacharbeiter bei weitem“ ( Homburg 1991, 555).
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die „Werkmeister-Fortbildungskurse“, deren „Zweck und Ziel“ es war, „die persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten unserer Werkmeister zu erweitern, damit sie den Anforderungen ihrer Stellung voll und ganz gerecht werden können, und mit der Entwicklung der Industrie Schritt zu halten vermögen“ ( Der Opel-Geist 1931a, 5).

Zu einem wichtigen Bestandteil der Vorgesetztenschulung avancierte in der Weimarer Republik die Unfallverhütung. Unfälle während des Produktionsablaufes bedeuteten für die Betriebe unter Umständen nicht nur Personalausfall, Zeit- und Materialverluste, sondern angesichts der Arbeiterschutzregelungen waren sie auch zur Fürsorge und zum Unterhalt der am Arbeitsplatz Verletzten verpflichtet.
Ein weiteres Gewicht in der Vorgesetztenschulung bildete die Anlernung der Anlerner. Sie gehörte zu einem festen Bestandteil betrieblicher Weiterbildung. Anstöße hierfür waren die Häufigkeit von Anlernprozessen in Betrieben sowie der gestiegene Bedarf nach Systematisierung von Anlernung. Hinzu kam, dass die Anlerntätigkeit zunehmend auch als Erziehungsaufgabe im Kontext der Werksgemeinschaft gesehen wurde (vgl. Korn 1932, 113). Denn die „erste Aufgabe“ des Lehrenden ist es, „einen Menschen dahin zu bringen, daß er später Produktion liefern kann. Das bedeutet eine so wesentliche Umstellung des durch jahrelange Arbeit auf Materialbehandlung eingestellten Menschen, daß er häufig zur Menschenbehandlung nur schwer findet“ (117).
Sowohl in der Theorie der Arbeitspädagogik als auch in der Praxis wurde die Vorgesetztenschulung immer mehr auch als „Führerschulung“ und Instrument der „Menschenökonomie“ gesehen. In den Werkzeitungen setzte man sich seit der zweiten Hälfte der 1920er Jahre zunehmend mit Fragen der „Menschenführung“ im Betrieb auseinander. Hier finden sich häufig auch Ankündigungen von Vorträgen zum „Umgang mit den Menschen im Betrieb“. Das DINTA war bemüht, das „Führertum in der Industrie“ (vgl. Arnhold 1930) zu fördern und lieferte Argumente für die Ausweitung der Führerbildung in Betrieben: „Die größte und schwierigste Aufgabe aber besteht darin, das Verständnis für industrielles Führertum auch in die weitesten Kreise der im Betrieb tätigen Ingenieure hineinzutragen. Eine tiefe Tragik ist darin zu erblicken, daß ein großer Teil dieser Ingenieure zwar die tote Materie bis in alle Feinheiten beherrscht, dagegen es gar nicht oder nur unvollkommen versteht, den wichtigsten Faktor des Betriebes, den Menschen, zu führen“ (8).
Überlegungen und Initiativen zur „Menschenbewirtschaftung“ und „Führerschulung“ wurden in den Betrieben flankiert von Angeboten an Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen, die in die Lebenswelt der Arbeiter hineinreichten und darauf zielten, sie als „ganze“ Personen zu erfassen. Solche Angebote blühten vor dem Hintergrund anthropozentrischer und werksgemeinschaftsideologischer Konzepte und Programmatiken auf.
AEG (1928): Ausbildungswesen. Broschüre. Berlin (Deutsches Technikmuseum Berlin/AEG-Archiv).
ARNHOLD, C. (1930): Führertum in der Industrie. In: Arbeitsschulung, 1, H. 2, 6-9.
ARNHOLD, C./SENFT, F. (1929): Schulische Voraussetzungen beruflicher Ausbildung. In: Arbeitsschulung, 1, H. 3, 4-10.
BAETHGE, M. (1970): Ausbildung und Herrschaft. Unternehmerinteressen in der Bildungspolitik. Frankfurt a.M.
BÄUMER, P.C. (1930): D as Deutsche Institut für technische Arbeitschulung (Dinta). München.
BORST, H. (1925): Mechanisierte Industriearbeit. In: Der Bosch-Zünder, 7, H. 11, 257-259.
BÜCHTER, K. (1999): Geschichte betrieblicher Weiterbildung. In: HENDRICH, W./BÜCHTER , K. (Hrsg.): Politikfeld Weiterbildung. München, 32-51.
BÜCHTER, K. (2002): Betriebliche Weiterbildung – Historische Kontinuität und Durchsetzung in Theorie und Praxis. In: Zeitschrift für Pädagogik, 48, H. 3, 336-355.
DAHRENDORFF, R. (1965): Industrie- und Betriebssoziologie. 3. Auflage. Berlin
Deutscher Auschuss für Technisches Schulwesen (DATSCH) (1912): Abhandlungen und Berichte über technisches Schulwesen. Band III. Leipzig.
DER OPEL GEIST (1931): Opel-Service-Schule, 2, Nr. 4, 1-5.
Der Opel-Geist (1931 a ): Über die Abteilung Arbeiter und soziale Angelegenheiten, 2, Nr. 4, 5.
DIETRICH, R. (1914): Betriebs-Wissenschaft. München
ELBEL, K. (1930): Rationalisierung und Personalausbildung. In: Technische Erziehung, 5, Nr. 3, 26-28.
GLADEN, A. (1979): Die berufliche Aus- und Weiterbildung in der deutschen Wirtschaft 1918-1945. In: Pohl, H. (Hrsg.): Berufliche Aus- und Weiterbildung in der Deutschen Wirtschaft seit dem 19. Jahrhundert. Wiesbaden, 53-73.
GÖRS, D. (1999): Wem nützt die betrieblich-berufliche Weiterbildung? In: Hendrich, W./Büchter, K. (Hrsg.): Politikfeld betriebliche Weiterbildung. München, 52-71.
GREINERT, W.-D. (1998): Das „deutsche System“ der Berufsausbildung. Baden-Baden.
HACHTMANN, R. (1989): Industriearbeit im „Dritten Reich“. Göttingen .
HEILANDT, A. (1929): Berufsanforderungen und Volksbildung. Deutsch und Rechnen in der Volksschule. In: Technische Erziehung, 4, 88-102.
HOMBURG, H. (1991): Rationalisierung und Industriearbeit. Arbeitsmarkt, Management, Arbeiterschaft im Siemens-Konzern Berlin 1900-1939. Berlin.
HUBER, F. (1931): Wirtschaftliches Arbeiten. In: Der Bosch-Zünder, 13, H. 12, 269-271.
Kaelble, H. (1983): Industrialisierung und soziale Ungleichheit. Europa im 19. Jahrhundert. Göttingen.
KORN, R. (1932): Richtlinien für die Anlernung im Betrieb. In: Arbeitsschulung, 3, H. 4, 110-117.
KRELL, G. (1994): Vergemeinschaftende Personalpolitik. Normative Personallehren, Werksgemeinschaft, NS-Betriebsgemeinschaft, Betriebliche Partnerschaft, Japan, Unternehmenskultur. München.
LUTZ, B. (1984): Der kurze Traum immerwährender Prosperität. Frankfurt a.M.
MUTH, W. (1985): Berufsausbildung in der Weimarer Republik. Stuttgart.
NICKLISCH, H. (1922): Wirtschaftliche Betriebslehre. Stuttgart.
OFFE, C. (1970): Leistungsprinzip und industrielle Arbeit. Berlin
OTTMANN, A. (1926): Unsere Werkfachschule. In: Der Bosch-Zünder, 8, H. 7, 149-151.
RIEDEL, A. (1925): Betriebserziehung. In: Ders. (Hrsg.): Arbeitskunde. Grundlagen, Bedingungen und Ziele der Wirtschaftlichen Arbeit. Leipzig.
SCHMIEDE, R. (1994): Die Verfestigung betriebsinterner Arbeitsmärkte in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Arbeitspapiere aus dem Arbeitskreis Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF). Gelsenkirchen.
SCHUDLICH, E. (1994): Von der externen zur internen Arbeitsmarktpolitik. Zur arbeitsmarktpolitischen Rationalisierung des Produktionsprozesses um die Jahrhundertwende . Arbeitspapiere aus dem Arbeitskreis Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF). Gelsenkirchen.
SCHUMPETER, J. (1916): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und Konjunkturzyklus. München.
SCHÜTTE, F. (1992): Berufserziehung zwischen Revolution und Nationalsozialismus. Ein Beitrag zur Bildungs- und Sozialgeschichte in der Weimarer Republik. Weinheim.
SEYFFERT, R. (1922): Der Mensch als Betriebsfaktor. Stuttgart.
STAEHLE, W. (1989): Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. 4. Auflage. München.
STOLLE, U. (1980): Arbeitsmarktpolitik im Betrieb. Frauen und Männer. Reformisten und Radikale (1900-1933). Frankfurt a. M.
STOLZENBERG, O. (1929): Werkschulen. In: Kühne, A . (Hrsg.): Handbuch für das Berufs- und Fachschulwesen. Berlin, 185-195.
TOLLKÜHN, G. (1926): Die planmäßige Ausbildung des gewerblichen Fabriklehrlings in den metall- und holzverarbeitenden Industrien. Jena.
WAGNER, G. (1919): Die Weiterbildung der Facharbeiter im Maschinenbau. In: DATSCH (Hrsg.): Abhandlungen und Berichte. Band VI. Leipzig, 113-114.
WEISSER, D. (1928): Wer rastet, der rostet. In: Der Bosch-Zünder, 10, H. 10, 217-219.
ZOLLITSCH, W. (1990): Arbeiter zwischen Weltwirtschaftskrise und Nationalsozialismus. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der Jahre 1928 bis 1936. Göttingen.