|
| ||



Die Bedeutung betrieblicher Praktika in der beruflichen Bildung ist vielschichtiger geworden. Im Sinne einer Erkundung der Arbeits- und Berufswelt sind sie üblicher Bestandteil der vorberuflichen Bildung. Aktuell stehen sie aber auch als Instrument von Qualifizierung in der bildungspolitischen Diskussion, prominent über zwei Einsatzbereiche:
• Praktika gelten als eine Möglichkeit, „Erfahrungswissen“ als Element beruflicher Handlungskompetenz nachweisen zu können. Dabei wird auf die Handlungssituationen vertraut, in denen erworbenes Wissen angewendet werden kann und sich dadurch weiter ausprägt. Dieses Argument gilt etwa für „Auslandspraktika“ im Rahmen des Spracherwerbs, aber etwa auch für den Beleg der Vergleichbarkeit der Zulassungsvoraussetzungen von Absolventen vollzeitschulischer Bildungsgänge zu Abschlussprüfungen der Kammern in anerkannten Ausbildungsberufen.
• Praktika sind zudem eine Möglichkeit, die „Eingliederung“ in das Berufs- oder Erwerbsleben als Übergänge zu gestalten. In Zeiten, in denen Ausbildungs- und Arbeitsstellen knapp sind, kann dies nicht nur für den Übergang Schule-Ausbildung, sondern auch für den Übergang Hochschule-Erwerbsberuf oder den Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit gelten, wenn beispielsweise Hartz-IV-Empfänger über Langzeitpraktika wieder an die Erwerbstätigkeit herangeführt werden sollen.
Sofern der Übergang Hauptschule-Berufsleben aufgrund unzureichender oder nur schwacher Schulnoten, tatsächlich gegebener oder nur behaupteter fehlender Ausbildungsreife, wenigen Ausbildungsstellen, hohen Leistungsansprüchen der Ausbildung oder anderen Gründen zu einer schier unüberwindbaren Hürde zu werden droht, drängt es sich auf, die beiden oben genannten Effekte miteinander zu verbinden. Praktika können für marktbenachteiligte Jugendliche ( Enggruber 2003, 14) in diesem Sinne zweifachen Nutzen entfalten. In und durch Praktika (als Ergänzung zu anderen Bildungsmaßnahmen) können „kleine Handlungskompetenzen“ aufgebaut und nachgewiesen werden. Dies ist eine schlichte und bildungspolitisch vermutlich inkorrekte Darstellung des Instrumentes der Qualifizierungsbausteine als zentrales Element der Berufsausbildungsvorbereitung, die im „neuen“ § 1 des BBiG den Betrieben zugeordnet werden ( Seyfried 2003, 22). In und durch Praktika kann zweitens die Befähigung zur Ausbildung oder Erwerbsarbeit „vor Ort“ nachgewiesen und aufgebaut werden, was zu einem sogenannten erwünschten „Klebeeffekt“ führen kann. Der Klebeeffekt ist eingetreten, wenn der Praktikumsbetrieb anschließend „echter Arbeitgeber“ für den Praktikanten wird oder durch das Praktikum ein anderer Betrieb als Arbeitgeber bzw. Ausbildender gefunden wurde.
Beide Effekte haben – falls Sie eintreten und je nach Sichtweise – unerwünschte Nebenwirkungen. Dies sind unter anderem die Erosion der Ausbildung und des daran geknüpften Facharbeiterstatus durch zertifizierte und bündelbare Teilqualifikationen, damit verbunden die Anrechnungsfragen auf die Ausbildungszeiten, der Austausch und ggf. die Verlagerung von Ausbildungsplätzen zu Praktikumsplätzen, die stillschweigende Verlängerung von Probezeiten und einhergehenden Missbrauchsmöglichkeiten, die Etablierung von ersten, zweiten und weiteren Schattenmärkten der beruflichen Grundbildung u. a.. Die Nebenwirkungen relativieren die bildungspolitische Attraktivität betrieblicher Praktika als ein kostengünstiges und organisatorisch weitgehend flexibles Instrument der Qualifizierung als gewünschte Ergänzung oder aber mögliches Substitut dualer Ausbildung. Betriebliche Praktika stehen damit im doppelt spannungsreichen Kontext, der sich einerseits über die Formen des Lernens zwischen intendiert-gesteuerten und sozialisatorisch-ermöglichenden Lerneffekten aufspannt, andererseits über die Formen der Lehrorte als Organisation bzw. Einflussbereiche zwischen öffentlichen Schulen und privaten Betrieben (van Buer/Troitschanakaja/Höppner 2004, 431 f.). Dieser doppelte Kontext der Lernorte prägt die Lernortdebatte, er kann aber auch in der Debatte von der Gleich- oder Besonderheit beruflicher und allgemeiner Bildung aufgezeigt werden. In anderen Worten: Betriebliche Praktika sind in spezifischer Weise ein Beispiel für den „Lernort Betrieb“ und machen zugleich deutlich, dass es den „Lernort Betrieb“ eben nur mit Kontext, und zwar mindestens doppeltem Kontext gibt ( Beck 1984, Buschfeld 1994, Euler 2004).
Diesen Umstand führe ich mit als einen Grund an, warum eine Auseinandersetzung mit dem Lernort Betrieb im Bereich der marktbenachteiligten Jugendlichen auf Ausbildungsplatzsuche so widersprüchlich, so irritierend und auch so wechselhaft geführt wird. Der Lernort Betrieb hat „immer ein `aber´ bereit“ (hier zitiere ich einen Liedtext von Klaus Hoffmann, dessen Titel ich leider vergessen habe). Deshalb ist der Vorspann zur Darstellung der eigentlichen Absicht dieses Beitrages auch etwas länger ausgefallen. Es geht in diesem Beitrag um Einschätzungen und gemachte Erfahrungen von Jugendlichen mit dem Praktikumsort Betrieb, die „in der Warteschleife“ oder eben „im Übergang“ ( Hurrelmann 1989) verhaftet bleiben. Sie erleben die Zeit, die sie im Betrieb verbringen als
• eine Zeit, die sie relativ zu anderen Alternativen bewerten, also im Verhältnis zu ihrer Vorstellung davon, wie es wäre „einfach Geld zu verdienen“, „rumzuhängen“, „nur zur Schule gehen“, „weiter zur Schule zu gehen“ oder eben „eine Ausbildung zu machen“;
• eine Zeit, die immer als Hoffnung oder Versprechen auf eine künftige Zeit der Ausbildung oder Beschäftigung gedeutet wird und das Misstrauen beinhaltet, weiter hingehalten, verdrängt oder aussortiert zu werden;
• eine Zeit, in der man sich sowohl bewähren als auch „etwas Neues“ erfahren möchte, ohne dabei der „Ausbeutung“ anheim zu fallen (Quelle: eigene Interviews).
Die Argumentation stützt sich auf Einschätzungen von Jugendlichen in zwei typischen Modellprojekten (ähnlich etwa auch: Buchholz 2005 und eine Reihe weiterer Vorläufer), die durch Einstiegsqualifikationen bzw. Qualifizierungsbausteine, die oben geschilderten Effekte unterstützen wollen (und dabei die o. g. Nebeneffekte vermeiden möchten). Im TANJA-Projekt (Teilqualifikationen als Angebot für jugendliche Arbeitslose zum Einstieg in Ausbildung und Beschäftigung), einer Initiative der Industrie- und Handelskammern im Rahmen des Ausbildungskonsenses NRW, sollten Qualifizierungsangebote für nicht ausbildungsreife Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung entwickelt werden, die – aus unterschiedlichen Gründen – als „lern- bzw. leistungsschwach“ einzustufen sind und daher besonderer Förderung bedürfen. Aus zwei Befragungen fließen hier gut 200 Einschätzungen von Jugendlichen aus NRW aus den Jahren 2004 und 2005 ein. Aus Mitteln des BQF -Programms unterstützt wird das Projekt „Schulische Berufsvorbereitung durch Dualisierung“ des Landes Nordrhein-Westfalen, aus dem ebenfalls zwei Befragungen mit je etwa 150 Einschätzungen von Jugendlichen aus den Jahren 2004 und 2005 vorliegen. In dem Projekt erproben 14 Berufskollegs in NRW neue Angebote für Jugendliche, die ansonsten in Berufsschulklassen für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag „gesteckt“ worden wären. Der Grundgedanke bei beiden Projekten ist soweit vergleichbar: Die Jugendlichen sollen überwiegend (ca. 60%) der Grundzeit einer Ausbildungsmaßnahme im Betrieb als Praktikant verbringen. Im BQF -Projekt bedeutet dies: Die Schüler besuchen in einem einjährigen Bildungsgang 2 Tage pro Woche das Berufskolleg und sind 3 Tage im Praktikum ( Buschfeld/Koreny 2004). Für das TANJA-Modell teilen sich Träger und Schule (bei Schulpflicht) die verbleibenden 40% „Qualifizierungsanteil“. Die Dauer des Praktikums beträgt in der Regel 6-10 Monate des Schuljahres.
Der Titel des Beitrags entspringt dabei einer – bei aller Vorsicht – doch m. E. spürbar hohen Wertschätzung der Jugendlichen gegenüber den im Betrieb gemachten Erfahrungen mit Menschen und Arbeitsleistungen, und zwar selbst dann, wenn das bereitgehaltene „aber“ ganz offensichtlich wird. Einige summarische Beispiele aus geführten Interviews mit den Jugendlichen sollen diese Stimmung unterstreichen. Jugendliche drücken ihre Zufriedenheit mit dem Modell (2 Tage Schule, 3 Tage Betrieb) und den gemachten Erfahrungen im Betrieb auch dann aus,
• wenn sie selbst den Eindruck haben, wie ein Auszubildender im ersten Lehrjahr im Betrieb produktiv mitzuwirken, aber aus „betrieblichen Gründen“ keinen der drei zu vergebenden Ausbildungsplätze erhalten,
• wenn sie am Rosenmontag alleine im Geschäft „den Laden schmeißen“ und dankbar sind, dafür zehn Euro „geschenkt“ zu bekommen,
• wenn sie im Saisongeschäft mit zehnstündigen Arbeitstagen „für umsonst“ mitarbeiten und anschließend wegen des Konfliktes, ob eine Cola-Dose nun erlaubt oder unerlaubt aus dem Automaten genommen wurde, das Praktikum abbrechen.
Gerade in ambivalenten Feldern ist die Darstellung von „Einzelfällen“ problematisch ( Oswald 1997, 72). Es könnte auch in drei Schilderungen belegt werden, wie „Zoff“ mit dem Chef, ständiges Hinhalten und die Vertagung von Entscheidungen über Ausbildungsplätze, eine „verlorene Zeit“ mit stupiden Arbeitsbedingungen zu Wechseln der Praktikumsstellen oder Aufgaben von Berufswünschen geführt haben.
Dennoch bleibt die Einschätzung, dass ein betriebliches Praktikum (selbst wenn es ein zweites oder drittes ist) in der Warteschleife eher als „Glücksfall“ oder „Gewinn“ gewertet wird, selbst wenn die Ausbildung eigentlich der „Hauptgewinn“ wäre. Im Vergleich zu einer rein schulischen Warteschleife erscheint es geradezu als ein paradiesischer Zustand des sinnvollen Daseins mit Perspektive. Das wäre im nächsten Abschnitt zu belegen. Und was durch ein Fragezeichen als Einschätzung zu bezweifeln wäre, sofern daraus bildungspolitische Konsequenzen nach verstärktem Einsatz von betrieblichen Praktika gefolgert würden, im Abschnitt „über den schönen Schein“.
Zunächst wird die Zufriedenheit der Jugendlichen mit den Betrieben als Indiz für die These vom „Glücksfall“ angeführt. Die Ergebnisse der Abfrage zur Verteilung von Schulnoten für den Betrieb zeigt folgendes Bild:

Angesichts des Umstandes, dass der Klebe- oder Übergangseffekt in den Projekten um etwa 25% schwankte und dies zum Zeitpunkt der Befragung auch meist schon absehbar war, kann sich die Zufriedenheit allein auch nicht mit der Wirkung des Erfolges des Praktikums begründen lassen, sondern eher mit den erinnerten, dann eher positiven Eindrücken. Eine differenzierte Analyse für die Gruppen, in der die Frage nach der Übernahme mit der Bewertung des Betriebes in Schulnoten kreuztabellarisch gegenübergestellt wird, zeigt:

Die Einschätzung der Schulnote für den Betrieb bei Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz erhalten hatten, liegt somit immer noch besser als der Mittelwert der Einschätzung der Schulnoten für den Lernort Schule für alle Jugendlichen.
Ein weiteres Indiz sind Angaben zur Einschätzung des Modells (2 Tage Schule, 3 Tage Betrieb, was überwiegend als angemessenes Verhältnis bewertet wurde) und die Empfehlung des Modells an Freunde:
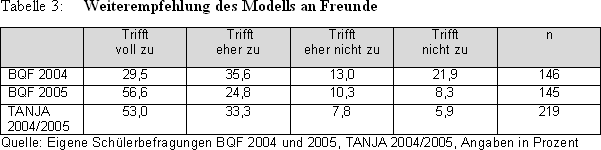
Nun können solche Zufriedenheitswertungen oder Empfehlungen auch mangels alternativer Vorstellungen oder bisheriger noch schlechterer Erfahrungen zu Stande kommen. Inhaltlich richtet sich daher auch ein Fragenkomplex auf die Gestaltung der Arbeitstage im Betrieb.
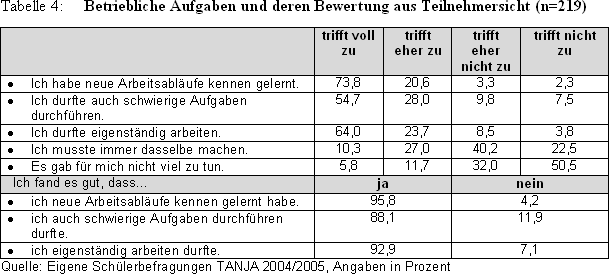
Weil die jeweilige Auslegung von „neu“, „schwierig“ und „eigenständig“ der Jugendlichen nur subjektiv sein kann, beziehe ich in folgender Tabelle die Eindrücke der Betriebe (n= 50) als Stützung der Argumentation hinzu:
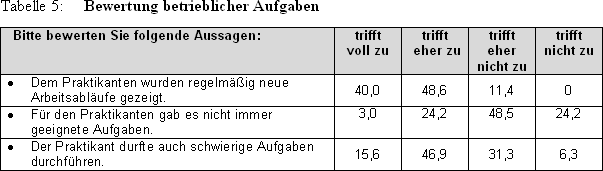 Quelle: Eigene Betriebsbefragung BQF 2005
Quelle: Eigene Betriebsbefragung BQF 2005
Im Rahmen der Befragungen zum Projekt „Schulische Dualisierung der Berufsvorbereitung“ wurde versucht, über verschiedene Adjektive einen „normalen Arbeitstag“ zu charakterisieren.
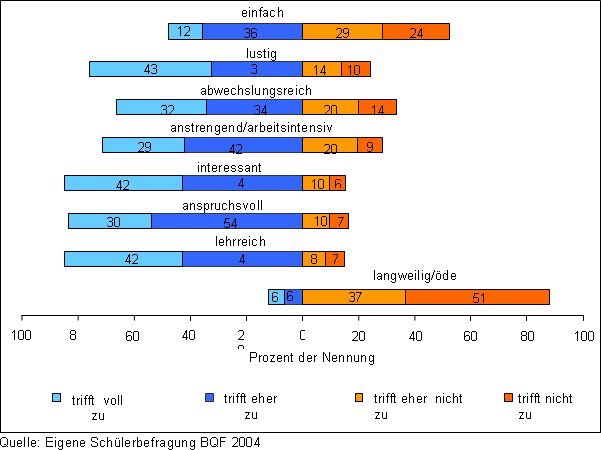
Auch hier belegen die Angaben die Gültigkeit der Zufriedenheitseinschätzung, weil ein Zusammenhang von Übernahme und Arbeitstätigkeit angenommen werden kann, hier dargestellt an zwei ausgewählten Items.

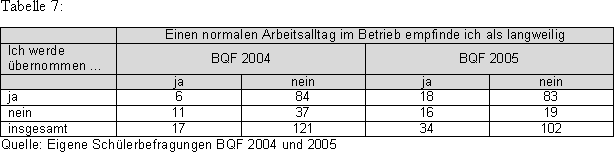
Auch die Bewertung der Frage, wie sich die Jugendlichen in Betrieben betreut fühlten und an wen sie sich bei Problemen wenden konnten, gibt keinen Anlass, an einem hinreichenden Grad an Beteiligung der Betriebe zu zweifeln:
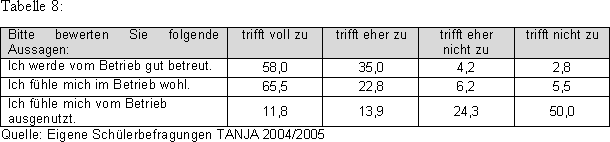
Insgesamt interpretiere ich die Angaben der Jugendlichen im folgenden Sinn: Ein betriebliches Praktikum genießt auch bei einem Zeitraum zwischen 6 und 10 Monaten einen hohen Stellenwert bei den Jugendlichen. Jugendliche zeigen im Praktikum, dass sie mithalten können, den Alltag bewältigen können, sich normal und akzeptiert fühlen können. Betriebliche Praktika sind die Attraktoren der genannten Qualifizierungsmodelle.
Soweit ist eine erste Deutung der Daten erfolgt. Ist es deshalb jedoch geboten, betriebliche Praktika als Qualifizierungsinstrument zu unterstützen, ihren didaktischen Mehrwert zu fördern, ihren Anteil in formalen Qualifizierungsmaßnahmen auszubauen oder als Bestandteil formaler Qualifizierungsmaßnahmen einzufordern?
Ein Einwand gegen die Aussage, das betriebliche Praktikum sei der Attraktor der Qualifizierungsmodelle, besteht in einer Relativierung. Generiert nicht der Kontext der wohl tendenziell als problematisch einzuschätzenden bisherigen schulischen Lernerfahrungen die doch zufrieden stimmenden Aussagen? Kann „eigenständig arbeiten“ nicht bedeuten, dass sonst keiner im Raum war und sie trotzdem – anders als vielleicht in der Schule – keinen „Unsinn angestellt“ haben? Im Betrieb wird im Vergleich zur Schule doch wahrscheinlich stets eigenständiger gearbeitet, wenn die Bedingung von Schule eine Klasse von Schülern ist. Ist es nicht selbstverständlich, dass „neue Arbeitsabläufe“ wahrgenommen werden, wenn diese unstrukturiert, ungeordnet, überraschend, wechselnd, vielfältig sind, weil sie eben ungefächert und ohne Stundenplan und ohne Lehrabsicht auftauchen? Es ist keine Überraschung, als Betrieb gut da zu stehen, wenn man aus einem ungeliebten System dort aufgenommen wird. Und weiter: Dann müssen sich „die Betriebe“ weder absichtsvoll noch unter Anstrengung in dieser Hinsicht etwas leisten – denn es reicht, „echter Betrieb“ zu sein.
Praktika können in diesem Sinne als Qualifizierungsinstrument i. S. von informellen Lernprozessen ( Dohmen 2001, 18 ff.) (und informellen Bewerbungs- und Bewährungsprozessen) verstanden werden. Es ist die alte Frage der Lernortdiskussion, ob sich durch die didaktische Gestaltung der Lernprozesse nun eine Steigerung des Wirkungsgrades hinsichtlich Effizienz und Effektivität erreichen ließen. Aber damit wird die Grenze markiert und überschritten, warum das informelle Lernen informell genannt wird. Ein „informelles Instrument“ zu formalisieren, also mit Absicht, Verfahren und möglicher Weise sogar mit Erfolgskontrollen zu versehen, ist eben die Umkehrung der ursprünglichen Absicht.
Der Nachweis, was im Praktikum intentional gelernt bzw. vermittelt wurde oder ob die Praktikanten den Anforderungen der spezifischen Arbeitstätigkeiten im Praktikumsbetrieb nachkommen konnten, sind zweierlei Paar Schuhe. In der Praxis wird leicht aus jedem Paar eins zusammen getragen. Die Absicht zählt, auch ohne Erfolg und der Erfolg kann (und soll) sich auch ohne Absicht einstellen. Faktisch wird kein Praktikumsbetrieb in der Lage sein, hier zu differenzieren, somit wird das Lehren eben informell. Einen „informellen Lehrort“ bildungspolitisch zu fördern, führt zur Aufgabe des Anspruchs an Gestaltbarkeit und Einflussnahme. Im BQF-Versuch zeigt sich etwa, wie sehr sich formale Qualifizierungsleistung, ausgedrückt in Qualifizierungsbausteinen, und Wertschätzung der informellen Anteile unterscheiden. Die oben genannten Einschätzungen sind unabhängig von (nicht besonders zahlreich) vergebenen formalen Zertifikaten über Qualifizierungsbausteine.
Der Status „Praktikantin“ oder „Praktikant“ dürfte dabei großen Einfluss auf diese Chance informellen Lernens haben. Schließlich ist „eine Praktikantin“ oder „ein Praktikant“ an sich eine Aufforderung, entweder jemandem etwas zu zeigen oder aber zu beschäftigen und zugleich keine Verpflichtung, es auch zu müssen oder gar den Erfolg zu belegen (Dies wäre bei der nächsten Stufe, den Auszubildenden dann eher möglich). Zugleich kommen die jugendlichen Praktikanten nach den Befragungsergebnissen aber gut mit dieser Unverbindlichkeit zurecht bzw. könnte die Unverbindlichkeit ein Grund für positive Stimmung sein. Ein Beispiel mag dies unterstreichen: Ein junger Mann benennt in einem Interview, was ihm am Praktikum besonders gefallen hat. Er betont, dass ihn besonders beeindruckt hat, wie sein Chef mit ihm „Mathe“ gemacht hat. „Der hat gesagt, dass sei im Beruf wichtig und hat mir Aufgaben aus dem Buch erklärt und die mit mir durchgerechnet“ (Interview D 31, 2004). Zugleich hat der junge Mann zu schlechte Schulnoten in Mathematik für den Hauptschulabschluss und seine Lehrer haben ihm ähnliche Lernangebote auch gemacht – wobei die Schule in seiner Bewertung eher schlecht wegkommt. In diesem Beispiel drehen sich Argumente der Lernortdiskussion einmal um sich selbst – was aber bleibt, ist der positive Eindruck des Praktikums.
Die Praktikumszeit läuft insofern ab, während die Ausbildungszeit eher wegläuft (wegen der Prüfung), die Praktikumszeit bedeutet weder richtig (formell) lernen, noch richtig (gegen Lohn) arbeiten im Betrieb. Dann könnte sich die positive Grundstimmung als Artefakt herausstellen: Das informelle Lernen in Betrieben bestätigt sich selbst – wenn es subjektiv erfolgreich war oder aber unverbindlich. Der paradiesische Zustand dokumentiert sich in erlebter Wirkung oder empfundener Freiheit vom Lernen und Arbeiten. Beides ist nicht knapp, sondern es bietet sich reichlich Gelegenheit. Dagegen stellen Stundenpläne und Lernpflichten, selbst handlungsorientierte Lehr-Lernarrangements und Erfolgsprüfungen vergleichsweise eine Vertreibung aus dem Paradies dar.
BECK, K. (1984): Zur Kritik des Lernortkonzepts – Ein Plädoyer für die Verabschiedung einer untauglichen pädagogischen Idee. In: Georg, W. (Hrsg.): Schule und Berufsausbildung. Bielefeld: Bertelsmann. 247-262.
BUCHHOLZ, C. (2005): Schulische Berufsvorbereitung und kooperative duale Ausbildung – Das Modell BAVKA. In: Bojanowski, A./Ratschinski, G./Straßer, P. (Hrsg.): Diesseits vom Abseits. Studien zur beruflichen Benachteiligtenförderung. Bielefeld: Bertelsmann. 175-188.
BUER, J. van/TROITSCHANSKAJA, O./HÖPPNER,Y (2004): Das Praktikum in der dreijährigen Berufsfachschule – Lernortkooperation oder Lernortkoordination? In: Handbuch der Lernortkooperation, hrsg. von D. Euler , Band 1, Bielefeld: Bertelsmann, 428-445.
BUSCHFELD, D. (1994): Kooperation an kaufmännischen Berufsschulen. Eine wirtschaftspädagogische Studie. Köln: Botermann & Botermann.
BUSCHFELD, D./KORENY, K. (2004): Zwei plus drei macht einen Qualifizierungsbaustein? Erste Erfahrungen aus einem Modellprojekt an Berufskollegs. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online. Ausgabe 6.
http://www.bwpat.de/ausgabe6/buschfeld-koreny-bwpat6.shtml . ISSN: 1618-8543. Rev. 18.01.2006.
DOHMEN, G. (2001): Das informelle Lernen. Die internationale Erschließung einer bisher vernachlässigten Grundform menschlichen Lernens für das lebenslange Lernen. Bonn: BMBF.
ENGGRUBER, R. (2003): Zur Heterogenität Jugendlicher mit Berufsstartschwierigkeiten – ein Systematisierungsversuch. In: Busian , A. et al: Jugendliche mit Berufsstartschwierigkeiten – wirksame Unterstützung vor Ort? Dokumentation der Dortmunder Forschungstage. Dortmund: Sozialforschungsstelle Dortmund, 9-27.
EULER, D. (2004): Lernortkooperation – eine unendliche Geschichte? In: Handbuch der Lernortkooperation, hrsg. von D. Euler, Band 1, Bielefeld: Bertelsmann, 12-24.
HURRELMANN, K. (1989): Keine Berufs- und Zukunftsperspektiven für Jugendliche? Weinheim und Basel: Beltz.
OSWALD, H. (1997): Was heißt qualitativ forschen? In: Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft, hrsg. B. Friebertshäuser; A. Prengel, Weinheim: Juventa. 71-87.
SEYFRIED, B. (2003): Berufsausbildungsvorbereitung und Qualifizierungsbausteine. In: Zeitschrift für Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Sonderausgabe 2003. 21-23.