|
| ||



In den gewerblich-technischen Berufsschulen hat in den letzten Jahren eine „arbeitsorientierte Wende“ stattgefunden, wie RAUNER in dem einleitenden Kapitel des Buches „Qualifikationsforschung und Curriculum“ (2004) herausstellt. Diese Wende bezieht sich auf die Neuausrichtung an den inhaltlichen Anforderungen beruflicher Arbeit als Bezugspunkt der Curriculumentwicklung und eine damit einhergehende Abkehr von der bisher verfolgten Fachsystematik mit ihrer Ausrichtung an den korrespondierenden Ingenieurwissenschaften. Diese Wende ist für die Berufschulen inzwischen breit diskutiert worden, aber wenig beachtet wurde bisher, dass von einer solchen Wende auch dort gesprochen werden kann, wo die Ausrichtung an den Inhalten beruflicher Arbeit eigentlich selbstverständlich sein sollte. Die Rede ist hier von der Ausbildungsabteilung eines großen Unternehmens, das von der Anzahl der Auszubildenden und Ausbilder her gesehen, es durchaus mit großen Berufsschulzentren aufnehmen kann.
Im Folgenden werden empirische Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt ( FISCHER/RÖBEN 2004, 2002, 2001) vorgestellt, das sich mit der Fragestellung auseinandersetzte, was Unternehmen auf der Organisationsebene von Facharbeitern und Fachkräften machen, wenn sie sich zum einem lernenden Unternehmen entwickeln. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Maßnahmen auf der operativen Ebene gelegt. In der deutschen Teilstudie wurden dazu nicht nur zwei Betriebe eines international agierenden großen Chemiekonzern untersucht, sondern auch dessen Ausbildungsabteilung. Diese hatte kurz vor Beginn der Untersuchung eine tief greifende Organisationsentwicklungsphase durchgemacht, die neben einem massiven Personalabbau auch bedeutende Veränderungen in den berufliche Aufgaben der Ausbilder mit sich brachte. Die Fragestellung, die im Forschungsprojekt untersucht wurde, war: Inwieweit lassen sich die organisationalen Innovationen als organisationales Lernen interpretieren? Oder anders gefragt: Ist die Ausbildungsabteilung eine lernende Organisation?
Zur Beantwortung dieser Fragen wird im Folgenden gezeigt, wie sich die Ausbildungsabteilung in Hinblick auf das pädagogische Handeln bei ihrer Ausrichtung auf die Inhalte beruflicher Arbeit verändert hat und wie sich daraus Schlüsse über den Stand des organisationalen Lernens der Ausbildungsabteilung ziehen lassen.
Das Bildungswesen des untersuchten Unternehmens, eines sehr großen Chemieunternehmens, besteht aus den beiden großen Abteilungen Aus- und Weiterbildung und zwei weiteren Abteilungen, die mit Personal- und Serviceaufgaben für das Bildungswesen befasst sind.
Die Unterabteilung Ausbildung ist mit sieben weiteren Untereinheiten die größte Organisationseinheit des Bildungswesens. Insgesamt waren in fünf nach Berufen strukturierten Untereinheiten im Jahre 2000 2536 Auszubildende beschäftigt, von denen ca. 845 jedes Jahr ihre Berufsausbildung abschließen. In weiten Teilen trifft auf diese Ausbildungsabteilung der Strukturierungstyp ‚B‘ von PÄTZOLD, DREES und THIELE zu (1998, 39 f und 201f). Allerdings sind die nebenberuflichen Ausbilder (bzw. die betrieblichen Ausbildungsbeauftragten) nicht als weitere Hierarchieebene unterhalb der Ausbilder angesiedelt, sondern betriebliche Kooperationspartner außerhalb der Linienorganisation.
Zur Analyse der Ausbildungsabteilung wurde die Theorie von ARGYRIS und SCHÖN zugrunde gelegt (1999, 29). Nach dieser Theorie kommt es zu problematischen Situationen, wenn die Differenz zwischen handlungsleitender und handlungsrechtfertigender Theorie zu groß wird (ARGYRIS/SCHÖN 1999, 26). Solch eine Situation kann dann Gegenstand einer organisationalen Untersuchung werden. Eine organisationale Untersuchung besteht darin, dass beispielsweise Organisationsmitglieder diese Diskrepanz im Namen der Organisation untersuchen, Vorstellungen über die Organisation korrigieren und auch Korrekturen innerhalb der Organisation und ihrer Verfahren vornehmen. Gelingt es nun im Gefolge dieser Untersuchung, die handlungsleitenden Theorien der restlichen Organisationsmitglieder ebenfalls zu korrigieren, das individuelle Lernergebnis in der Organisation zu verankern, dann hat die Organisation gelernt. Das Lernen der Organisation besteht in diesem Sinne also darin, dass die Verfahren und Prozeduren der Organisation permanent in Hinblick auf das Lernen der Organisationsmitglieder und das Sichern der Lernresultate für die Organisation evaluiert werden.
Diese Lernprozesse können sich in der Reichweite ihrer Wirkungen deutlich unterscheiden. Die folgende Abbildung soll dies verdeutlichen:

Kommt es durch den Lernprozess lediglich zu einer Korrektur der Handlungen, sprechen ARGYRIS und SCHÖN vom single loop learning (Einschleifen-Lernen). Werden aber auch die Ziele innerhalb der Organisation korrigiert, so sprechen sie vom double-loop-learning. Beim deutero-learning, der am weitesten reichenden Lernform, kommt es zu einer Reflexion über die zugrunde liegenden Annahmen und die in der Organisation wirksamen Prinzipien, die auch die Lernprozesse der Mitglieder der Organisation und der Organisation selbst einschließt.
Um dieses theoretische Konstrukt auf die hier betrachtete Organisation eines Bildungswesens anzuwenden, müssen die Rückkopplungsschleifen identifiziert werden.
Die Rückkopplungsschleifen (loops) zwischen Ausbildungseinheit und Auszubildenden und zwischen Ausbildungseinheit und den Einheiten des Unternehmens, die die fertig ausgebildeten Fachkräfte einstellen, werden im Folgenden „primäre Rückkopplungsschleifen (primary loops)“ genannt. Die vorgenommene Benennung erfolgt zur Unterscheidung der Rückkopplungsschleifen, die sich auf die Ausbildungseinheit selbst beziehen und die „sekundäre Rückkopplungsschleifen (secondary loops)“ genannt werden sollen.
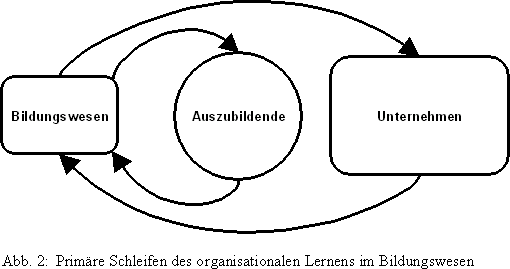
Durch die Perspektive der primary loops wird der Maßstab, an dem die internen Veränderungen der Organisation gemessen werden, durch die äußeren Beziehungen der Abteilung bestimmt. Dadurch erscheinen die internen Rückkopplungsschleifen als sekundär. Allerdings soll diese Betrachtung nicht dazu verleiten, alle Aktivitäten des Bildungswesens aus Bedürfnissen seiner Kunden abzuleiten. Das Bildungswesen nimmt die Kundenbedürfnisse nämlich keinesfalls absolut, sondern interpretiert sie, und dabei spielt einerseits der zentrale Auftrag des Bildungswesens eine Rolle, aber andererseits auch Kostenüberlegungen. Das Resultat dieser Betrachtung ist eine Gewichtung der Kundenbedürfnisse und erst dieses Resultat spielt als Richtschnur des Handelns im Bildungswesen eine große Rolle.
(Die grammatikalisch männliche Form bezeichnet hier und im Folgenden Ausbilderinnen und Ausbilder. Die Frauenquote in der Ausbildungsabteilung ist übrigens gering: Nach dem Stand aus dem Jahre 2000 gab es unter den gewerblich-technischen Ausbildern lediglich 4 Ausbilderinnen und nur eine erreichte die unmittelbar über dem Ausbilder liegende Hierarchiestufe des Teamleiters. Deutlich andere Verhältnisse dagegen in der kaufmännischen Ausbildung: von 13 Mitarbeitern war nur einer keine Frau und dies war der Ausbildungsleiter. )
Der zentrale Akteur der Ausbildungseinheit ist der Ausbilder (Mit Ausbilder ist im Folgenden der hauptberufliche Ausbilder in der Bildungsabteilung gemeint. Im untersuchten Unternehmen sind dies in der Regel berufliche Fachkräfte auf Meister- und Technikerniveau.). Dies ergibt sich aus seiner Stellung innerhalb der Organisation: Nur er ist im direkten, dauerhaften Kontakt mit den Auszubildenden und ist daher der wichtigste Organisator und Ausführende der betrieblichen Ausbildung. Kein anderer Akteur des Berufsbildungssystems verbringt so viel Zeit zusammen mit den Auszubildenden wie der Ausbilder und es steht zu vermuten, dass kein anderer Akteur so viel Einfluss auf den Auszubildenden hat. Schon aus diesem Grund liegt es nahe, dass er am feed back von Auszubildenden und Organisationseinheiten des Unternehmens intensiv beteiligt sein sollte.
Auch für die Ausbilder unseres Untersuchungsbetriebes galt über lange Zeit, was PÄTZOLD, DREES und THIELE folgendermaßen charakterisiert haben:
„Das Ausbildungshandeln wird geleitet von berufspädagogischen Vorstellungen, die die zuständigen Ausbilder als Synthese biographisch erworbener Denkmuster und Handlungsorientierungen und einer subjektiven Interpretation betrieblicher (Ausbildungs-) Ziele, bei Berücksichtigung formalrechtlicher Vorgaben, ihren Tätigkeiten selbst unterlegen“ (1998, 38).
Das pädagogische Handeln des Ausbilders wird demnach bestimmt durch zwei wesentliche Einflussfaktoren:
• organisationale Randbedingungen und
• ihre subjektive Interpretation durch den Ausbilder.
Zu beiden Faktoren wurde in unserer empirischen Untersuchung Material erhoben.
Durch eine Umstrukturierung wurden dem Ausbilder viele Aufgaben genommen und in einer neu geschaffenen Organisationseinheit gebündelt. In den Worten des ehemaligen Leiters des Bildungswesens:
„Wir bilden das Bildungswesen in zwei Hauptprozessen ab. Der eine Hauptprozess ist die Ausbildung und der zweite Hauptprozess, den Ihr zu betreiben habt, ist die Fort- und Weiterbildung. Und alles andere, was Personalmanagement angeht, was Betriebsbetreuung angeht, Service angeht, sind Unterstützungsprozesse, und die werden auch als solches so deklariert und auch so organisiert. In der Vergangenheit war es eben so, dass Hauptprozess als auch Unterstützungsprozesse in einer organisatorischen Einheit vermengt waren.“ (Interview BWI 203-209).
Das damit verfolgte Ziel war Kostentransparenz und natürlich Kostensenkung. Auf der Ebene der Ausbilder schlägt sich das wie folgt durch:
„Die Ausbilder mussten wirklich überdenken: Was ist jetzt mein Job in der Zukunft? Nämlich Ausbildung!! Und von welchen Jobs muss ich mich verabschieden? D. h. also Planung der Fachräume, Planung der zeitlichen Durchläufe, Planung der EDV-Organisation in ihrem Bereich, Planung von administrativen Vorgängen, vom Nachwuchsmarketing über Auswahl und, und, und.... Das haben sie konsequent an die Unterstützungsprozesse abgeben müssen. Die haben sich richtig freischaufeln müssen, auch von liebgewordenen Tätigkeiten und haben wirklich im Focus nur noch die Ausbildung zu haben. Mein Job ist auszubilden und alle anderen Funktionen bitte konsequent in die Unterstützungsprozesse abgeben.“ (BWI 799-812).
Das Ziel der Umstrukturierung war aber nicht nur die Reduktion der Kosten, sondern auch die Verbesserung der Qualität der Ausbildung. Dies sollte durch eine verstärkte Orientierung an den beiden Hauptkunden des Bildungswesens – Betriebe und Auszubildende – geschehen. Die stärkere Orientierung an den betrieblichen Kunden hatte im Bildungswesen bereits in den letzten Jahren zu bedeutenden Veränderungen in der Ausbildung geführt, die im Folgenden kurz nachgezeichnet werden sollen.
Um die beruflicher Handlungskompetenz der Auszubildenden zu entwickeln, wurden zwei große Projekte aufgelegt, die sich von der bisherigen Form der Vermittlung von Ausbildungsinhalten deutlich unterscheiden. Bislang durchlief der Auszubildende in der zentralen Ausbildungsstätte typischerweise eine Reihe von Lehrgängen, wie sie in der industriellen Ausbildung üblich sind.
Die beiden Projekte, die von dieser Praxis abgehen und Kompetenzen vermitteln sollen, die in der Produktion tatsächlich benötigt werden, heißen „Industrielandschaften“ und „Technikum 2000“.
Das Projekt „Industrielandschaften“ findet während 6 Wochen in einem eigens dafür eingerichteten Technikum statt. Hier stehen Anlagen, die sich von denen in den Betrieben möglichst wenig unterscheiden sollen. Im Technikum gelten auch alle Arbeitsverfahren und Vorschriften, die in den Betrieben gelten. Die Auszubildenden müssen z.B. ihren Helm ebenso selbstverständlich tragen, wie sie für ihre Arbeit Meldekarten und Arbeitserlaubnisscheine benötigen. Wenn Reparaturen in der Anlage von ihnen durchgeführt werden, besorgen sich die Auszubildenden die Ersatzteile auf dieselbe Weise, wie dies der Instandhalter eines Betriebes auch tun würde.
Eine der Aufgaben, die von den Auszubildenden in der „Industrielandschaft“ bearbeitet werden, sieht z.B. den Umbau der Anlage vor. Doch statt eines detaillierten Planes, bekommen die Auszubildenden nur eine Problembeschreibung und müssen sich zunächst einmal mit der Anlage so vertraut machen, dass sie selbst einen Umbau planen können. Die Projektphasen
• Erfassen der Funktion und Bedienung einer Chemieanlage
• Planung
• Montagevorbereitung
• Montage
• Prüfen der Anlage
• Inbetriebnahme der Anlage
sollen so gehalten werden, dass sie sich möglichst wenig von entsprechenden Arbeitsaufgaben in der betrieblichen Praxis unterscheiden. Die Auszubildenden werden nicht Schritt für Schritt angeleitet und die Vier-Stufen-Methode verbietet sich von selbst, da der Umbau oder eine Neuinstallation von den Ausbildern ja nicht erst vorgemacht werden kann, um dann von den Auszubildenden nachgemacht werden zu können. Die Organisation des Technikums schließt die Anwendung dieser Methode aus und der Ausbilder gerät quasi von selbst in die Rolle des Coaches.
Durch die neuen Technika sind einige Ziele der Ausbildungspraxis korrigiert worden und nicht nur die Ausbildungspraxis selbst (vgl. Abbildung 1). Während früher die Vermittlung (isolierten) Fachwissens im Vordergrund stand, rückt in beiden neuen Technika die Handlungskompetenz der Auszubildenden in den Vordergrund. Im Sinne von AGYRIS und SCHÖN fand also mit der Einrichtung der neuen Art von Technika zumindest double loop learning statt.
Die Korrektur des Ziels der Ausbildung ist auch eine Korrektur an grundlegenden Leitvorstellungen über die Ausbildung in den großbetrieblichen Ausbildungsabteilungen. Seinen Ausgangspunkt nahm das Ausbildungszentrum in den siebziger Jahren, als Labore, Werkstätten und Technika für die Ausbildung zusammengefasst oder erstmals eingerichtet wurden (Natürlich gab es in anderen Branchen bereits sehr viel früher zentrale Lehrwerkstätten (z.B. 1890 Schuckert & Co, 1892 M.A.N., 1898 Borsig (vgl. VON BEHR 1981, 41) und in der chemischen Industrie wurde auch schon um die Jahrhundertwende mit der Ausbildung begonnen. Hier interessiert aber der Facharbeiterbereich für die chemische Produktion, und der Umschwung von der Un- und Angelerntenbranche (im produktiven Bereich) hin zu einer Branche mit großem Facharbeiteranteil in der Produktion ereignete sich erst in den siebziger Jahren (DREXEL/NUBER 1979). Seit dieser Zeit wurde die chemische Industrie übrigens auch zu einem bevorzugten Studienobjekt der Produktionsautomatisierung (KERN/SCHUMANN 1970, 1984; MICKLER 1975, 1984). Auch soll hier keinesfalls die These vertreten werden, dass die Lehrwerkstatt an sich die Isolierung vom Arbeitsprozess fördert.). Der Grund für die Schaffung dieser zentralen Ausbildungsstätten war die Ausweitung der Ausbildung des Facharbeiternachwuchses in der chemischen Industrie. Durch den Aufbau von Zentren für die betriebliche Berufsausbildung sollte die Durchführung dieser Ausbildung unter ökonomischen Gesichtspunkten effektiv durchgeführt werden und den erforderlichen Facharbeiternachwuchs im gewünschten Umfang liefern. Allerdings führten die Maßnahmen, die die Ausbildung effektivierten, zu Nebenwirkungen, die man erst relativ spät erkannt hat. Durch die Praxisferne wurde der Bezug der Ausbildung zu den Arbeitsprozessen tendenziell vernachlässigt, und als sich in den achtziger und neunziger Jahren die Arbeitsprozesse veränderten und vor allem in anspruchsvolle Organisationskonzepte eingebettet wurden, waren die zentralen Ausbildungsstätten wenig darauf vorbereitet, sich den geänderten Anforderungen anzupassen.
Parallel zu dieser Entwicklung fand in den Betrieben ein Personalabbau statt. Die Aufgaben für die verbliebene Belegschaft wurden angereichert und die Arbeitsbelastung stieg. Da die Ausbildung der Auszubildenden zur Aufgabe einer eigens dafür geschaffenen Organisationseinheit geworden war, verkümmerte in den Betrieben das Verantwortungsbewusstsein für sie. Dies führte dazu, dass der Ausbildungsort `Betrieb´ Mängel der zentralen Ausbildung (insbesondere die Distanz zu den Arbeitsprozessen, wenig Bezug zur Arbeitsorganisation) kaum kompensierte.
Die Ausbilder, die viele Jahre in Lehrgängen unterrichteten, hatten sich z.T. auf nur wenige Segmente der gesamten Ausbildung spezialisiert. Die Effektivität ihrer Arbeit bemaßen sie an ihrer Fähigkeit, die Auszubildenden auf dem von ihnen beherrschten Segment der Ausbildung zu belehren und auf möglichst jede Frage eine prompte Antwort parat zu haben. Das Ideal ihrer pädagogischen Tätigkeit erinnert stark an das Ideal von Lehrern, die im Frontalunterricht ihr Fach beherrschen und durch keine Frage der Schüler in ihrer überlegenen Position erschüttert werden wollen (vgl. auch PÄTZOLD/DREES/THIELE 1998, 52ff). Allerdings wurden einige dieser Segmente, auf die sich Ausbilder spezialisiert hatten, durch den raschen Fortschritt der Technik obsolet. Da der Wechsel zu anderen Feldern der Ausbildung von den Ausbildern nicht regelmäßig gepflegt wurde, hatten einige Ausbilder ihre Fähigkeit, sich in neue Arbeitsgebiete einzuarbeiten, zum Teil verkümmern lassen (Diese Aussage muss berufsfeldspezifisch differenziert werden: Für die Ausbilder der Metall- und Elektroberufe trifft diese Aussage am weitestgehenden zu. Sie sind es auch, die nach einem Wechsel ins Bildungswesen üblicherweise nicht mehr in die Betriebe und Werkstätten zurückkehren wollen. Die Ausbilder in der Labortechnik tauschen dagegen schon häufiger mal das Lehrlabor wieder gegen das Betriebs- oder Forschungslabor (im Schnitt der letzten Jahre gibt es eine Wechselquote von 5-10%). In der kaufmännischen Ausbildung ist der Wechsel der Ausbildungsreferentinnen zurück in die Büros hingegen fast schon die Regel.).
Mit der Einrichtung der neuen Technika wurde in gewisser Weise die letzte traditionelle Antwort des Bildungswesens auf die neuen Herausforderungen gegeben. Traditionell , weil die Idee des Lehrgangswesens nicht fallengelassen wurde, sondern die neuen Ausbildungsziele mit dem Nachbau der betrieblichen Wirklichkeit im Bildungswesen verfolgt wurden. Die letzte Antwort, weil mehr Simulation betrieblicher Wirklichkeit kaum noch geht und jeder weitere Schritt in Richtung einer größeren Realitätsnähe zu den Betrieben selbst führen müsste und damit aus dem Bildungswesen heraus. (In der Tat wurde nach Abschluss der empirischen Untersuchung von der Ausbildungsabteilung ein Modellversuch mit dem Titel „Lernort Betrieb“ begonnen. Bedeutende Teile der Ausbildung in der zentralen Ausbildung wurden in die Betriebe zurückverlegt.)
Bei der Abkehr von den traditionellen Reaktionen des Bildungswesens auf wechselnde äußere Anforderungen – der Wechsel der Lehrgangsthemen z.B. reichte nicht mehr aus, stattdessen wurden die Lehrgänge selbst in Frage gestellt – kamen externe und interne Gründe zum Tragen. Die äußeren Gründe betreffen die Umstrukturierung der Konkurrenzunternehmen in Deutschland (vgl. KÄDTLER 2000, BRIKEN 1999). Vor allem die Umwandlung eines sehr ähnlich organisierten Konkurrenten in eine Holding unter deren Dach die früheren Abteilungen zu rechtlich selbständigen Firmen wurden, hat für Aufsehen im untersuchten Unternehmen gesorgt. Das frühere Bildungswesen des Konkurrenten hat heute als selbständiges Unternehmen viele verschiedene Chemieunternehmen als Kunden, bildet für diese aus und bietet alle Leistungen eines Bildungswesens als Dienstleistung auf dem freien Markt an. Dadurch wurden die Kosten für die Ausbildung von beruflichen Fachkräften auf transparente Marktpreisen abgebildet, die im Folgenden für viele Chemieunternehmen zum Maßstab der eigenen Bildungsabteilung wurden.
Der interne Grund lag in der Berufung eines neuen Abteilungsdirektors des Bildungswesens 1998. Dieser kam aus dem Personalwesen des Unternehmens und zeichnete sich durch Erfahrungen im Personalabbau aus. Unter ihm wurde das Bildungswesen einer Analyse von externen Unternehmensberatern unterzogen, die erhebliche Einsparpotentiale durch eine Abkehr von der funktionsorientierten Organisation und durch eine Neuorientierung an den Geschäftsprozessen des Bildungswesens aufzeigten. Zusammen mit dieser Unternehmensberatung wurde 1998 das Projekt Focus aufgelegt, das die Neuorganisation des Bildungswesens von einer funktionsorientierten zu einer prozessorientierten Organisation zum Ziel hatte.
Im Rahmen des Focusprojektes stand zwar der Kostengesichtspunkt deutlich im Vordergrund, die Kosten waren jedoch keineswegs allein ausschlaggebend. Denn im Zuge der Hinwendung zum zahlenden Kunden wurden die Dienstleistungen des Bildungswesens hinsichtlich ihres Nutzens für den Kunden analysiert. Diese Kundenorientierung brachte es mit sich, dass man die Kosten für Dienstleistungen des Bildungswesens zu der Bereitschaft des Kunden, für diesen Nutzen zu zahlen, in ein Verhältnis setzte. Auf dieser Grundlage kam man beispielsweise zu dem Schluss, dass kostenintensive Einrichtungen wie das „Technikum 2000“ und die „Industrielandschaft“ durchaus dem Interesse des Kunden entsprechen, da sie dem Auszubildenden Kompetenzen vermitteln, die vom Kunden gewünscht werden.
Der Kostengesichtspunkt machte sich für die Ausbilder hauptsächlich in den Aktivitäten einer neu geschaffenen Planungsabteilung bemerkbar, die dafür sorgte, dass die Auslastung der Technika sowie der übrigen Seminargebäude hinsichtlich der Kosten optimiert wurde. Die Ausbilder – als Kosten betrachtet – wurden auf ihre Kerntätigkeit verpflichtet, da viele ihrer Nebentätigkeiten von neuen Organisationseinheiten übernommen wurden, von denen man annimmt, dass sie diese Aufgaben kostengünstiger erledigen können.
Die Qualität der Ausbildung sollte durch die Arbeitsprozessorientierung gesteigert werden.
Das einfachste Herstellen einer Beziehung zum Arbeitsprozess ist sicherlich das Arbeiten selbst. Es liegt also eigentlich auf der Hand, dass man Auszubildende möglichst mitarbeiten lässt, damit diese in der Arbeit lernen und die Fähigkeit erwerben, den Anforderungen der Praxis gerecht zu werden. So einfach dieser Gedanke ist, so schwierig war seine Umsetzung in dem betrachteten Unternehmen. Der im vorherigen Abschnitt beschriebene Umzug der Ausbildung aus den Betrieben in die zentrale Ausbildungsorganisation mit ihren von den Betrieben und Werkstätten getrennten Technika, Laboren und Seminarräumen hat auf Seiten der Betriebe dazu geführt, dass man sich der Verantwortung für die Ausbildung der Auszubildenden weitgehend enthoben sah. Da die Betriebspraxis in den letzten Jahren ohnehin durch Personalabbau, Verdichtung des Arbeitstages der übrig gebliebenen Beschäftigten und durch die Delegation zahlreicher Aufgaben und Zuständigkeiten aus den höheren Ebenen der Hierarchie an die Basis gekennzeichnet ist, nimmt es nicht wunder, dass das Engagement der Betriebe, sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für Auszubildende zu etablieren, ziemlich gering ist.
„In den Betrieben geht das Erfahrungspotential verloren. Gerade die Älteren werden in Vorruhestand geschickt und damit gehen auch gerade die Leute verloren, die sich früher besonders intensiv um die Auszubildenden gekümmert haben. So etwas wie Ehrenwochenlöhner gibt es ja nicht mehr. Das sind Leute, die lange im Akkord gearbeitet haben und den Akkordsatz nach einer gewissen Zeit dann unabhängig von ihrer Arbeitsleistung bekommen. Hing auch mit der Altersstufe zusammen. Die hatten dann mehr Zeit als die anderen und damit dann auch Zeit sich um Auszubildende zu kümmern. Wir haben immer weniger Leute in den Betrieben, die Zeit für die Auszubildenden übrig haben.“ (BSC 60-71)
Gab es also früher Personengruppen in den Betrieben, die für solche Aufgaben, wie die Betreuung der Auszubildenden prädestiniert waren, so bedarf es heute der expliziten Verankerung der Ausbildung in den organisatorischen Verfahren der Betriebe. Für das Bildungswesen ist es daher wichtig, Ansprechpartner in den Betrieben zu haben, denen ein gewisses Zeitkontingent für Ausbildungszwecke zugestanden wird. Diese Ansprechpartner nennt man im untersuchten Unternehmen Ausbildungsbeauftragte (zur Begriffsvielfalt siehe SCHMIDT-HACKENBERG u.a. 1999, 78).
Ein Ausbildungsleiter schildert die Situation für den Bereich der Ausbildung im Produktionsberuf:
„Wir sind bemüht, die betrieblichen Ausbildungsphasen der Azubis auf ein vergleichbares Level zu heben. Wir stellen fest, dass die kleinen Betriebe, (...) davon nehmen etwa 200 tatsächlich Azubis in die Ausbildung, 100 können nicht, wollen nicht oder sonst etwas, und wir stellen bei den 200, mit denen wir zusammenarbeiten, stellen wir fest, dass ein relativ großes Qualitätsgefälle in der im Betrieb stattfindenden Ausbildung vorliegt. Wir wollen jetzt in diesem Jahr 2001 konzentriert an die Betriebe herangehen und halbwegs standardisierte Ausbildungspläne in den Betrieben erstellen und dann auch umsetzen.“ (BSM 128/134).
Die Kenntnis über die betriebliche Situation erlangt das Bildungswesen durch mehrere organisationale Untersuchungen:
1) Durch die Betriebshospitationen (Diese Betriebshospitationen sind eine der Innovationen, die weiter unten als wichtiges Element des lernenden Bildungswesens diskutiert werden.) der Ausbilder, die für einen Zeitraum von ein bis fünf oder sechs Wochen in den Betrieben mitarbeiten und während dieser Zeit auch Möglichkeiten ausloten sollen, wie der Betriebseinsatz der Auszubildenden optimiert werden kann.
2) Durch die Befragung von Ansprechpartnern in den Betrieben. Dies sind häufig die Betriebsleiter, die zum einen bei sog. Kundenbesuchen befragt werden, zum anderen in Arbeitskreisen des Bildungswesens mitarbeiten, z.B. dem „Arbeitskreis Produktionsberufe“.
3) Durch die Befragung der Auszubildenden.
Diese Feedbackinstrumente unterliegen der Evaluation:
„Ich muss sagen, nach meiner Einschätzung liegen wir mit den Betriebsleitern als Ansprechpartnern in der Betriebshierarchie schon viel zu hoch. Wir sind einfach nicht mehr dicht genug dran. Und wir wollen deswegen einen neuen Kreis ins Leben rufen, in dem die Meister drin sitzen, einfach weil die dichter am Geschehen dran sind.“(BSM 310/318).
Geplant ist die systematische Verlagerung von Ausbildungsinhalten aus der zentralen Ausbildung zurück in die Betriebe.
Die Befragung der Auszubildenden und betrieblichen Ansprechpartner ist nicht das einzige Instrument für die Analyse der betrieblichen Verhältnisse.
„Um an die Information zu kommen, was im Betrieb tatsächlich gebraucht wird, haben wir ausgeklügelte Systeme eingerichtet. Zunächst einmal die betrieblichen Durchläufe [der Auszubildenden] wurden zeitlich verlängert. 43 Wochen im Betrieb, 42 Wochen in der Schule und 65 Wochen in der zentralen Ausbildungsstätte. In einigen Jahren soll der Betriebsanteil noch einmal um 10 Wochen vergrößert werden. In den Betrieben haben wir betriebliche Ausbildungsbeauftragte. Die organisieren die Ausbildung im Betrieb. Die eigentliche Ausbildung im Betrieb findet in Zusammenarbeit mit einem Paten statt, der möglichst die Funktion innehat, die der Auszubildende auch einmal haben wird, und der noch nicht all zu lange mit der Ausbildung fertig ist. Nicht mehr als 5 bis 10 Jahre sollte die Ausbildung zurückliegen. Die Paten wurden im Bildungswesen vorbereitet. Der Vorgesetzte des Paten ist der Meister. Die Ausbildung [der Paten] erfolgt im Bereich Sicherheit, Pädagogik. Z.B. Ein-Tages-Seminare, die wir mit 400 Paten durchgeführt haben. Info über Ausbildung, damit die Paten wissen, was die Auszubildenden in welchem Jahr gelernt haben.“ (BGR 71/91).
Durch unsere Untersuchung kann die Bedeutung, die der ausbildenden Fachkraft in der Untersuchung von SCHMIDT-HACKENBERG u.a. 1999 beigemessen wurde, nur bekräftigt werden.
Die Herstellung eines Arbeitsbezuges innerhalb der Ausbildung macht also nicht einfach bloß Rückkopplungsschleifen zwischen dem zentralen Bildungswesen und den Betrieben notwendig. Da die arbeitsnahe Ausbildung aus der zentralen Ausbildung in die Betriebe verlagert werden soll, ist eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationseinheiten notwendig. Da dies erkannt wurde und die Bestrebungen auch tatsächlich darauf gerichtet sind, Teile der zentralen Ausbildung abzubauen, kann man dies als eine durch die Rückkopplung induzierte Veränderung der die Ausbildung leitenden Ideen und Vorstellungen interpretieren. Damit kann von einem Prozess des deutero learnings gesprochen werden: Das grundsätzliche Überdenken der Ausbildung führt nicht nur dazu, dass die Handlungen im Bildungswesen auf andere Ziele gerichtet werden – wie es bei der Einrichtung der Technika bereits der Fall war – sondern es ist eine Bereitschaft vorhanden, aufgrund einer Reflexion der Grundsätze und zugrunde liegenden Ideen Korrekturen an der Entwicklung der eigenen Organisation voranzutreiben. Die Belege für diesen Wandel im Denken findet man allerdings eher in der Managementebene des Bildungswesens und es muss untersucht werden, inwieweit es den Managern gelingt, durch organisationale Maßnahmen auch die anderen Mitarbeiter in der Organisation von ihren Visionen zu überzeugen.
Einen wesentlichen Ansatz, die Ausbilder von der Notwendigkeit der Veränderungen im Bildungswesen zu überzeugen, stellt das Konzept der ganzheitlichen Ausbildung dar. Die Grundidee besteht darin, dass Ausbilder für die ganze Ausbildung des Auszubildenden verantwortlich gemacht werden und nicht nur für den Teil, den sie als Fachausbilder betreuen.
„[...] das verlangen wir von dir, dass du deinen ganzen Beruf abbildest in der Ausbildungstätigkeit und dafür sorgst, dass du wieder so breit wirst [d.h. fähig in der ganzen Breite des Berufsbildes auszubilden, P.R.] wie du mal warst, das bitte schön auch in der Ausbildung abdecken und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das in den Köpfen einiger für erhebliche Probleme gesorgt hat. (...)
Und auf der anderen Seite ist das gleichermaßen wichtig – wie sagt man heute so schön im Norddeutschen –, dass die Employability erhalten bleibt oder auch weiter gefördert wird, indem sie tatsächlich über die gesamte Breite auch ihres einmal erlernten und fortgebildeten Berufes auch verwerten können, dass sie ihren Marktwert erhalten und nicht abhängig sind von dem, wie umfangreich oder weniger umfangreich mal eines Tages die Ausbildung sein wird. (...) und wir haben leider feststellen müssen bei der Untersuchung dieses Punktes, dass etliche Ausbilder 20/25 Jahre keinen Betrieb mehr von innen gesehen haben. Und wenn man jetzt sagt, Transfer vom Betrieb in die Ausbildung, dann kommen einem schon Bedenken zu sagen: Lernt denn tatsächlich der Auszubildende das, was ihn morgen in der Arbeitswelt erwartet? Oder ist es eben nur das stringente Vorgehen nach der Ausbildungsordnung, dass bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, eingeübt werden, und dann muss der Betreffende sehen, wie er das dann in der betrieblichen Welt umsetzen kann.“(BWI 440/469)
An diesem Zitat erkennt man die zwei Seiten des Konzeptes der ganzheitlichen Ausbildung, denn es ist einerseits auf die Ausbildung der Auszubildenden bezogen und soll dem Ausbilder zu einer Sichtweise auf die ganze Ausbildung des Auszubildenden verhelfen und ihn aus seiner Verhaftung mit einem nur schmalen Segment der gesamten Ausbildung lösen. Andererseits wird mit dem Konzept auch verbunden, dass der Ausbilder selbst weiterqualifiziert wird und durch die ganzheitliche Betreuung der Auszubildenden sich für den internen Arbeitsmarkt des Unternehmens interessant macht (Inwieweit dies tatsächlich gelingt, sei an dieser Stelle dahingestellt. Anzumerken ist hier allerdings, dass die ganzheitliche Ausbildung dem Ausbilder zunächst einmal innerhalb des Bildungswesens eine größere Flexibilität verschafft. Die Attraktivität der Qualifikation des Ausbilders für Abteilungen außerhalb des Bildungswesens ist damit allein sicherlich noch nicht gegeben.). Damit die Spezialisierungs- und Festsetzungseffekte in Zukunft vermieden werden können, hat man organisatorische Maßnahmen festgelegt, die vor allem bei den jüngeren Ausbildern dazu führen sollen, dass sie flexibel einsetzbar bleiben. Zu diesen Maßnahmen zählen die Rotation zwischen verschiedenen Fachbereichen der Ausbildungsorganisation, der Wechsel zwischen Fachausbildung (Mit Fachausbildung ist die Stationierung des Ausbilders in einem bestimmten Technikum oder Labor oder einer bestimmten Werkstatt gemeint. Hier ist er fachlich gefordert. Im Gegensatz dazu ist die Betreuungsausbildung nicht an Lokalitäten und Fachinhalte gebunden, sondern an eine Klasse von Auszubildenden, die idealerweise während ihrer gesamten Ausbildung von ihm betreut wird. ) und Betreuungsausbildung, die dazu führen soll, dass möglichst beides von jedem Ausbilder beherrscht wird und die Festlegung einer maximalen Verweildauer des Ausbilders im Bildungswesen.
Die im Rahmen des Projektes Focus erfolgte Aufwertung der Funktion des Betreuungsausbilders wird vom Management als Paradigmenwechsel gehandelt:
„Und wir haben dann Paradigmawechsel im Prozess der Ausbildung gehabt: Weg vom tayloristischen Ausbilderlabor mehr hin zum Ganzheitlichen. Ein Betreuungsausbilder betreut eine Ausbildungsgruppe von der Auswahl bis zur Prüfung durch alle Phasen der Ausbildung und ist damit Ansprechpartner für den Klassenlehrer der berufsbildenden Schule, ist damit Ansprechpartner für den betrieblichen Ausbilder draußen in der Produktion und macht die größten Anteile der Zentralausbildung selber.“ (BWI 317/326).
Ausbilder sind häufig gleichzeitig Fach- und Betreuungsausbilder. Durch diese „Ämterhäufung“ kommt es allerdings zu Konflikten zwischen den Aufgaben der Betreuungsausbildung und der Fachausbildung:
„Meine Gruppe ist jetzt bei einem Fachausbilder. Das erste Jahr war ich komplett bei der Gruppe, Tag für Tag. Im zweiten Jahr bin ich [nur] zeitweise bei ihnen, [bin] aber immer noch der Betreuungsausbilder. Es ist heute stellenweise schwierig, alles mit den Auszubildenden zusammen zu machen, vor allem in der berufsübergreifenden Ausbildung.“(BPO 53/65).
Da sich die Ausbildungsinhalte der jetzigen Auszubildenden sehr von denen unterscheiden, die die Ausbilder selbst in ihrer Ausbildung erworben haben (ein Beispiel ist die berufsfeldübergreifende Ausbildung in den Industrielandschaften), müssen sie, um ihre Auszubildenden ganzheitlich betreuen zu können, selbst noch einiges dazulernen. Die Fähigkeit, die ganze Breite des Berufes auszubilden, sollten sich die Ausbilder im Zuge der Betreuungsausbildung aneignen. Doch zeitgleich mit der Betreuungsausbildung wird von allen interviewten Ausbildern verlangt, dass sie auch als Fachausbilder tätig sein sollen. Aufgrund der zeitlichen Konflikte in dieser Doppelrolle beschränkt sich die Betreuungsausbildung in der Praxis häufig nur auf den ersten Teil der Ausbildung.
Der Betreuungsausbilder, der nach dem Konzept der Ausbildungsleitung nicht nur Auszubildende betreut, sondern auch den Kontakt zur Berufsschule und zum Betrieb hält, ist zumindest zum Zeitpunkt der Untersuchung eher eine Vision des Managements gewesen als überprüfbare Realität. Der Ausbilder ist verpflichtet, 30 Wochen im Jahr Auszubildende unmittelbar zu unterrichten. Diese Verpflichtung repräsentiert die harte ökonomische Seite des Focusprojektes. Laut Zeitkontingent hat er 10 Wochen, in denen er in die Schule fahren und die Betriebe besuchen soll. Dafür darf allerdings kein Unterricht und keine Betreuung ausfallen. Durch Einsparung von Personal kommt es nach Einschätzung der Ausbilder dazu, dass die Verpflichtungen des Fachausbilders die des Betreuungsausbilders zumindest zeitweise konterkarieren.
Das Konzept des Betreuungsausbilders kann als Maßnahme des organisationalen Lernens interpretiert werden, denn durch den Betreuungsausbilder ist eine neuartige Instanz in die Organisation implementiert, die die Auswirkung aller pädagogischen Einzelmaßnahmen evaluieren kann. Neben der fachlichen Systematik in der Ausbildung wird der Handlungskompetenz der Auszubildenden und ihren Lernprozessen zumindest gleiches Gewicht eingeräumt. Allerdings ist der Erfolg dieser Maßnahme an zeitliche Kapazitäten der Ausbilder gebunden, die zumindest teilweise während der Untersuchung nicht ausreichend gegeben waren.
Bislang war es zumindest in den gewerblich-technischen Berufsfeldern üblich, dass ein Ausbilder, wenn er erst einmal im Bildungswesen angelangt war, bis zu seiner Pensionierung auch dort blieb. Viele Interviewpartner aus dem Bildungswesen haben bereits viele Jahre dort verbracht, einige sogar Jahrzehnte. Dies war in der Vergangenheit kein Problem und ist auch innerhalb anderer Abteilungen des Unternehmens nicht ungewöhnlich. Als der Personalabbau im Bildungswesen durchgeführt werden sollte, ergab sich allerdings das Problem für das Management, dass viele Ausbilder nicht wieder in Abteilungen außerhalb des Bildungswesens versetzt werden konnten. Die Ausbildungsleitung begründet die Schwierigkeit, Ausbilder in andere Teile des Unternehmens zu versetzen, mit der Spezialisierung des Ausbilders auf ein schmales Segment der Ausbildung.
Dies wird auch von einigen Ausbildern bestätigt:
„Ich bin zwanzig Jahre Ausbilder. Mich möchte da draußen keiner mehr haben. Ich habe zwar didaktische und methodische Fähigkeiten, aber von der fachlichen Seite her gesehen, ist mein Wissen heute nicht mehr relevant.“ (BBA 107/131).
Gegen eine Beschränkung der Aufenthaltsdauer aber werden auch Einwände ins Feld geführt, die mit Befürchtungen eines Karriereknicks begründet werden. Damit ist gemeint, dass jemand, der aus einem Betrieb für sieben bis acht Jahre ins Bildungswesen wechselt, nach dieser Zeit nicht so ohne weiteres den Anschluss an das Niveau finden kann, das jemand erreicht hat, der sieben bis acht Jahre im Betrieb geblieben ist.
Fast alle Ausbilder weisen auf die Bedeutung der pädagogischen Expertise hin, die man sich erst im Laufe der Jahre erarbeitet.
„Bis jemand soweit ist, dass er eine Gruppe führen kann, vergeht ein dreiviertel Jahr und dann beherrscht er nur einen Bereich [der gesamten Ausbildung]. In sieben bis acht Jahren ist er vielleicht einmal in allen Bereichen gewesen.
Diese Maßnahme wird von mir negativ beurteilt, ganz anders als die Hospitation und die Rotation. Mir scheint auch eine Unterschätzung des Pädagogischen vorzuliegen. Das Fachwissen ist sicherlich ein hoher Prozentsatz [der Qualifikation des Ausbilders], aber dazu kommen eben noch weitere wichtige Fertigkeiten im Umgang mit den Auszubildenden.“ (BPO 123/133).
Der Wechsel von Ausbildern zurück in die Betriebe und betrieblichen Labors oder Werkstätten ist angesichts des schnellen Veränderungstempos in den Betrieben sicherlich ein Problem. Wenn es mehr als drei Jahre dauert, bis ein Ausbilder seinen letzten Schliff bekommen hat und alle Bereiche der Ausbildung beherrscht, gibt es sicherlich gute Gründe einen solchermaßen qualifizierten Ausbilder weiter im Bildungswesen zu halten, statt seine erworbene Ausbildungskompetenzen durch die Versetzung in einen anderen Unternehmensteil wieder zu entwerten. Da die Organisation durch den Austausch mit neuem Personal auch neues Wissen aufnimmt, der Begrenzung der Aufenthaltsdauer also durchaus ein guter Grund zukommt, wird die Lösung in einer Mischung von Dauerausbildern und temporären Ausbildern gesehen.
In den Augen des Managements befindet sich der Ausbilder bezüglich seiner Ausbildungsmethoden mitten in einem Paradigmenwechsel. Statt Frontalunterricht und 4-Stufen-Methode einzusetzen, soll er sich zum Coach der Auszubildenden entwickeln. Aus der Perspektive der Ausbilder fällt der Wandel im Verständnis ihrer Tätigkeit eher nüchtern aus:
„Ich bin für einen gesunden Mix an Methoden. Wenn ich dem Auszubildenden beibringen will, wie er den Bohrer schleifen muss, dann ist die Vier-Stufen-Methode o.k., aber wenn es um Teamfähigkeit geht, dann kann man das mit dieser Methode sicherlich nicht machen, und der Ausbilder als Coach in einem Projekt ist dann die richtige Methode.“ (BSC 135/140).
Die Ausbilder betrachten es also als eine von mehreren Methoden, ihre Auszubildenden zu coachen, und nicht als einen Paradigmenwechsel, der ihre grundsätzliche Einstellung zu den Auszubildenden berührt. Die Rotation der Ausbilder innerhalb der Ausbildungsorganisation und die Betreuungsausbildung sollen nach Auffassung der Ausbildungsleitung dem Coaching den Weg ebnen, weil durch diese Maßnahmen der fachliche Vorsprung des Ausbilders gegenüber den Auszubildenden verringert wird und immer häufiger Situationen entstehen, in denen der Ausbilder kaum mehr situativ verwertbares Wissen hat als die Auszubildenden und sich darum neues Wissen mit ihnen gemeinsam aneignen muss. Nach den Interviews zu urteilen, ist ein solches Bewusstsein unter den Ausbildern bislang noch kaum entwickelt.
Die Betriebshospitation gehört zu den Maßnahmen, die die Ausbilder wieder dichter an die Arbeitsprozesse in den Betrieben und Werkstätten heranführen sollen. In den verschiedenen Berufsfeldern ist die Dauer der Betriebshospitation unterschiedlich. In der Abteilung Produktionstechnik beispielsweise hält man vier Wochen für angemessen, während andere Abteilungen auch eine Woche schon für ausreichend erachten.
„Von 10 Kollegen in unserem Team waren in diesem Jahr 2 für vier Wochen auf Wechselschicht. Ca. 10 bis 20 % der Ausbilder eines Jahres sind also mal draußen. Ich bin auch selbst draußen gewesen. Ich finde es gar nicht so schlecht, auch mal die Wechselschicht kennen zu lernen. Ich bin in den Betrieb gegangen, in dem ich zehn Jahre gearbeitet habe. Von der Mannschaft ist fast keiner mehr da. Die, die noch da sind, sind in der Führungshierarchie drin.
Interviewer: Haben Sie den Eindruck, dass das Wissen über die Verhältnisse draußen in den Betrieben in ihrem Ausbilderteam angewachsen ist?
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Eher ist es so, dass eine Grundhaltung befördert wird, ein Verständnis für den Beruf, ein Verständnis für das, was die Auszubildenden, die von draußen in das Bildungswesen zurückkommen, berichtet wird und ein Verständnis für das, was die Umschüler aus ihren Betrieben berichten. Das direkte Wissen von draußen kann man nicht mit hier reinbringen.“ (BBA 78/105).
Die Unterscheidung zwischen dem Wissen um die Verhältnisse in den Betrieben und der „Grundhaltung“ der Ausbilder ist von großer Bedeutung bei der Bewertung der Hospitation. Das Wissen, das man durch eine Hospitation in einem Betrieb gewinnt, ist sicherlich kaum repräsentativ für die Verhältnisse des Gesamtunternehmens. Allerdings verändert sich durch die Erfahrung während der Hospitation bereits die Haltung des Ausbilders gegenüber den Auszubildenden und gegenüber den Ausbildungsinhalten: Die Bedeutung und Relevanz einzelner Positionen im Ausbildungsplan wird durch die eigene Erfahrung gebrochen und der Ausbilder kommt zu einer veränderten Wertung der Themen und Inhalte, die in der Ausbildung vermittelt werden.
„Meine eigene Erfahrung: Ich wollte die Situation eines Handwerkers kennen lernen und bin in einen Blaumann geschlüpft und habe jemanden gefunden, der mich mitnehmen wollte. Aber ich konnte fast nichts machen. Überall wo ich war, war es zu gefährlich. Meine Betriebskenntnisse waren zu dürftig. Die Woche hat nicht einmal gelangt, um mich anzulernen.“ (BGR 113/156).
Auch Ausbildungsleiter sammeln durch Hospitationen recht nachhaltige Erfahrungen:
„Bei mir war es so, dass ich absoluter Neuling in dem Betrieb war, wo ich hingekommen bin, und dort Auszubildende von mir getroffen habe, die sich schon recht gut auskannten. Ich war hilflos wie ein Baby, aber ich hatte kein Problem damit und habe mir von ihnen alles Nötige zeigen lassen. Jeder akzeptiert, dass der Ausbildungsleiter ziemlich weit weg von der handwerklichen Arbeit ist und jeden Tag in seinem Büro sitzt und ganz andere Dinge [macht].“ (BGR 113/156).
Damit die Hospitation zum organisationalen Lernen der Ausbildungsabteilung wird, muss es in ihr zu einem Zuwachs an Wissen kommen. Doch wie soll das geschehen, wenn die Erfahrungen doch eher persönlicher Natur sind? Die Hospitanten eines Jahres machen einen Workshop, in dem die Erlebnisse ausgewertet werden. In dieser Reflexion der persönlichen Erfahrung werden auch Maßnahmen für die Ausbildung abgeleitet, die sehr konkret sind. Beispielsweise wurde den Ausbildern deutlich, wie wichtig es ist, dass die Auszubildenden lernen, selbständig zu arbeiten und auch komplexe Aufgaben zu bearbeiten, dass sie lernen, Teilaufgaben nach Wichtigkeit und Machbarkeit zu gewichten, und auch lernen, die Zeit einzuteilen. Dies sind zwar alles Themen, die jedem, der sich mit moderner Arbeitsorganisation beschäftigt, geläufig sind. Aber wie bedeutsam ist dieses Wissen im Handeln der Ausbilder? In den Interviews haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Ausbilder durch die persönliche Erfahrung moderner Arbeitsorganisation tief beeindruckt waren und darum neuen Formen in der Ausbildung aufgeschlossener gegenüberstanden als vorher.
Wenn für die Organisation relevantes Wissen durch die Hospitation gewonnen werden soll, dann brauchen die Hospitanten einen Untersuchungsauftrag, d.h. konkrete Fragen aus dem Bildungswesen, die während der Hospitation beantwortet werden sollen. Dies kann am Beispiel der metalltechnischen Grundausbildung vorgeführt werden:
„Wir haben z.B. immer wieder die Diskussion über die reinen handwerklichen Tätigkeiten. Welche Maschinen werden eingesetzt, was wird noch handwerklich gemacht. Früher hatten die Auszubildenden den Eindruck, dass das erste Ausbildungsjahr fast nur aus Feilen besteht. Das war zwar überdramatisiert, aber wenn man sich das mal genauer angeschaut hat, dann war schon ziemlich viel Feilen dabei. Draußen wurde, außer zum Entgraten, aber die Feile kaum noch benutzt. Dafür wurde draußen viel mit dem Winkelschleifer gearbeitet, was in der Ausbildung nicht vorkam. Wir hatten zwar immer die ABB´s gefragt, also die Meister, die in den Betrieben für die Ausbildung zuständig sind. Aber die hatten uns darin bestärkt, den Anteil des Feilens im ersten Ausbildungsjahr nicht zu reduzieren.
Vor allem bei den älteren Meistern existiert noch ein Ideal des Berufs, das sehr stark von der unmittelbaren handwerklichen Tätigkeit geprägt ist, und auch die Prüfungen sind genau auf diese handwerklichen Tätigkeiten fokussiert. Es ist nicht so einfach, die Ausbilder von diesem Ideal abzubringen und ihnen klar zu machen, dass die Selbständigkeit eine mindestens ebenso große Rolle spielt.“ (BKO 69/172).
Eine Untersuchungsfrage, die durch die Hospitationen und die Diskussion der Ergebnisse geklärt werden soll, wäre also die nach der Bedeutung, die die Handarbeit heutzutage noch in der metalltechnischen Arbeit spielt. Eine wichtige Funktion der Betriebshospitation besteht darin, dass sich die Ausbilder ein eigenes Urteil von der Arbeit in den Werkstätten und Betrieben bilden. Gerade die starke Ausprägung von Traditionen im Beruf kann dazu führen, dass z.B. die Meister, die die handwerkliche Arbeit nicht mehr selbst ausführen, sondern organisieren und vorbereiten, mehr Wert auf die Tradition, hier das Feilen, legen als auf die Vermittlung der aktuell benötigten Fähigkeiten. Nutzt das Bildungswesen nur den Meistern als Rückkopplungsinstanz, dann kann es dazu kommen, dass Ausbildungsinhalte Bestand haben, die sich der Tradition verdanken, aber mit modernen Arbeitsinhalten nicht mehr viel zu tun haben. Dies spricht erstens für die Nutzung mehrerer Rückkopplungsschleifen und zweitens für eine inhaltliche Bewertung der Rückkopplungsresultate. Welche Bedeutung dieses Phänomen der Tradierung von Ausbildungsinhalten hat, zeigt die Situation in den neuen Berufen, die noch über keine Tradition verfügen:
„Maßnahmen zur Beförderung der Selbständigkeit sind besonders da erfolgreich, wo wir einen ganz neuen Beruf kreiert haben, in dem es noch keine alten Traditionen gibt, die man überwinden muss: den Mechatroniker. Hier wird praktisch vom ersten Tage an ein Projekt (Förderband) durchgeführt, von dem auch die Ausbilder noch nicht wissen, wie das Resultat aussehen wird. An diesem Projekt haben sie Planen und Beschaffen gelernt. In den Zusammenhang der Umsetzung dessen, was sie sich ausgedacht haben, wurden die Tätigkeiten eingebettet, die sie lernen mussten und diese Tätigkeiten haben sie relativ rasch gelernt, weil eine hohe Motivation da war.
In den bestehenden Berufen haben wir das inzwischen auch umgesetzt, aber dort hat es viel länger gedauert. Die Ausbilder, die ihre bisherige Arbeit nach dem Prinzip vom Einfachen zum Schweren organisiert hatten, konnten sich nur schwer damit anfreunden, dass man dieses Prinzip auf den Kopf stellt und an den Anfang der Ausbildung etwas sehr Komplexes stellt und ein komplexes Projekt plant, noch bevor man alle Tätigkeiten beherrscht, die darin benötigt werden.“ (BKO 69/172).
Der Anstoß für solche Veränderungen der Lehrmethoden kommt kaum aus der Ausbildungsorganisation selbst, sondern verdankt sich der Rückkopplung mit den Betrieben und Werkstätten, in denen selbständiges Arbeiten zu den selbstverständlichen Kompetenzen zählt. Haben die Ausbilder die Erfahrung gemacht, welche Bedeutung die Selbständigkeit in modernen Arbeitsprozessen hat, dann ist der Entwicklung neuer Lehrmethoden eine beträchtliche Hürde genommen.
Fassen wir die ausführlichen Befunde der untersuchten Organisation zusammen, so zeichnet sich folgendes Bild ab. Durch eine Reihe organisationaler Maßnahmen wurde ein Lernprozess in der Organisation etabliert, der unabhängig von den Individuen existiert: Es ist dem Ausbilder nicht freigestellt, eine Hospitation zu machen oder sie auch sein zu lassen, sondern es gibt Regelungen, die ihm die regelmäßige Hospitation vorschreiben. Es ist auch nicht beliebig, was während der Hospitation gemacht wird, sondern die Organisationsteile des Bildungswesens, die Mitarbeiter in die Betriebe oder Werkstätten schicken, geben ihnen einen Untersuchungsauftrag mit. Das Resultat wird in einem Workshop reflektiert, die Resultate in einer Datenbank der Organisation für alle zugänglich abgelegt. Auf diese Weise lernt das Bildungswesen regelmäßig etwas über die reale Außenwelt, für die ausgebildet werden soll, hinzu und berufliche Facharbeit als Bezugspunkt des pädagogischen Handelns der Ausbilder erhält schärfere Konturen.
Aus der Erfahrung, dass Ausbilder sich zu sehr auf ein kleines Segment der Ausbildung spezialisierten, wurde eine organisatorische Regelung getroffen, die jedenfalls für den größten Teil der Ausbilder sicherstellt, dass sie das Ganze der Ausbildung im Auge behalten (Ganzheitliche Ausbildung und Betreuungsausbilder). Diese Maßnahme verbindet allerdings zwei Ziele, die auch mehr oder weniger offen vom Management benannt werden: Der Ausbilder soll nicht nur ein Bewusstsein für das Ganze der Ausbildung entwickeln, sondern auch flexibel innerhalb des Bildungswesens eingesetzt werden können. Das letzte Ziel ist weniger der Ausbildung geschuldet als dem Personalabbau.
Und auch die Beschränkung der Zeit, die zumindest ein Teil der Ausbilder im Bildungswesen verbringen wird, dient nicht nur dem Input mit Mitarbeitern, die noch ganz frische Erfahrungen aus der aktuellen Arbeitspraxis der Betriebe haben, sondern mindestens ebenso sehr dem Output nicht mehr benötigter Ausbilder.
Die Kompetenzentwicklung der Ausbilder wird schließlich eingespannt in eine ausdifferenzierte Hierarchie, in der ein großer Teil der Zeit mit Bewertungen und Kontrolle der jeweils darunter liegenden Hierarchieebene verbracht wird. Hier besteht meiner Ansicht nach eine Gefahr für den Kontakt des Bildungswesens zur Realität und für den Übergang in ein „autistisches“ Organisationsverhalten, da der Maßstab an dem die Kompetenz der Ausbilder gemessen wird, relativ abstrakt ist. Wie viel Verantwortungsbereitschaft zeigt beispielsweise ein Ausbilder, der dem zeitlichen Druck unter dem er steht, nachgibt und sich mehr um die Fachausbildung kümmert als um die Betreuungsausbildung? Oder wie viel fachliche Kompetenz weist ein Ausbilder auf, der das Konzept der Betreuungsausbildung ernst nimmt und mit seinen Auszubildenden in Bereiche der Ausbildung vorstößt, die auch ihn fordern und in denen er noch kaum aktuelle Fachkenntnisse besitzt? Weitere Fragen dieser Art, die die Bewertung der Kompetenz des Ausbilders zu einer Interpretation seiner Vorgesetzten macht, die sich im Spannungsfeld betrieblicher Effizienzüberlegungen und alltagsferner Kompetenzraster bewegt, kann man ebenso für die anderen Kompetenzfacetten aufstellen, wie z.B. Ergebnisorientierung, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Kundenorientierung.
Organisationales Lernen ist notwendig auf individuelles Lernen und individuelles Verständnis angewiesen. Ohne die Bereitschaft des Ausbilders, beispielsweise im Betrieb zu lernen, was die aktuellen Anforderungen an die beruflichen Fachkräfte sind, scheitert das organisationale Verfahren der Hospitation und damit auch das organisationale Lernen. Dieses individuelle Lernen sieht sich allerdings einem Spannungsfeld ausgesetzt: Einerseits ist der Ausbilder aufgerufen, sich weitgehend eigenständig um die Beziehung der Ausbildungsprozesse auf die Arbeitsprozesse zu kümmern. Aber in der Bewertung seiner Kompetenz durch seinen Vorgesetzten spürt er das Wirken eines Kompetenzrasters, dass von den Zwängen in denen er sich bewähren muss, abstrahiert. Dieses Einspannen in eine Hierarchie kann leicht dazu führen, dass sich die Ausbilder mehr um die Maßstäbe kümmern, nach denen sie in der Hierarchie bemessen werden, als um die Sinnhaftigkeit ihrer pädagogischen Handlungen. Auch im untersuchten Bildungswesen ist die Ankündigung des „Dienstes nach Vorschrift“ immer noch als eine Drohung gemeint.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Maßnahmen organisationalen Lernens im Bildungswesen klar identifizierbar sind, aber der Versuch durch eine strenge Hierarchie widersprüchliche Ziele zu realisieren – sowohl den Ausbau einer guten Ausbildung als auch den Abbau des Ausbildungspersonals – droht die Resultate dieses Lernprozesses zu hintertreiben.
Wie treibt das untersuchte Bildungswesen die Curriculumentwicklung weiter? Nach Abschluss der Untersuchung wurde ein Projekt aufgelegt, dass sich „Lernort Betrieb“ nennt. Die Hospitationen der Ausbilder wurden weiter entwickelt. Statt eines „Abenteuerurlaubs“ im Betrieb, wie die Hospitation spöttisch genannt wurde, entwickeln die Ausbilder während ihres Aufenthalts in den Betrieben nun betriebliche Curricula in Zusammenarbeit mit den Fachkräften vor Ort. Die Dauer der Ausbildungszeiten in den zentralen Werkstätten und Lehrlaboren wurden weiter zugunsten der betrieblichen Ausbildungszeiten reduziert.
Lässt sich abschließend festhalten, dass das untersuchte Bildungswesen ein lernendes Bildungswesen ist? Die Frage ist nicht einfach nur positiv zu beantworten, da sich im Detail zeigt, dass zwar vieles auf der einen Seite durchaus dem theoretischen Konstrukt des organisationalen Lernens entspricht und man z.B. in Bezug auf die Rückkopplungsschleifen des Bildungswesen durchaus von deutero learning sprechen kann, aber auf der anderen Seite drohen Effekte des organisationalen Lernens durch ökonomische Maßnahmen konterkariert zu werden (z.B. beim Betreuungsausbilder, der in einem systematischen Konflikt zwischen der Realisierung ökonomischer Kennziffern und der Realisierung wesentlicher Bestandteile des Betreuungskonzepts befangen ist). Dieser Widerspruch ist uns allerdings auch in den anderen Fällen organisationalen Lernens immer wieder begegnet und ist daher keine Besonderheit des Bildungswesens.
ARGYRIS, C.; SCHÖN, D. A.(1999): Die lernende Organisation. Stuttgart: Klett-Cotta.
BAUSCH, T. (1997): Die Ausbilder im dualen System der Berufsbildung. Bielefeld: Bertelsmann.
BEHR, M. VON (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. Materialien und Analysen zur beruflichen Bildung im 19. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Campus.
BRIKEN, K. (1999): Nicht nur die Chemie muß stimmen. In: Mitteilungen / Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI), Nr. 27, 83-96.
DREXEL, I./ NUBER, C. (1979).: Qualifizierung für Industriearbeit im Umbruch: Die Ablösung von Anlernung durch Ausbildung in Großbetrieben von Stahl und Chemie. Frankfurt a. Main : Campus.
FISCHER, M. and RÖBEN, P. (2001) (eds.) Ways of Organisational Learning in the Chemical Industry and their Impact on Vocational Education and Training. A Literature Review, ITB-Arbeitspapiere Nr. 29. Bremen: Institut Technik & Bildung der Universität.
FISCHER, M. and RÖBEN, P. (2002) (eds.) Cases of Organisational Learning in European Chemical Companies. An Empirical Study, ITB-Arbeitspapiere Nr. 35. Bremen: Institut Technik & Bildung der Universität.
FISCHER, M. and RÖBEN, P. (2004) (eds.) Organisational Learning and Vocational Education. An empirical Investigation in the European Chemical Industry, ITB-Arbeitspapiere Nr. 47. Bremen: Institut Technik & Bildung der Universität.
KÄDTLER, J. (2000): Die Großen werfen ihre Netze aus – Zum Verhältnis von Zentralisierung und Netzwerkkonfigurationen in der deutschen Chemieindustrie. In: MINSSEN, H. (Hrsg.): Begrenzte Entgrenzungen. Berlin: edition sigma, 47-70.
KERN, H. (1991): Der Betrieb als Erziehungsinstitution. In: PÄTZOLD, G. (Hrsg.): Quellen und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in Deutschland ( Band A/3/2). Köln, Wien: Böhlau, 603-607.
KERN, H.; SCHUMANN, M. (1984): Das Ende der Arbeitsteilung. München: C.H. Beck.
KERN, H.; SCHUMANN, M. (1970): Industriearbeit und Arbeiterbewußtsein. Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt.
MICKLER, O. (1975): Technik, Arbeitsorganisation und Arbeit. Göttingen, 1975.
MICKLER, O. (1981): Facharbeit im Wandel, Campus, Frankfurt/NewYork 1981.
PÄTZOLD, G.; DREES, G.; THIELE, H. (1998): Kooperation in der beruflichen Bildung. Hohengehren: Schneider.
RAUNER, F. (2004): Qualifikationsforschung und Curriculum. Bielefeld: W. Bertelsmann.
SCHMIDT-HACKENBERG, B.; NEUBERT, R.; NEUMANN, K.-H.; STEINBORN, H.-C. (1999): Ausbildende Fachkräfte – die unbekannten Mitarbeiter. Bielefeld: Bertelsmann.
Beitrag online seit 09.04.2006