|
| ||




In der Novellierung des Schulgesetzes von 2006 hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen die Qualitätsanalyse als grundsätzliche Aufgabe von Schulaufsicht festgeschrieben. Das Schulgesetz (SchulG) legt in § 86 fest: „(4) Die Schulaufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die Angelegenheiten der Schulen und Studienseminare informieren und dazu Unterrichtsbesuche und Besuche von Seminarveranstaltungen durchführen. (5) Die Befugnisse nach Absatz 4 stehen auch den für die Qualitätsanalyse an Schulen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der oberen Schulaufsichtsbehörde zu. Sie sind hinsichtlich ihrer Feststellungen bei der Durchführung der Qualitätsanalyse und deren Beurteilung an Weisungen nicht gebunden (…)“.
Und nach § 3 Abs. 4 SchulG sind "Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer (...) verpflichtet, sich nach Maßgabe entsprechender Vorgaben der Schulaufsicht an Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu beteiligen (…). Dabei sind die Schulaufsichtsbehörden verpflichtet, die Schulen in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu beraten und zu unterstützen."
Die Zielsetzung der Qualitätsanalyse ist in der Verordnung über die Qualitätsanalyse an Schulen in Nordrhein-Westfalen festgeschrieben. Da heißt es unter „(1) Qualitätsanalyse dient dem Ziel, die Qualität von Schulen zu sichern und nachhaltige Impulse für deren Weiterentwicklung zu geben (…). Die Ergebnisse sollen für gezielte Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in den einzelnen Schulen sowie für entsprechende Unterstützungsleistungen der Schulaufsichtsbehörden und Steuerungsmaßnahmen des Ministeriums genutzt werden.“
Die Qualitätsanalyse soll somit Schulen in ihren Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen unterstützen und voranbringen. Sie soll dazu beitragen, dass Schulen ihre:
• Stärken als solche erkennen,
• Schwächen erkennen und zur Verbesserung nutzen,
• Unterrichtsqualität erkennen, einschätzen, stärken und fördern,
• Unterrichtsentwicklung betreiben,
• Schulentwicklung initiieren.
Sind diese Ziele auch die der Schule und im Schulprogramm festgeschrieben, liegt zudem das Bestreben aller Beteiligten darin, sie auch zu verwirklichen, dann ist es notwendig, diese Ziele in Abständen intern zu evaluieren.
Schulen sollen sich öffentlich für ihr Handeln verantworten (MSW 1997b), indem sie ihr grundlegendes Konzept, die pädagogischen Ziele und deren Wege im Schulprogramm beschreiben. „Ein Schulprogramm beschreibt die grundlegenden pädagogischen Ziele einer Schule, die Wege, die dorthin führen, und Verfahren, die das Erreichen der Ziele überprüfen und bewerten. Es ist damit das zentrale Instrument der innerschulischen Verständigung und Zusammenarbeit, die darauf zu richten sind, die Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit weiterzuentwickeln und auf einem hohen Niveau nachhaltig zu sichern“ (MSW 1997). Auf dieser Grundlage überprüft die Schule in regelmäßigen Abständen den Erfolg ihrer Arbeit selbst durch interne Evaluation (vgl.: SchulG § 3 Abs. 2).
Die Struktur des Schulprogramms enthält als Grundbestandteile:
• Die Schuldarstellung (Elemente z.B. Leitbild einer Schule, pädagogische Grundorientierungen und Erziehungsauftrag, Bericht über die bisherige Entwicklungsarbeit),
• Eine Planung der Schulentwicklung (mit den Elementen Entwicklungsziele, Arbeitsplan, Fortbildungsplanung, Planungen zur Evaluation) (MSW 2005).
Dabei sind die Felder Unterricht und Erziehungsarbeit unter Einbeziehung des Prinzips der umfassenden Förderung aller Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise zu berücksichtigen (vgl.: www.learnline.nrw.de/angebote/schulprogramm). Somit enthält dieses Programm Gegenstandsbereiche einer Schule, die zu einer externen Evaluation wesentliche Beiträge liefern kann. Ist das Schulprogramm bei einer externen Evaluation zu berücksichtigen, dann müssen sich Qualitätsbereiche und auch Qualitätsaspekte und Qualitätskriterien zur Beurteilung des Unterrichts auf das Schulprogramm beziehen. Das Schulgesetz legt lediglich fest: “Das Schulprogramm ist ein zentraler Bestandteil der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung“ (SchulG § 3 Abs. 2).
Hat eine Schule in NRW einen Termin zur Qualitätsanalyse erhalten, wird sie von den Qualitätsprüfern über das Prozedere und den Ablauf informiert. Es liegt im Ermessen des Schulleiters, ob er das Lehrerkollegium, die Eltern, die Betriebsvertreter, die Schüler und Vertreter des Schulträgers an der Informationsveranstaltung beteiligt oder ob er die Information selbst weitergibt.
Das Ablaufverfahren der Qualitätsanalyse ist wie folgt strukturiert:
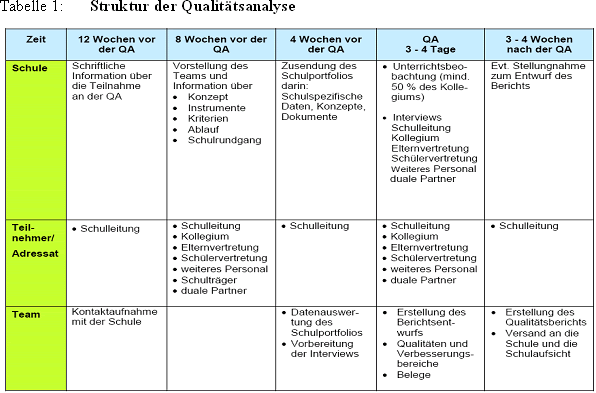
Die Analyse wird mit standardisierten Frage- und Erhebungsbögen und anderen Verfahren durchgeführt und an allen Schulformen werden die gleichen Instrumente eingesetzt:
• Schulportfolio mit Dokumentenübersicht
• Schulrundgang
• Gesprächsleitfäden
• Unterrichtsbeobachtungsbogen
• Zusammenfassende Bewertung – Qualitätsprofil.
Das Schulportfolio ist eine Daten- und Dokumentensammlung, die jede Schule ca. 4 Wochen vor dem Schulbesuch den zugeordneten Dezernat des Regierungsbezirks zur Verfügung stellen muss. Dieses Portfolio bildet die Grundlage zur ersten vorläufigen Orientierung der Qualitätsprüfer und dient der Vorbereitung des Besuchs im Rahmen der Qualitätsanalyse und enthält Rahmendaten und Dokumente zur schulischen Situation und zur pädagogischen Arbeit der Schule (vgl.: MSW 08/2007).
Obwohl viele Daten bekannt sein sollten, liefert jede Schule Angaben zu folgenden Bereichen:
I Angaben zur Schule
II Gesonderte Angaben zu Schülerinnen und Schülern
III Abschlüsse
IV Gesonderte Angaben zu Lehrerinnen und Lehrern
V Merkmale des Schulstandortes
VI Gebäude- und Raumsituation
VII Unterrichtsversorgung – Mangel- und Überhangfächer
VIII Kurzüberblick zur Schul- und Unterrichtsarbeit
IX Kurzüberblick zur Schulentwicklung und Evaluation.
Auf 12 Seiten werden den Schulen aus diesen Bereichen Antworten und Angaben abverlangt, die auch aus den Schulstatistiken bekannt sein sollten. Diesen Daten sind zehn Dokumentationen obligatorisch, acht Dokumentationen wenn vorhanden und 15 Dokumentationen zum Schulbesuch der Qualitätsprüfer hinzuzufügen. Falls einige dieser Materialien in der Schule nicht zur Verfügung stehen, wird um eine kurze Erläuterung am Ende des Portfolios gebeten.
Die zehn obligatorischen Dokumentationen sind:
• Schulprogramm
• Arbeitsplan zur Umsetzung des Schulprogramms
• Fortbildungsplan
• Themen schulinterner Fortbildungen aus den letzten drei Schuljahren
• Schul- und Hausordnung
• Geschäftsverteilungsplan/ Organisationsplan
• Stellenbesetzungsplan
• Dokumente zur internen Evaluation (Schwerpunkte aus Unterrichts- oder Erziehungsarbeit u. a.)
• Dokumente der Teilnahme an Modellvorhaben (z.B. Selbständige Schule, EU-Programme etc.)
• Jahresterminplan für das laufende Schuljahr.
Ein Fragebogen für den Schulrundgang gibt den Qualitätsprüferinnen und -prüfern Gelegenheit, sich über den baulichen Zustand des Schulgebäudes und Schulgeländes zu informieren sowie über die sächliche Ausstattung der Schule. Zum Schulrundgang wurde der Schulträger seitens der Schulleitung eingeladen.
Die Gesprächsleitfäden sind für die Qualitätsprüfer die inhaltliche Grundlage für die Interviews mit Schulleitung, Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schüler und dem nicht lehrenden Personal an der Schule.
Der Unterrichtsbeobachtungsbogen ist das Herzstück der Qualitätsanalyse zur Evaluierung von Unterricht. Er berücksichtigt die in der empirischen Unterrichtsforschung nachgewiesenen Merkmale von gutem Unterricht und gibt Aufschluss über die Unterrichtsqualität.
Die Veröffentlichung des Qualitätstableaus soll Schulen im Vorfeld der Qualitätsanalyse konkrete Anhaltspunkte für die eigene Schulentwicklung geben. Es soll auch dazu beitragen, dass der Dialog zwischen Schule und Schulaufsicht im Anschluss an die Ergebnisse der Qualitätsanalyse auf eine einheitliche Grundlage gestellt wird. Es ist auch Bezugsrahmen für die externe Evaluation von Schulqualität, gibt aber auch Impulse für die interne Evaluation. Das vorliegende "Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse an Schulen in Nordrhein-Westfalen" fasst Kriterien und Standards in sechs Qualitätsbereiche, denen jeweils 28 Qualitätsaspekte zugeordnet sind. Konkretisiert werden die Qualitätsaspekte durch insgesamt 153 Qualitätskriterien.
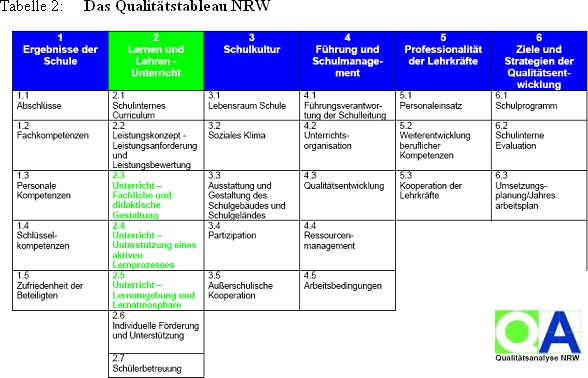
Es stellt sich die Frage, wie kann dieses Qualitätstableau zu einer objektiven und der einzelnen Schule gerecht werdenden Beurteilung führen? Wie werten die Qualitätskriterien die Individualität des „Mikrokosmos Schule“?
Sieht man sich zu den Qualitätsaspekten die zugehörigen Qualitätskriterien an, so stellt man fest, dass hier Schulform übergreifend Erwartungen an alle Beteiligten der Schule gestellt werden, die mit der evaluierten Schule nicht immer in Einklang gebracht werden können.
Das folgende Beispiel soll zeigen, dass die vorgefertigten Indikatoren des Qualitätsaspektes „Unterricht – fachliche und didaktische Gestaltung“ festgelegte Erwartungen zu erfüllen haben und die Individualisierung des Unterrichts nicht berücksichtigen.
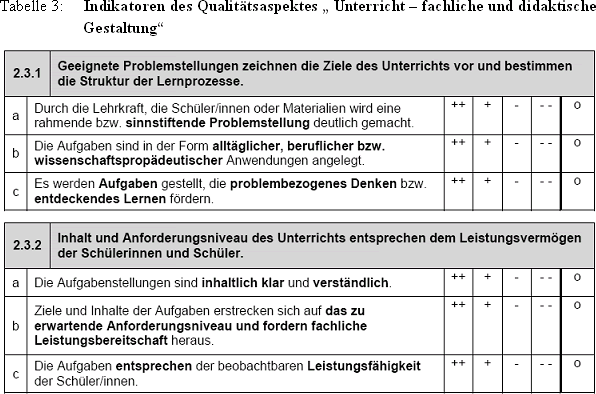
Kann während einer Informationsphase in einer Lerngruppe, in der Schüler sich durch Materialien kämpfen, beobachtet werden, ob das zu erwartende Anforderungsniveau sich auf die Inhalte und Ziele des Unterrichtes oder sogar der Unterrichtsreihe erstrecken und diese fachliche Leistungsbereitschaft herausfordern? Kann diese normierte Beobachtung einen objektiven Eindruck über den tatsächlichen Unterricht geben? Die Gespräche der Schulleitung am Ende der Qualitätsanalyse mit den Qualitätsprüfern haben gezeigt, dass Sie von dieser Normierung der Indikatoren nicht abweichen und weder Kommentare noch Hinweise zur Verbesserung entgegen nehmen.
„Der Indikatorenkatalog geht auf die Besonderheiten der Einzelschule überhaupt nicht ein; er schlägt sämtliche Schulen über denselben Leisten. Was eine gute Schule ausmacht, bestimmt einem Rezeptbuch gleich das Qualitätstableau. Welche Ziele und Schwerpunkte die Schule sich im Schulprogramm setzt, wie sie ihre Qualität verbessern und sichern will, ist nahezu irrelevant; das Schulprogramm kommt nur mittelbar zur Geltung, und zwar dann, wenn es bei der schulinternen Evaluation, deren Ergebnisse nach § 3 Abs. 6 Satz 2 Qualitätsanalyse-Verordnung bei der Qualitätsanalyse einzubeziehen sind, thematisiert. In den insgesamt 153 Indikatoren des Qualitätstableaus wird das Schulprogramm nur sechsmal erwähnt.“ (AVENARIUS 2008).
Der Qualitätsbericht, der das BK Hennef mit viermonatiger Verspätung erreichte, fasst seine Beurteilung in den so genannten „Zentralen Befunde“ zusammen:
„Das Berufskolleg Hennef ist eine gut organisierte Schule mit geregelten Abläufen, verlässlichen Absprachen, Regeln und Ritualen. Es herrscht ein sehr gutes Arbeitsklima und die Zufriedenheit mit der Schule ist bei allen beteiligten Gruppen ausgesprochen hoch.
Ein offener, respektvoller Umgang und ein freundlicher Ton bestimmen das Miteinander aller Beteiligten. Dies und eine durchweg gute Ausstattung bieten die positiven Rahmenbedingungen für das Lernen. In der Schule sind gute Rahmenbedingungen für Lehr- und Lernprozesse geschaffen. Die in dem Berufskolleg gestaltete Kommunikationskultur und die vielen Teilnahmemöglichkeiten an Entscheidungsprozessen tragen mit zu einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre bei. Damit ist eine hohe Zufriedenheit aller Beteiligten verbunden. Diese ist dem Qualitätsprüferteam durchgängig von allen Gesprächspartnern vermittelt und vom Team auch während der Schulbesuchstage wahrgenommen worden. In den Bereichen, in denen nach der Bewertung des Qualitätsprüferteams auf der Grundlage des Qualitätstableaus NRW Entwicklungsbedarf gesehen wird, hat die Schule teilweise bereits selbst Handlungsbedarf gesehen, Planungen eingeleitet oder Initiativen entwickelt. Die Schule erhält in 10 von 28 Qualitätsaspekten, die bewertet wurden, die Bewertungskategorie „eher stark als schwach“ (Bewertungsstufe 3), in 12 Qualitätsaspekten sogar die Bewertung „vorbildlich“ (Bewertungsstufe 4) .
Die Aspekte
• 2.2 „Leistungskonzept – Leistungsanforderung und Leistungsbewertung“,
• 2.6 „Individuelle Förderung und Unterstützung“ und
• 4.2 „Unterrichtsorganisation“
wurden mit Stufe 2 „eher schwach als stark“ bewertet.“ (Qualitätsbericht 2007)
Die Zusammenfassung zeigt die Bewertungsstufen in den sechs Qualitätsbereichen und den entsprechenden Qualitätsaspekten.
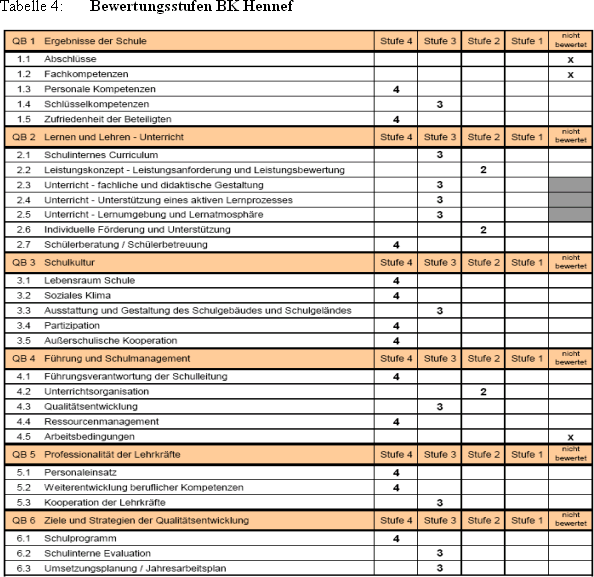
Zu den drei mit der Bewertung „eher schwach als stark“ versehenen Aspekten bietet der Qualitätsbericht Handlungsanweisungen an.
Leistungskonzept – Leistungsanforderung und Leistungsbewertung: Die Schule soll ein Leistungskonzept erarbeiten, in dem Grundsätze der Leistungsbewertung ausgewiesen sind. Insgesamt sollte die Transparenz der Leistungsbewertung gesteigert werden, z.B. auch dadurch, dass die fachliche Selbstkontrolle der Schüler einen höheren Stellenwert erhält, so dass auch die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung gefördert wird. Es sind Elemente einer solchen Standardisierung vorhanden, sie sollten aber im Sinne der Qualitätskriterien systematisiert werden.
Individuelle Förderung und Forderung: Im Bereich der Förderung und Forderung ist das Augenmerk auf eine Entwicklung zu richten, die den Schülerinnen und Schülern mehr Möglichkeiten der inneren Differenzierung ermöglicht. Bei der inneren Differenzierung könnten für einzelne Bearbeiter (und nicht kollektiv) solche Handlungssituationen aufgegriffen werden, die ihnen jeweils auch individuell in der Praxis als Problem erschienen waren und deren Bewältigung insofern auch einen individuellen Lernfortschritt bedeuten könnte.
Unterstützung des aktiven Lernprozesses: Durch die Unterrichtsbeobachtungen wird deutlich, dass Verfahren, die einen aktiven Lernprozess fördern, nicht genügend zur Anwendung kommen. Gruppen- oder Partnerarbeit, aber auch schülerzentrierte Lernprozesse im Plenum waren zwar bisweilen anberaumt, wirkten aber nicht schlüssig und waren eher auf Einzelarbeit ausgerichtet. Für die Entwicklung selbstständigen Arbeitens zeigte sich ein deutlicher Entwicklungsbedarf. Handlungsorientierte Ansätze, die die Planung und Überprüfung eines Lösungswegs vorsehen, konnten in den Besuchen wenig beobachtet werden. Zwar haben sich die Lehrer und Lehrerinnen durch Fortbildung Kompetenzen im Methodentraining erworben, davon muss aber zukünftig mehr in die praktische fachliche Unterrichtsarbeit einfließen.
Unterrichtsorganisation/ Vertretungsregelung: Bei der Unterrichtsorganisation werden die Vorschriften eingehalten. Es sollten aber sinnvolle Vertretungsregelungen durch moderne Kommunikationsmittel besser genutzt und weiter entwickelt werden (vgl.: Qualitätsbericht 2007).
Einige dieser von den Qualitätsprüfern vorgelegten Handlungsfelder sind durch interne Evaluationen schon vorher festgestellt worden und wurden von der Schule bereits abgearbeitet, bevor der Qualitätsbericht die Schule erreichte. Die anderen sind gemäß der Qualitätsanalyse Verordnung – QA-VO v. 27. April 2007 in einer Lehrer- und Schulkonferenz erörtert worden, Beschlüsse wurden gefasst und Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet, die an einem pädagogischen Tag gemeinsam von allen Kolleginnen und Kollegen entworfen wurden. Diese Verbesserungspotenziale wurden dann mit der Schulaufsicht abgesprochen und in einen Zielkatalog aufgenommen.
Die Qualitätsanalyse Verordnung (QA-VO) regelt die Beurteilung aller Schulformen in Nordrhein-Westfalen gleich im Rahmen einer Qualitätsanalyse. Dabei „werden Qualitätsteams eingesetzt, die die Qualität und die der Schulen auf der Grundlage eines standardisierten Qualitätstableaus ermitteln“ (QA-VO 2007). Die Qualitätsprüfer sind „bei der Durchführung der Qualitätsanalyse hinsichtlich ihrer Feststellung und deren Beurteilung an Weisungen nicht gebunden“ (QA-VO 2007) und können somit die Evaluation nach ihrem Gutdünken gestalten. Eine Beachtung der Individualität der einzelnen Schule und ihre im Schulprogramm festgelegten Verpflichtungen und Intentionen finden zu wenig Berücksichtigung. „Qualitätsanalyse dient dem Ziel, die Qualität von Schulen zu sichern und nachhaltige Impulse für deren Weiterentwicklung zu geben“ (QA-VO 2007). „Ob man dieses Ziel dadurch erreicht, dass man die Schulen an die Kandare eines vorgefertigten, kaum ein Detail außer Acht lassenden, für alle Schulen gleichermaßen verbindlichen Qualtitätsmusters nimmt (...), wage ich füglich zu bezweifeln“ (AVENARIUS 2008).
AVENARIUS, H. (2008): Wie die Schulautonomie durch externe Evaluation ausgehöhlt wird. In: Verband Der Lehrerinnen Und Lehrer An Berufskollegs In NRW e.V. (Hrsg.): Die Berufskollegs stärken heißt die berufliche Bildung zu stärken. Krefeld, 49 – 58.
MINISTERIUM für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (08/2007):Qualitätsanalyse Nordrhein-Westfalen. Impulse für die Weiterentwicklung von Schule. Düsseldorf.
MINISTERIUM für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [Hrsg.] (1997b): Entwicklung von Schulprogrammen. RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.1997, 14-23 Nr.1.
MINISTERIUM für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen [Hrsg.] (2005): Schulprogrammarbeit. RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 16.9.2005 - 521 - 6.01.04-32328.
SCHULGESETZ für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278).
VERORDNUNG über die Qualitätsanalyse an Schulen in Nordrhein-Westfalen
(Qualitätsanalyse-Verordnung – QA-VO) vom 27. April 2007 (GV. NRW. 2007 S. 185).
BERICHT ZUR QUALITÄTSANALYSE Berufskolleg Hennef 2007.
Internet (geprüft 28-07-2008)
http://www.learnline.nrw.de/angebote/schulprogramm
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/ Qualitaetssicherung/Qualitaetsanalyse/Das_Qualitaetstableau.pdf