|
| ||




Definition: Food Literacy ist die Fähigkeit, den Ernährungsalltag selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll zu gestalten.
Im Sinne des Leitbilds „Nachhaltige Entwicklung“ ist mit dem Themenfeld Ernährung eine Reihe von großen gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden. Kompetenter Umgang mit Ernährung ist daher ein wichtiger Bestandteil einer zukunftsfähigen Grundbildung. Food Literacy muss als Teil jener „Basisqualifikation“ betrachtet werden, die im „Memorandum über lebenslanges Lernen“ der EU-Kommission definiert und gefordert wird. Aus Untersuchungen ist bekannt, dass sozial benachteiligte und bildungsferne Personen von Ernährungsaufklärung besonders schlecht erreicht werden. Durch die Integration von Food Literacy in bestehende Bildungs- und Beratungsangebote können auch diese Zielgruppen angesprochen werden. Dabei geht es keineswegs darum, Menschen dazu zu bringen, sich an vorgegebene Ernährungsempfehlungen zu halten, sondern Food Literacy steht vielmehr für Empowerment im Sinne der Förderung von Selbstbestimmung beim Ernährungshandeln, für die Förderung einer angemessenen Entscheidungskompetenz, z. B. beim Umgang mit dem Überangebot an neuen Lebensmitteln, Kampagnen und Erlebnisofferten sowie für die Vermittlung von unbedingt erforderlichen Basiskompetenzen, z. B. die Zubereitung von Mahlzeiten aus frischen Produkten der Saison. Das Ziel von Ernährungsbildung im Sinne von Food Literacy steckt schon in der Definition: eine selbstbestimmte, verantwortungsbewusste und genussvolle Gestaltung des Ernährungsalltags zu ermöglichen. Hierzu wurden unter dem Titel „Schmackhafte Angebote für die Erwachsenenbildung und Beratung“ ein Handbuch und eine Toolbox entwickelt, mit umfassenden Hintergrundinformationen sowie Materialien und Methoden, die in einer Vielzahl von Bildungs- und Beratungsaktivitäten verwendet werden können. Das Material ist auf der Internetseite des Projektes ( www.food-literacy.org ) in acht Sprachen zum freien Download verfügbar.
Beim Thema „Essen“ kann jeder mitreden. Deshalb eignet es sich besonders zur Schaffung eines angenehmen Klimas überall da, wo einander unbekannte Menschen – gleich aus welchem Kulturkreis, welcher sozialen Schicht und welchen Alters – zusammentreffen, also auch in Veranstaltungen der Erwachsenenbildung. Zugleich besteht beim Thema Ernährung Nachholbedarf. Zunehmende Fehlernährung in sozial benachteiligten Milieus ist nur ein Indikator für sinkende Ernährungskompetenz. Deshalb hat es sich ein EU-Projekt zur Aufgabe gemacht, beide Perspektiven auf das Thema zu verschränken. Ergebnis ist das Konzept „Food Literacy“. Vorgeschlagen wird, gute und richtige Ernährung als Querschnittsthema in der Erwachsenenbildung zu etablieren. Danach ist nicht anzustreben, dem Thema eigene Veranstaltungen zu widmen, sondern unabhängig von Veranstaltungsform und -thema „Ernährung“ zu thematisieren und so zu einer „kulinarischen Kompetenzentwicklung“ beizutragen.
Die ursprüngliche Bedeutung von Literacy in der Erwachsenenbildung bezieht sich auf die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können. Der Begriff Literacy umfasst aber noch mehr, zum Beispiel die Fähigkeit, seine Gedanken schriftlich ausdrücken und Textzusammenhänge verstehen zu können.
In diesem Sinne ist auch Food Literacy zu verstehen. Nach der Definition ist „Food Literacy die Fähigkeit, den Ernährungsalltag selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll zu gestalten.“ Es geht also nicht nur darum, Lebensmittel zu kennen und damit umgehen zu können, sondern auch um das Verständnis der Zusammenhänge beim Ernährungshandeln.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, auch das Genießen können mit zu berücksichtigen . Das zentrale Anliegen von Food Literacy ist es, Menschen für das Thema Essen zu sensibilisieren. Food Literacy will nicht primär „gesunde Ernährung“ thematisieren, es geht nicht um Ernährungserziehung. Vielmehr soll das Thema „Essen“ als Vehikel genutzt werden, um Gruppenprozesse positiv zu gestalten. So lassen sich beispielsweise sehr gut kulturelle und soziale Unterschiede in Sprachkursen mit Migranten überwinden. Als erwünschter Nebeneffekt wird dabei das Bewusstsein für Ernährung gefördert. Ernährung wird normalerweise nur in speziellen Kursen und meistens im Zusammenhang mit Gesundheit thematisiert. So erreicht man aber nur bereits Interessierte. Mit Food Literacy soll das Thema in ein breites Spektrum von Angeboten der Erwachsenenbildung gelangen, z. B. in Alphabetisierungskurse, Integrationsmaßnahmen, Sprachkurse oder Angebote zur politischen Bildung. So sollen auch Menschen erreicht werden, die sich normalerweise nicht für Ernährung interessieren. Da es um das Essen und nicht in erster Linie um gesunde Ernährung geht, können sie sich unbeschwert auf das Thema einlassen.
Food Literacy will zur Selbstbestimmung beim Ernährungshandeln befähigen (vgl. Tabelle 1). Im Sinne von Empowerment gehört hierzu eine angemessene Entscheidungskompetenz, zum Beispiel beim Umgang mit dem Überangebot an Lebensmitteln oder mit den zahllosen Ernährungsempfehlungen. Im weitesten Sinne zählt auch die Vermittlung bzw. Erweiterung von Basisfertigkeiten wie die Zubereitung von Mahlzeiten aus frischen Lebensmitteln, möglichst entsprechend der Saison, dazu.
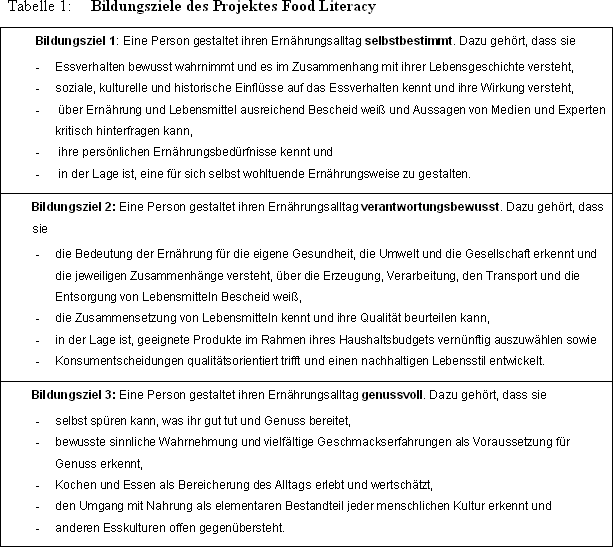
Konsumentinnen und Konsumenten steht eine große Vielfalt an Lebensmitteln zur Verfügung, und das Angebot erweitert sich ständig. Auch die Serviceangebote der Verkaufsstätten und Außer-Haus-Anbieter werden immer vielfältiger. Lebensmittel und Mahlzeiten sind rund um die Uhr erhältlich. Diese Angebotsvielfalt fordert vom Verbraucher laufend Entscheidungen, wobei die Zahl der Handlungsoptionen stetig zunimmt. In Familienhaushalten verlangen die Anforderungen der Berufswelt ein hohes Maß an Koordinationsleistung. Dabei konkurriert der Bereich Ernährung mit anderen, ebenfalls zeitaufwändigen Tätigkeiten, zum Beispiel Medienkonsum, um diese Ressource. Hierdurch verringert sich das Zeitbudget für den Ernährungsbereich ( Eberle et al.1999).
Die Speisenzubereitung samt Einkauf soll daher heute schnell und einfach erfolgen. Das Bedürfnis nach Vereinfachung und Entlastung hat zur Folge, dass die Zubereitung der Nahrung zunehmend außer Haus verlagert wird, was auch die Zahlen der „Trendstudie Food“ zeigen ( Haydn et al. 2005; ZMP 2006). Der Privathaushalt „produziert“ immer weniger selbst, er delegiert die ersten Stufen der Nahrungsherstellung an Handwerk und Industrie. Dies erfordert zusätzliche Kompetenzen für die Beurteilung der Verfahren der industriellen Lebensmittelherstellung, der Kennzeichnung von und den Umgang mit vorgefertigten Lebensmitteln. Während die Anforderungen zur Bewältigung des Ernährungsalltags steigen, sinken auf der anderen Seite die Kompetenzen. Ernährungskompetenz beinhaltet neben Kenntnissen über die Zusammensetzung der Nahrung unter anderem auch das Wissen über die richtige Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln. Bislang liegen keine detaillierten Studien über die Veränderungen der Ernährungskompetenzen vor, aber es gibt einige Hinweise für einen Rückgang dieser Fähigkeiten (vgl. HAYN et al. 2005). In einer repräsentativen Befragung waren jüngere Personen beispielsweise weniger von ihren Kochkompetenzen überzeugt als ältere Generationen: Nur 60 Prozent der unter 25-Jährigen bewerteten ihre Kochkünste als gut oder sehr gut, 30 Prozent fanden, dass sie weniger oder gar nicht gut kochen können ( STIESS/ Hayn 2005). Ähnliche Ergebnisse zeigte bereits auch die Iglo-Forum-Studie ´95 (vgl. Iglo-Forum 1995). HAYN u.a. (2005) kommen zu der Schlussfolgerung: Je jünger und kleiner die Haushalte, desto geringer sind die Kochkenntnisse. Das geringere Zeitbudget, aber auch veränderte Rollenmuster erschweren offensichtlich die Weitergabe von ernährungsrelevanten theoretischen Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten im Elternhaus (vgl. EBERLE u.a. 2005). So zeigen die Zeitbudgeterhebungen, dass Kinder und Jugendliche deutlich weniger an Arbeiten wie Kochen, Tisch decken oder Geschirr spülen beteiligt sind als früher (vgl. MEIER 2004).
Die Abnahme der Ernährungskompetenz trifft nicht nur auf junge Menschen zu. Dies gilt insbesondere für sozial benachteiligte Personengruppen (vgl. LEHMKÜHLER 2002), die zudem von der Ernährungsaufklärung kaum erreicht werden. Die zunehmende Fehlernährung in sozial benachteiligten Schichten ist hierfür ein Anzeichen.
Die Diskrepanz zwischen wachsenden Anforderungen und sinkenden Kompetenzen spürt nicht nur nahezu jeder Einzelne in seinem Ernährungsalltag. Zunehmend betreffen die Konsequenzen auch die Gesellschaft insgesamt. Daraus ergibt sich eine Chance für die Erwachsenenbildung: Essen und alles, was damit zusammenhängt, wird zum „bildungswürdigen „ Thema. An dieser Stelle setzt das Sokrates-Grundtvig-Projekt „Food Literacy“ an.
Es versteht sich als Beitrag zu einer Ernährungskultur, die auf Nachhaltigkeit, individuelle Selbstbestimmung und Freude am Essen setzt. An dem Projekt sind aus acht verschiedenen europäischen Ländern zwölf Institutionen aus den Bereichen Erwachsenenbildung, Verbraucherschutz und Ernährungswissenschaft beteiligt. Die Projektkoordination liegt beim österreichischen Weiterbildungsinstitut BEST (Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Wien) und der Initiative Geschmacksbildung in Kooperation mit Slow Food Wien. Der aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e.V. in Bonn hat maßgeblich an der Entwicklung der Materialien mitgearbeitet und ist verantwortlich für die Bekanntmachung des Projektes in Deutschland. Food Literacy will dazu anregen, das Thema Essen als „Vehikel“ zu nutzen, um beispielsweise kulturelle und soziale Unterschiede zu überwinden oder Gruppenprozesse positiv zu gestalten. Dies bietet sich zum Beispiel in Sprachkursen mit Migranten an. Gleichzeitig kann das Thema Essen mit seinen emotionalen Komponenten motivieren und nachhaltigen Lernerfolg bringen, beispielsweise wenn es in der Schuldnerberatung mit dem Thema Haushaltsbudget verknüpft wird. Zentrales Anliegen ist es, die Teilnehmer für das Thema Essen zu sensibilisieren. Wenn sie darüber hinaus motiviert werden, sich bewusst mit ihrem Ernährungsalltag auseinanderzusetzen, ist bereits viel erreicht.
Die Methoden von Food Literacy wurden in Pilotprojekten getestet und mit Praktikern aus der Erwachsenenbildung diskutiert. Es herrschte Konsens darüber, dass Food Literacy ein wichtiges Querschnittsthema ist, das sich in viele Bildungsangebote integrieren lässt. Dabei bestätigte sich, dass der Ansatz von Food Literacy insbesondere für bildungsferne Gruppen wie Migranten und manche Arbeitssuchende geeignet ist. Insbesondere bei multikulturell zusammengesetzten Gruppen wurde die Auseinandersetzung mit dem Thema Essen in zu einem gemeinsamen Nenner und trug zum Abbau von Barrieren bei. Manche der Teilnehmer erfuhren erst hier, dass genussvolles Essen gerade in Krisenzeiten zum Erhalt der Leistungsfähigkeit und des Selbstwertgefühls beitragen kann. Die Übungen aus dem Handbuch eignen sich insbesondere als Einstieg in ein Thema oder zur Auflockerung für zwischendurch. Die Kursteilnehmer bauen dadurch Hemmungen ab und kommen danach besser miteinander ins Gespräch.
Dies zeigen zum Beispiel die Erfahrungen des Wiener Piloten: In Wien sollten im März 2006 zehn Langzeitarbeitslose unterschiedlicher Herkunft (Albanien, Österreich, Serbien, Slowakei und Türkei) im Auftrag des Arbeitsmarktservice in einer sechswöchigen Schulung „beschäftigungsfähig“ gemacht werden. Die Stärkung des Selbstbewusstseins und das Erkennen persönlicher Fähigkeiten gehörten ebenso zu den Zielen wie die Vermittlung von EDV-Grundkenntnissen für die Erstellung von Bewerbungsunterlagen. Zu Beginn prägten gegenseitiges Unverständnis und eine negative Haltung gegenüber Gruppenmitgliedern anderer Kulturen die Atmosphäre. Die Trainerin schlug vor, gemeinsam am PC ein Kochbuch zu gestalten. Nach anfänglicher Skepsis begann ein Austausch, die Teilnehmer entdeckten Gemeinsamkeiten bei den Speisen und lernten kulturelle Unterschiede kennen und sie zu akzeptieren. Gleichzeitig erlernten sie den Umgang mit dem Computer, recherchierten im Internet und erstellten Seiten für das gemeinsame Kochbuch. Am Ende des Kurses gab es ein Büfett, für das alle ihre Lieblingsspeisen mitbrachten. Die Trainerin berichtete: „Das Feedback war überwältigend positiv. Die Teilnehmer haben nicht nur gelernt, was im Kurs vorgesehen war. Sie haben erkannt, wie wichtig Essen für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit ist, haben Anregungen für den eigenen Ernährungsalltag erarbeitet, aber auch Teamfähigkeit und Toleranz gegenüber anderen entwickelt.“ Eine erfolgreiche Schulung also mit „Mehrwert“ – ganz im Sinne von Food Literacy (vgl. SCHNÖGL 2006).
Die inhaltliche Arbeit an dem Projekt ist mittlerweile beendet. Das Ergebnis „Handbuch und Toolbox“ steht auf der Internetseite www.food-literacy.org zum kostenlosen Download in acht verschiedenen Sprachen zur Verfügung. In dem Handbuch wird das Konzept von Food Literacy erläutert, und der heutige Ernährungsalltag und die Dimensionen der Ernährung werden dargestellt. Die Toolbox enthält 25 Methoden für die konkrete Kursgestaltung sowie hilfreiche Tipps für die Vermittlung von Food Literacy (siehe Beispiel Tabelle 2). Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten reicht von Anregungen für das Kennenlernen der Teilnehmer bis zu umfassenden Vorschlägen für längere Kurseinheiten. Die Methoden sind teilweise sinnlich orientiert (z.B. „Mit den Ohren essen“), umfassen aber auch Exkursionen oder die intensive Beschäftigung mit der eigenen Essbiographie.
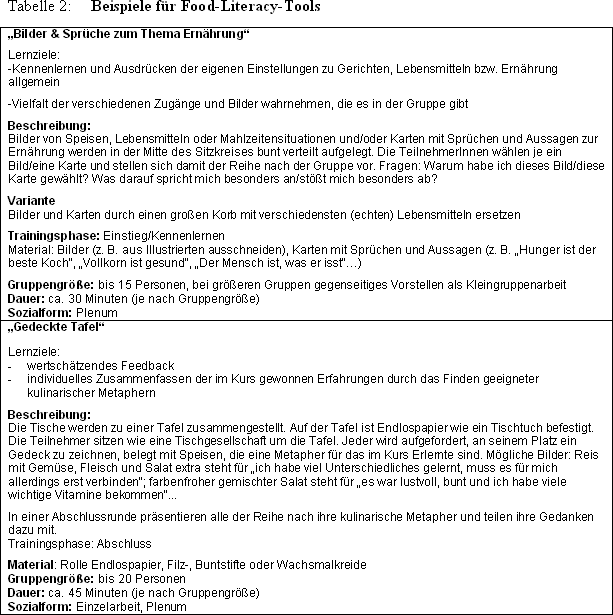
Das EU-Projekt ist inzwischen beendet. In Deutschland geht es jetzt darum, Food Literacy in der Erwachsenenbildung noch weiter bekannt zu machen und die Materialien weiter zu entwickeln. Hierzu besteht ein enger Kontakt mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und dem Deutschen Volkshochschulverband. Der aid wird das Food-Literacy-Handbuch mit den Übungen in einer überarbeiteten und aktualisierten Fassung als aid-Special neu herausgeben. Aber für weitere Aktivitäten sind zusätzliche Mittel notwendig, denn die EU-Förderung ist seit September 2007 beendet. Von Seiten des aid wird zurzeit geprüft, wo weitere Fördergelder beantragt werden kön nen. So finanzierte die Dr. Rainer Wild-Stiftung im Juni 2008 einen Workshop zur Entwicklung eines „Train-the-Trainer-Konzeptes“ und zur Weiterentwicklung der Materialien.
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Hrsg.): Food literacy. Gefördertes Projekt der Europäischen Kommission. Online: http://www.food-literacy.org (26-08-2008).
EBERLE, U./ FRITSCHE, U./ HAYN, D et al. (2005): Nachhaltige Ernährung: Ziele, Problemlagen und Handlungsbedarf im gesellschaftlichen Handlungsfeld Umwelt-Ernährung-Gesundheit. Diskussionspapier Nr. 4., Hamburg.
HAYN, D./ EMPACHER, C./ HALBES, S. (2005): Trends und Entwicklungen von Ernährung im Alltag. Ergebnisse einer Literaturrecherche. Institut für sozial-ökonomische Forschung, Frankfurt. Online: http://www.isoe.de/ftp/mb2_TrendsErnAlltag.pdf (26-08-2008).
IGLO-Forum (1995): Iglo-Forum-Studie '95. Kochen in Deutschland. Hamburg.
LEHMKÜHLER, S. (2002): Die Gießener Ernährungsstudie über das Ernährungsverhalten von Armutshaushalten (GESA): qualitative Fallstudien. Dissertation Gießen. Online: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2002/825/pdf/d020125.pdf (26-08-2008).
MEIER, U. (2004): Zeitbudget, Mahlzeitenmuster und Ernährungsstile. In: DGE (Hrsg.): Ernährungsbericht. Bonn, 72-94.
SCHNÖGL, S. (2006): Food Literacy! Schmackhafte Angebote für die Erwachsenenbildung und -beratung. In: IAKE Mitteilungen, H. 14, 49f.
STIESS, I./ HAYN, D. (2005): Ernährungsstile im Alltag. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung. Diskussionspapier Nr. 5, Frankfurt.
ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH (Hrsg.) 7 (2006) :Trendstudie Food. Gesellschaftlicher Wandel und seine Wirkung auf den Food-Bereich. Bonn.