|
| ||


 bwp@ Profil 2 | 14. Januar 2009
bwp@ Profil 2 | 14. Januar 2009
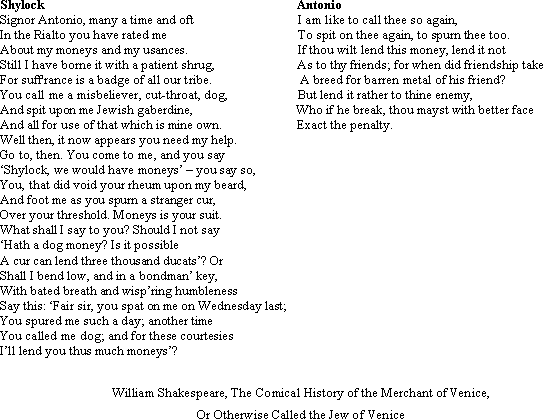
Wie kaum einer vor oder nach ihm hat William Shakespeare um das Jahr 1600 das Drama eines jüdischen Geschäftsmannes literarisch verarbeitet. Seine beiden Hauptpersonen verkörpern das Dilemma der jüdischen wie der christlichen Seite. Der Jude ist eingeklemmt zwischen seiner wirtschaftlichen Macht als vermögender Geldverleiher und der gesellschaftlichen Ohnmacht des verachteten Außenseiters; der edle, gesellschaftlich mächtige Christ ist finanziell klamm. Er leiht Geldkapital zinslos einem Freund, das er allerdings selbst beim Juden leihen muss. Der Christ behandelt den Juden wie einen Hund, spukt auf ihn voller Verachtung, nennt ihn einen Halsabschneider und weiß doch, der Jude wird ihm leihen, denn nur wenn er seinem Feind leiht, macht er ein gutes Zinsgeschäft. Das geht in diesem Fall allerdings für den Juden wegen seines merkwürdigen, ausgesprochen kannibalischen Pfandes böse aus. Er wuchert mit einem Pfund Fleisch seines Schuldners, das er nahe am Herzen herausschneiden darf, sofern die Schuld nicht beglichen werden kann. Der Jude kann zum Schluss froh sein, dass er nur sein Vermögen verliert.
Shakespeare spielt geschickt mit dem Judenhass auf mehreren Ebenen. Der Ort der Handlung ist Venedig, das damals wichtigste Handelszentrum Europas. Und er kann sich darauf verlassen, dass sie in ganz Europa verstanden wird. Denn der jüdische Wucher ist ein allgemein verbreitetes Stereotyp. Das Gleiche gilt für den Blutmythos, der im Zentrum der Handlung steht. Der ist bei den Christen positiv besetzt: Der „Leib des Herrn“ darf symbolisch verspeist werden, wenn auch nicht pfundweise. Das aber will der Jude, für den Fall, dass sein Pfand fällig wird. Und von den Juden geht ja um, sie brauchten Christenblut. Zu diesem Zweck schächteten sie Christenkinder, um an Pessach die benötigte Matze mit ihrem Blut anzurühren.
(Der berühmteste, angeblich rituelle Kindsmord geschah 1475 an dem Knäblein Simon von Trient. Er wurde europaweit bekannt und von der Kirche mit dem Bau einer Wallfahrtskirche geschickt vermarktet. Der Prozess führte zur Vernichtung der jüdischen Gemeinde in Trient. Vgl. R. Po-Chia Hsia, Trient 1475. Geschichte eines Ritualmordprozesses, Frankfurt am Main 1997. Ignatio Rogger/Marco Bellabarba, Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486). Frau tardo Medioevo e Umuanesimo, insb. das Kap. Intorno al Caso Simone di Trento, 383-416. Im Anhang befindet sich eine Fülle von Abbildungen des angeblichen Martyriums. Zur europaweiten Rezeption des Falls vgl. auch Rolf Seubert, Die alte Brücke zu Frankfurt am Main. Schauseite und Kehrseite eines Bauwerks , in: Diagonal, H2/1998. Im Brückenturm war über Jahrhunderte ein zweiteiliges Großgemälde angebracht: oben war das aus vielen Wunden blutende Knäblein Simon zu sehen, darunter wurden die Frankfurter Juden mit der Sau geschmäht. )
Ferner ist wie selbstverständlich das Geldkapital des Juden zu unrecht angeeignet, ist durch „Wucher“ geraubt und darf deshalb am Ende wieder in ordentliche christliche Hände transferiert werden, ganz legal, gewissermaßen eine vorgezogene „Arisierung“. Eine „Komödie“ findet ihr gutes Ende, aber keinen historischen Schluss. Zwei stereotype Figuren sind erfunden, die lange bestehen werden: Der ehrbare christliche Bankier und Handelsmann und der üble jüdische Wucherer, der ebenfalls eine Bank besitzt. Um 1840 bekommen sie beispielhaft Namen und Gesicht:
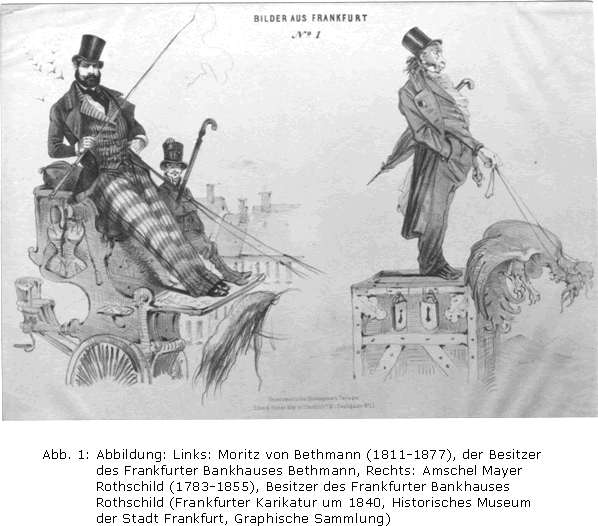
Weiter gilt es vorab, zwei im Titel herausgestellte Implikationen zu klären und einzuschränken. Bei dem Satz „Die Juden können keine Handwerke“ handelt es sich um einen von der christlichen Mehrheitsgesellschaft durch die Jahrhunderte immer wieder erhobenen plakativen Vorwurf. Er impliziert umgekehrt – und das ebenfalls bereits seit dem frühen Mittelalter –, die Juden seien gleichermaßen „geborene Händler und Wucherer“. Der Satz impliziert ferner, Handwerk und Landwirtschaft seien die allein Werte schaffenden, weil Natur aneignenden und Produkte hervorbringenden Tätigkeitsbereiche menschlicher Arbeit. Der stereotype Vorwurf der einseitigen Berufsstruktur ignoriert den sozialgeschichtlichen Prozess seiner Entstehung und stilisiert ihn zu einem überzeitlichen anthropologischen Merkmal des Judentums und damit später dann zu einem Element antisemitischer Ideologie.
In den Anfängen des Judentums findet sich keine Spur von ablehnender Haltung gegenüber handwerklich-körperlicher Arbeit, wie bereits ein kurzer Blick in das Alte Testament zeigen kann. Und im Gegensatz zu den griechisch-römischen Sklavenhaltergesellschaften des Altertums standen die Arbeit und ganz besonders das Handwerk bei den Juden in hohem Ansehen ( ENZYCLOPÄDIA JUDAICA 1929, 947-952). Einer ihrer berühmtesten frühen Rabbiner, Rabbi Juda (2. Jahrh. v. Ch.), mahnt die Väter heranwachsender Jungen: „Wenn jemand seinen Sohn kein Handwerk lehrt, so ist das, als ob er ihn zur Straßenräuberei erzöge.“ (BARON 1927, 1403). Die generelle Hochschätzung der Arbeit teilten später auch die Kirchenväter; mehr noch, sie verstärkten diese Haltung, indem sie dem Handel und ganz besonders dem „Wucher“ das Odium des Unethischen, des Betrügerischen anhafteten.
Bei der Behauptung, die Juden wendeten sich statt dem Handwerk gewissermaßen instinktiv dem Wucher zu, kann von einem antisemitischen Stereotyp dann gesprochen werden, wenn der Vorwurf pauschal und im Kontext einer Vielzahl ähnlicher Vorwürfe und Behauptungen über die Juden steht, die sich bis heute zu einer Weltanschauung verdichten, die prinzipiell judenfeindlich ist. Man könnte sagen, dass die den Juden pauschal zugeschriebenen Eigenschaften sich über Jahrhunderte zu einem stabilen Stereotyp entwickelt haben, das sich überzeitlich im christlichen Raum zu einem festen Gerücht über das, was die Juden ausmache, verdichtet hat.
Der nachfolgende Beitrag greift, und das macht die Schwierigkeit der Themenstellung aus, mit der vermeintlich ablehnenden Haltung der Juden gegenüber körperlicher Arbeit in Handwerk oder Landwirtschaft nur ein Element aus der stereotypen Struktur der vielfältigen judenfeindlicher Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft heraus. Er will einige Hinweise geben, wie die Entstehung der in der Tat relativ einseitigen Berufsstruktur der Juden durch die Geschichte zu erklären ist, aus der über Jahrhunderte hinweg vor allem der Handel, speziell der Geldhandel und Geldverleih, also der „Wucher“, herausragt.
Das Römische Reich, seine kulturelle, soziale und rechtliche Struktur bilden den Ausgangspunkt der verhängnisvollen abendländischen Einstellung gegenüber den Juden. Rom war ein hoch organisiertes militärisch-imperiales Machtgebilde, das sich über Jahrhunderte stetig ausdehnte und dabei eine bis dahin nicht bekannte Stabilität der Herrschaft entfaltete. Die Pax Romana garantierte die Entwicklung einer Hochzivilisation, die prägend wurde für die weitere kulturelle und politische Entwicklung Europas.
Dieses Riesenreich wäre ohne eine hoch differenzierte Arbeits- und Berufsteilung, ohne ausdifferenziertes Wirtschaftssystem mit dazu gehöriger Finanzverwaltung und ohne hoch entwickelte Infrastruktur nicht zu verwalten gewesen. Die römische Hochzivilisation hatte den Handel von landwirtschaftlichen Produkten, gehobenen Konsumgütern und Sklaven aus den entlegenen Provinzen nach Rom und in die entlegenen Gebiete zur Versorgung der Truppen zur Voraussetzung. Durch die Unterwerfung der Völker zwischen Britannien und dem Vorderen Orient bildete sich ein Vielvölkerstaat aus. Er wurde organisiert von einer römischen Machtelite und basierte vor allem auf einer straff organisierten und geführten Armee, die lange als unbesiegbar galt. Roms Eroberungsdrang führte in den 60er Jahren des letzten vorchristlichen Jahrhunderts zur Besetzung Palästinas. Von da an bildeten die Juden eine der vielen Minderheiten in der multikulturellen Bevölkerung Roms. Zunächst waren die römischen Cäsaren gegenüber den Juden ausgesprochen tolerant. Ganz allgemein herrschte im gesamten römischen Reich der Grundsatz der Religionsfreiheit. So verordnete Kaiser Tiberius auf der Basis früherer Verträge im Jahr 31 n. C, was nahezu uneingeschränkt über weitere drei Jahrhunderte Geltung besaß und erst mit der Erhebung des Christentums zur Staatsreligion beendet wurde:
"Ich erachtete es vielmehr für billig, dass die Juden in unserem gesamten Reiche ihren herkömmlichen Gebräuchen ohne alle Anfechtungen treu bleiben, und ermahne sie gleichzeitig, dass sie, mit dieser Gnade zufrieden, sich duldsam benehmen und die religiösen Gebräuche anderer Völker nicht verachten, sondern sich bei ihren eigenen Gesetzen bescheiden. Dieses Edikt soll allen Behörden in den Städten, Kolonien und Municipien sowohl innerhalb wie außerhalb Italiens, desgleichen allen Königen und Fürsten durch ihre eigenen Botschafter kundgegeben und außerdem innerhalb dreißig Tagen an einer Stelle, wo es bequem gelesen werden kann, angeschlagen werden." (CLEMENTZ 1959, 620).
Die Sicherheit und Selbstgewissheit der römischen Weltmacht gestattete, dass dem griechisch-römischen Götterhimmel weitere Götter und Gottesvorstellungen hinzugefügt werden durften. Wichtig war Rom nicht die totale kulturelle Unterwerfung der besiegten Völker, sondern deren Akzeptanz der politischen Hegemonie Roms. Auch die Christen Roms waren zunächst nur eine der vielen Sekten, die vor allem aus den neu eroberten Provinzen des Südostens kommend sich in der Stadt festgesetzt hatten. Sie alle genossen zunächst Religionsfreiheit wie auch eine begrenzte Entfaltung der wirtschaftlichen Betätigung. Zwar waren die Juden Roms mehrheitlich Sklaven, aber auf Grund ihrer kulturellen Überlegenheit gelangten sie in höhere Stellen im Handel, in der Verwaltung und im Gesundheitswesen.
Ihre kleinen Gemeinden wurden im Gefolge der Expansion nach Norden bald auch Bestandteil der römischen Städte entlang von Donau und Rhein. Die Toleranz der Supermacht endete allerdings, als die Christen und Juden als Anhänger des Monotheismus mit der römischen Mythologie in Widerspruch gerieten, denn damit stellten sie die Einheit von Religion, Staat, und Politik in Frage. Vor allem während der Herrschaft der Cäsaren in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten spitzte sich die Entwicklung krisenhaft zu: Während sich die Cäsaren als Pontifices Maximi und Oberaufseher über alle sakralen und rituellen Angelegenheiten Roms in vergöttlichtendem Kaiserkult pompös verehren ließen, lehnten die Christen den römischen Pantheismus und damit die Stellung Cäsars als Spitze der Einheit von religiöser und politischer Macht ab. Der als Christenverfolgung in die Geschichte eingegangene Konflikt endete mit dem Sieg des Christentums und seiner Einführung als Staatsreligion im vierten Jahrhundert durch Kaiser Constantin ( † 337 n. Chr.).
Dieser religiöse Siegeszug wäre allerdings beinahe mit dem Zusammenbruch des römischen Weltreiches auch zu Ende gegangen. Denn was folgte, war ein mit dem Niedergang Roms verbundener nachhaltiger Zivilisationsbruch und gesellschaftlicher Rückschritt in allen Bereichen. In diesem Zusammenbruch setzte sich das Christentum allerdings als die siegreiche der beiden monotheistischen Religionen seine Haltung gegenüber dem Judentum durch. In den verschiedenen Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts festigte sich das Christentum nach innen wie auch nach außen. Es erhob fortan den Anspruch, alleinseligmachend zu sein. Und da die Juden das damit verbundene Dogma, mit Christus sei der von den Juden erwartete Messias in die Welt gekommen, nicht übernehmen wollten, wurden sie fortan als Ketzer betrachtet. Einer der besten Kenner der nachrömischen Periode jüdischer Geschichte kennzeichnet die diskriminierte Stellung der Juden gegenüber dem frühen Christentum: „Sobald das Christentum unter Constantin zur Staatsreligion wurde, hörte diese (bisher für Rom geltende) bürgerliche Gleichstellung auf. Die Kirche und der christliche Staat, Concilienschlüsse und Kaisergesetze arbeiteten jetzt Hand in Hand, um das Judenthum zu verfolgen, seine Ausbreitung zu verhindern und die Bekenner der mosaischen Religion in ihrer Rechtsfähigkeit zu beschränken.“ (STOBBE 1866, 2). Vor allem im strenggläubigen Raum Südfrankreichs hätten diese antijüdischen Haltungen als offizielle Dogmen die Jahrhunderte überdauert.
Die bis dahin blühenden römischen Stadtkulturen Westdeutschlands gingen im Gefolge des Zusammenbruchs des Römischen Reiches in der Zeit der Völkerwanderung, ausgelöst durch den Druck waffenstarker Barbarenstämme aus dem nordöstlichen Europa, fast gänzlich unter. In den folgenden „dunklen Jahrhunderten“ überdauerte die römische Kirche nur in wenigen Regionen Südfrankreichs, in abgelegenen Klöstern und an der europäischen Peripherie im Norden. Erst die „karolingische Renaissance“ im entstehenden fränkischen Reich verhalf dem Christentum in Zentraleuropa wieder zu seiner Rolle als Staatsreligion. Der Franke Karl wurde als Kaiser des heiligen römischen Reiches zum Protektor Roms.
In seinem noch wenig entwickelten Herrschaftsbereich herrschte der Geist höherer Toleranz als im ehemaligen Gallien, hatten die Juden offensichtlich mehr Rechte und Freiheiten. Nicht zu Unrecht bezeichneten die Juden das karolingische Reich aus der retrospektiven Sicht ihres späteren Elends als „goldenes Zeitalter“. An Karls Hof gelangten sie in hohe Stellungen: Seine wandernde Hofhaltung musste mit großem logistischem Aufwand mit allen notwendigen Gütern versorgt werden, auch mit solchen des gehobenen Luxus, die von weit her importiert werden mussten. Dazu bedurfte es erfahrener Händler, die über gewachsene Fernhandelsbeziehungen verfügten. Und so scheinen die Juden in nachfränkischer Zeit bereits „wesentlich vom Handel gelebt zu haben; ja während die Deutschen fast ausnahmslos Ackerbauern waren, befand sich der Handel hauptsächlich in jüdischen Händen“. (STOBBE 1866, 6). Diese Arbeitsteilung entsprach den einfachen Verhältnissen der Zeit; sie hatte aber nachhaltige Folgen. Während sich der bäuerliche Umgebungshandel weitgehend auf der Basis des Naturaltauschs vollzog, war der Fernhandel ohne entwickelte Geldwirtschaft nicht zu organisieren. In beiden Bereichen, im Handel wie in dem damit einhergehenden Geld- und Kreditwesen, verfügten die Juden über seit vielen Generationen tradierte Erfahrungen.
Allerdings galt der Händlerstand von alters her weder bei den jüdischen Schriftgelehrten noch bei den griechisch-römischen Philosophen als besonders ehrbare Berufsgruppe. Geld und Geldhandel galten als anrüchig, auch wenn das römische Sprichwort „pecunia non olet“ dies trotzig zu leugnen versuchte. Die Vorstellungen vom „unfruchtbaren“ Wesen des Geldes wurden von den Kirchenvätern weitgehend von Aristoteles übernommen. Der anerkannte zwar seine nützliche Funktion als Tauschmittel im Warenverkehr, sprach ihm aber eine produktive Funktion ab. Seine Verachtung des Geldbesitzes entsprang nicht ökonomischer Einsicht, sondern war moralisch motiviert:
„Denn nur zur Erleichterung des Tausches kam es (das Geld) auf, der Zins aber vermehrt es an sich selber. Daher denn auch der Name für “Zins” soviel wie “Junges” bedeutet, denn das Junge pflegt seinen Erzeugern ähnlich zu sein, und so ist auch der Zins wieder Geld vom Gelde . Und diese Art der Erwerbskunst ist denn hiernach die widernatürlichste von allen.” (ARISTOTELES, Politik , I.10.2)
Die Vorstellung von der Unfruchtbarkeit des Geldes wurde von den meisten Kirchenvätern übernommen. Augustinus legte kategorisch fest, was kirchliche Lehrmeinung über Jahrhunderte darstellte. Sein noli fenerare , du sollst nicht Zins nehmen, ging von der Unfruchtbarkeit des Geldes aus. Darüber hinaus war die Vorstellung moralisch inakzeptabel, dass ein Christ die Notlage eines andern ausnutzen und damit gegen das Gebot der christlichen Nächstenliebe verstoßen könnte.
Und in der Tat kam vor allem dem Handel in den sozialen Beziehungen zwischen christlicher Mehrheit und jüdischer Minderheit seit dem Frühmittelalter eine zentrale Bedeutung zu: Er stellte das wichtigste soziale Bezugssystem dar, in dem Christ und Jude sich begegneten und in ihrer religiös-kulturellen Differenz, basierend Thora, Talmud und dem Alten Testament, gegenseitig wahrnahmen. Aber dies blieb zunächst ohne Spannungen. Dagegen vollzogen sich die vorwiegend geschäftlichen Beziehungen in einem rechtlich schwierigen, aber immer wieder neu zu ordnenden Rahmen. Die schwierigste Frage war, mit welchen hebräischen Formeln des Alten Testaments und der Thora ein Jude im Konflikt eines Geld- oder sonstigen Rechtsgeschäfts mit einem Christen bei seinem Seelenheil so schwört, dass er im Meineidsfall der gleichen ewigen Verdammnis anheimfiele wie der Christ. Denn wer kannte schon deren Sprache und absonderliche Gewohnheiten. (Misstrauen durchzieht die Jahrhunderte nach dem alten Sprichwort: „Trau keinem Fuchs auf grüner Heid' und keinem Jud bei seinem Eid“. Vergleiche hierzu das gleichnamige Kinderbuch von Elvira Bauer, das ab 1936 in mehreren Auflagen im Stürmer-Verlag erschien. Es fasst in Reimform und in wüsten Bildern die primitivsten antisemitischen Stereotypen zusammen.) Exemplarisch für diese frühe Zeit stehen die so genannten Regesten des Aronius , eine früh- bis hochmittelalterliche Urkundensammlung. (Julius ARONIUS, Regesten zur Geschichte der Juden im fränkischen und deutschen Reiche bis zum Jahre 1273, hrsgg. im Auftrag der historischen Commission für Geschichte der Juden in Deutschland ) Aus diesen Dokumenten lässt die komplizierte Wechselbeziehung von jüdischer und christlicher Umwelt in einer ständisch gegliederten Gesellschaft nachvollziehen. Sichtbar wird in dieser Quellensammlung vor allem der unaufhörliche soziale Abstieg der Juden, begleitet von religiös motiviertem Misstrauen gegen die „Christusmörder“. Denn an sich waren aus diesem Gründen Geschäfte mit Ungetauften verboten. Man wusste ja nicht, ob sie in ihrer geheimnisvollen Sprache Formeln einbauten, so wie bis heutzutage Kinder im Spiel mit der einen Hand schwören und den Eid mit der anderen durch hinter dem Rücken gekreuzte Finger wieder aufheben. Ein Exemplar für eine solche Eidesformel stellt der Erfurter Judeneid aus dem 12. Jahrhundert dar:
„Des dich dirre sculdegit des bistur unschuldic. So dir got helfe. Der got der himel unde erdin gescuf. loub. blumen. unde gras. des da uore nine was. Unde ob du unrechte sveris. daz dich di erde virslinde. di datan unde abiron virslant. Unde ob du unrechte sveris. daz dich die muselsucht biste. di naamannen liz unde iezi bestunt. Unde ob du unrechte sweris. daz dich di e virtilige di got moisy gab. in dem berge synay. Di got selbe screib mit sinen vingeren an der steinir tabelen. Unde ob du unrechte sweris. daz dich uellin alle di scrift. di gescriben sint an den vunf buchen moisy. Dit ist der iuden eit den di biscof Cuonrat dirre stat gegebin hat.“ (Zit. nach STOBBE, ebenda, 157. Die Übersetzung findet sich bei Gaby Herchert: Recht und Geltung , Würzburg 2003, 57: „ Dessen, wofür dieser Dir Schuld gibt, bist Du unschuldig, so Dir Gott helfe, der Gott, der Himmel und Erde erschuf, Laub, Blumen und Gras, das zuvor nicht war. Und wenn Du unrecht schwörst, dass Dich die Erde verschlinge, die Datan und Abiran verschlang. Und wenn Du unrecht schwörst, dass Dich der Aussatz befalle, der Maeman verli eß und Gehasi befiel. Und wen n Du unrecht schwörst, dass Dich die Gesetze vertilgen, die Gott Moses gab auf dem Berge Sinai, die Gott selbst schrieb mit seinen Fingern auf die steinerne Tafel. Und wenn Du unrecht schwörst, dass Dich zu Fall bringen alle Schriften, die geschrieben sind in den fünf Büchern Moses. Das ist der Juden Eid, den Bischof Konrad dieser Stadt gegeben hat.“)
Dass es überhaupt vermehrt zu solchen Rechtsgeschäften kam, entwickelte sich aus dem kanonischen Zinsverbot seit dem Konzil von Nizäa im Jahr 325. Danach war die Erhebung einer Entschädigung für geliehenes Geld oder Naturalien wie Saatgut oder Tiere ein Verstoß gegen die christliche Bruderliebe, der nicht gerechtfertigt werden könne. Damit war Klerikern wie später auch Laien die Naturalien-, Geld- oder Pfandleihe gegen Zins verboten. Dieser auch in früher Zeit bereits notwendige wirtschaftliche Bereich wurde auf diese Weise zu einem jüdischen Monopol, zumal der Kreditbedarf angesichts der unterentwickelten Geldwirtschaft groß war.
Die Blütezeit jüdischer Wirtschafts- und Handelstätigkeit lag im frühen Mittelalter. Die gesellschaftliche Stellung der Juden in der ständischen Gesellschaft bis ins Hochmittelalter war die einer angesehenen religiös-ethnischen Minorität. Noch waren sie auf Grund ihrer herausragenden ökonomischen Funktion den christlichern Bürgern weitgehend gleichgestellt und entsprechend wohlhabend. Sie verfügten über einige herausragende Fähigkeiten: Sie konnten im Gegensatz zur Mehrheitsbevölkerung bis in den Adel hinauf lesen, schreiben und rechnen; sie besaßen geografische Kenntnisse und ein Netz von Beziehungen über weite Räume hinweg. Die einheitliche Sprache und die Einbettung von Glaubensgenossen in die reichen, den Christen verschlossenen Kulturräumen – vor allem Arabiens – waren Voraussetzungen für den Warenaustausch sowie für die komplizierte Verrechnung der noch wenig entwickelten Währungssysteme. Damals lag der Schwerpunkt ihrer Handelstätigkeit im Gewürzhandel und im Handel mit Schmuck, wertvollen Stoffen und Konsumgütern des gehobenen Bedarfs. Sie befriedigten vor allem den Luxusbedarf der lokalen europäischen Herrscherhäuser und der hohen geistlichen Herren. Damals durften sie mit allem handeln außer mit christlichen Sklaven.
Bis zum Ende des 11. Jahrhunderts lebten die Juden im deutschen Reich zwar räumlich beengt und in von der christlichen Mehrheitsgesellschaft kulturell geschiedenen, aber in einigermaßen klar definierten Lebenswelten friedlich beisammen. Die wechselseitigen Abhängigkeiten und Berührungsebenen waren wirtschaftlich bedingt, wobei die Juden enger mit der herrschenden und zahlungskräftigen weltlichen und auch kirchlichen Oberschicht kooperierten. Beide Seiten profitierten: Die Juden lieferten die begehrten Waren und liehen auf Zins; die Herrschenden bis hinauf zum Kaiser sicherten ihnen durch Schutzbriefe den Landfrieden, der wiederum teuer erkauft werden musste. Daraus erwuchs die besondere Konstruktion der „jüdischen Kammerknechtschaft“, die den Juden seit der Karolingerherrschaft Sicherheit bringen sollte.
Dieser Zustand wechselseitiger Toleranz und rechtlicher Sicherheit fand gegen Ende des 11. Jahrhunderts ein jähes Ende. Im südlichen Frankreich sammelten sich religiös fanatisierte Horden auf, um das von den Ungläubigen besetzte Heilige Land zu befreien und die von den Muslimen zerstörte Grabeskirche wieder in Besitz zu nehmen. Aufgehetzt durch die Predigten fanatischer Priester und eingestimmt durch den Schrei deus vult , Gott will es, brachen sie einen Landweg durch Deutschland über den Balkan und Byzanz nach Palästina. Sie wurden angeführt von Mönchen, die chiliastisch gestimmt waren und die denen, die dabei sterben würden, Generalabsolution ihrer Sünden und das Himmelreich versprachen. Ihre militärischen Anführer waren zumeist verarmte, zweitgeborene Adelige. Sie wurden von niedrigeren Motiven angetrieben, nämlich von der Gier nach Landbesitz und den sagenhaften Schätzen des Orients.
Im Frühsommer des Jahres 1096 tauchte das zerlumpte und ausgehungerte Heer am Rhein auf. Sie wussten dort von reichen Judengemeinden. Das dämpfte erst einmal ihre Bereitschaft, den langen Weg weiterzumarschieren. Der Chronist beschreibt die Stimmung des wilden Haufens: “Diejenigen, die sich entschlossen hatten, nach Jerusalem zu ziehen, sprachen zueinander wie folgt: 'Warum sollen wir uns in ein fernes Land zu unseren Feinden aufmachen, während hier in unseren Ländern und Städten unsere Feinde sitzen, die unsere Religion hassen'.“ (BÜCHLER 2001, 172). Die Prediger hetzten gegen die „Christusmörder“, die doch als Strafe hierfür in der Knechtschaft der Christen leben sollten und nicht umgekehrt. Damals wurde die Formel erfunden, wonach jüdisches Eigentum durch unlauteren Wucher ergaunert sei und somit zu recht wieder in Christenhände überführt werden dürfe.
Während einige Territorialherren ihre Juden schützten, kam es in Worms zu einem ersten Massenmord, dem fast die gesamte Gemeinde zum Opfer fiel. Das gleiche Schicksal widerfuhr wenig später den Mainzer Juden. Retten konnte sich nur, wer sich taufen ließ. Für die Juden schien im regnum teutonicum die Endzeit angebrochen. Der teuer erkaufte Landfrieden bedeutete kaum noch Schutz vor dem Hass der Kreuzfahrer. Als sie endlich im Juli 1099 Jerusalem erreichten, richteten sie das bis heute unvergessene Massaker unter der muslimischen und jüdischen Stadtbevölkerung an, dem tausende Menschen zum Opfer fielen. Von nun an führte der hin und her wogende Kampf um Jerusalem zu immer neuen Kreuzzugswellen. Und wieder wurden die Nachkommen der Überlebenden angegriffen. Viele suchten ihr Heil in der Flucht, die sie bis weit in den Osten führte, verfolgt von Legenden, sie vergifteten im Auftrag des Sultans die Brunnen, schächteten an Pessach Christenkinder, schändeten Hostien.
Die wirtschaftlichen Folgen der Ermordung und Vertreibung waren gewaltig, auch wenn die betroffenen Städte aus fiskalischen Gründen wieder den Zuzug von Juden förderten. Allerdings begann in dieser Zeit im deutschen Raum die neuartige Entwicklung der „Freien Reichsstädte“, in denen sich eine nachhaltige Veränderung der Wirtschaftsbeziehungen anbahnte. Sie lösten sich aus der Territorialherrschaft und entfalteten sich zu eigenständigen Lebensräumen, in denen erstmals nichtbäuerliche Lebensformen möglich wurden. Sie ermöglichten kleinen jüdischen Gemeinden die Ansiedlung.
Diese Entwicklung in den Städten schlug sich bald in einer ständischen Arbeitsteilung mit einer differenzierten sozialen und beruflichen Gliederung nieder. Die aus christlichen Bruderschaften entstandenen Zünfte prägten in ihrer gemeinsamen räumlichen Anordnung das Stadtbild. Aber während die sozialen Gegensätze der städtischen Handwerker mit den Patriziern, den leibeigenen Bauern und ihren ländlichen Feudalherren immer noch das einigende Band der christlichen Lebensform umschlang, standen die Juden naturgemäß gänzlich außerhalb dieses dominanten lebensweltlichen Faktors. Mehr noch: mit der Ausdifferenzierung der städtischen Lebensräume in berufsständische Quartiere vollzog sich gegenüber den Juden eine wesentliche strengere Separation, indem ab dem 14. Jahrhundert ihre Quartiere mit hohen Mauern umgeben wurden und darüber hinaus der soziale Verkehr zwischen Christen und Juden durch die Stadtobrigkeiten strenger Reglementierung unterworfen wurde.
Den Ausgangspunkt dieser neuen Entwicklung stellte das 4. Laterankonzil von 1215 dar. In der Folgezeit wurden seine Beschlüsse sukzessive auf das Deutsche Reich übertragenen. Sie leiteten eine nachhaltige Separation ein, indem nicht nur die räumliche Trennung, sondern auch die Kennzeichnungspflicht für Juden in Form eines gelben Flecks an der Kleidung und der „Judenhut“, eine kreisrunde, spitze Kopfbedeckung, eingeführt wurde. Allerdings galten damals strenge Kleidervorschriften für alle Stände, aber sie hatten nicht die gleiche stigmatisierende Funktion.
Diese lebensweltliche wie auch räumliche Separation verschärfte die wirtschaftliche Situation in den Ghettos. Außerhalb der Ghettomauern differenzierten sich die Berufe (Vgl. zur horizontalen Berufsteilung die ausgezeichnete Studie von Karl BÜCHER, Die Berufe der Stadt Frankfurt im Mittelalter, Leipzig 1914 ); lockerte sich ab dem 12. Jahrhundert mit der Entwicklung der christlichen Kaufmannsgilden, der großen süddeutschen Handelshäuser und der niederdeutschen Hanse das Zinsverbot weitgehend. Während sich also auf der einen Seite eine komplexe Berufs- und Lebenswelt entfaltete, die sich innereuropäisch vernetzte, blieben die Menschen innerhalb der Ghettomauern davon so gut wie ausgeschlossen. Ghetto und Umwelt entwickelten sich in den meisten Bereichen auseinander. Das Ghetto wurde eine Domäne der Rückständigkeit. Hier gab es nur wenige Berufe, die diese Bezeichnung verdienten. Die für das Überleben des Ghettos wichtigsten Tätigkeiten waren vor allem das nunmehr eingeschränkte Geld- und Kreditgeschäft sowie die Pfandleihe auf bewegliche und unbewegliche Habe, der Tuch- bzw. Kleiderhandel, der Vieh- und Getreidehandel für den Ghettobedarf. Hinzu kamen einige wenige Handwerker wie Bäcker und Metzger (diese vor allem wegen der rituellen Speisevorschriften) sowie Näherinnen. Sie arbeiteten hauptsächlich für den Eigenbedarf des Ghettos. Angesehen waren Schreiber und Buchmaler für die Thorarollen und für Handschriften oder Schreiber für den Geschäftsbedarf und die Buchführung; später kamen die Buchdrucker hinzu. Als akademische Berufe genossen neben den Rabbinern vor allem jüdische Ärzte – sie studierten an den berühmten italienischen Universitäten – und Rechtsgelehrte hohes Ansehen. Besonders die Dienste der Ärzte wurden auch außerhalb des Ghettos geschätzt. So genannte Stümpler oder Pfuscher stellten unzünftige Produkte für den Eigenbedarf her, Trödler vertrieben nicht eingelöste Pfänder oder allerlei billigen Kram ins Umland. Jüdische Geschäftstätigkeit war also weitgehend auf den „Wucher“ und den so genannten „Nothandel“ beschränkt. Alle wichtigen Arbeiten, wie z. B. alle Arten von Bauarbeiten durften nur von christlichen Zunfthandwerkern erledigt werden. Auch viele Produkte des täglichen Bedarfs durften nur von außerhalb erworben werden. So verwundert nicht, dass die Mehrzahl der Ghettobewohner aus Armen bestand, die von mildtätiger Solidarität der Bessergestellten lebten (SEUBERT 1993, 41-62).
Zu den Zünften hatten Juden selbstverständlich keinen Zugang. Denn als christliche Bruderschaften setzten sie bei der Einschreibung „ehrliche“, d. h. eheliche und vor allem christliche Geburt voraus. Die wichtigste Außenbeziehung der jüdischen Gemeinschaften in den Städten war die zu den Rentämtern, die eine Vielzahl spezifischer „Judensteuern“ erhoben. Denn das Existenzrecht der jüdischen Gemeinden wurde in so genannten Stättigkeitsordnungen geregelt. (Stättigkeit bedeutet vertraglich gesichertes Aufenthaltsrecht, wirtschaftlicher und sozialer Verhaltenskodex und Abgabenregelung zwischen jüdischer Gemeinde und Territorialmacht. ) Sie reglementierten sowohl die allgemeinen Lebensumstände im Ghetto wie auch die Erwerbsmöglichkeiten mit dem christlichen Umfeld auf das Schärfste. Im Ergebnis machten die Stättigkeitsordnungen die Juden zu Leibeigenen der jeweiligen Obrigkeit. Wesentliches Ziel dieser Ordnungen war, dass durch jüdische Gewerbetätigkeit kein etabliertes christliches Gewerbe beeinträchtigt werden durfte. Z. B. war es Juden verboten, außerhalb des Ghettos Waren anzubieten. Und selbst im Ghetto waren sie strengen Auflagen unterworfen. So durften sie z. B. keine Waren in Schaufenstern und Auslagen im Freien darbieten, sie durften nicht für sich werben oder gar Kunden anlocken. Zogen sie mit Waren über Land, und das mussten sie, bedeutete dies extreme Unsicherheit, waren sie oft genug den Attacken fanatisierter Dörfler und Straßenräubern ausgesetzt.
Insgesamt kann für das Mittelalter festgehalten werden, dass das Ghetto als soziale Insel von sich aus nicht überlebensfähig war, da es von Waren und Dienstleistungen aus dem dominanten christlichen Umfeld abhängig war. Und der „Wucher“, als wesentlicher Außenkontakt und Einkommensquelle des Ghettos, stellte zugleich die Ursache für anhaltendes soziales Konfliktpotential und für den aus Verschuldung resultierenden Hass dar. Und verschuldet waren alle Stände. Diese Verschuldung wiederum kam zustande durch die hohen Abgaben, die vor allem die unteren Stände und die Bauern zu zahlen hatten. Also liehen sie in ihrer Not bei den Juden, die wiederum hohe Zinsen nahmen, um ihre eigene, von den Obrigkeiten abhängige teuere Existenz zu sichern. Denn die Juden stellten gegenüber den Schuldnern gewissermaßen die Schraube dar, die von den Obrigkeiten angezogen wurde, um die hohen Zinsen (25-50 % und mehr p. a.) einzutreiben. Berechtigte Aggressionen ließen sich leicht auf den „Judenwucher“ ablenken. Pogromstimmung ließ sich in schwierigen Zeiten leicht erzeugen. Der Rechtshistoriker Otto STOBBE beschreibt die „Wucherfalle“, in der die Juden saßen, folgendermaßen: Das einfachste Mittel, „um sich von den lästigen Gläubigern zu befreien, war, sie totzuschlagen; bei vielen Verfolgungen der Juden werden wir die Verschuldung des Volkes als wesentlichstes Motiv annehmen dürfen“ (STOBBE 1866, 131).
Der religiöse Fanatismus hatte die Lage der Juden seit den Kreuzzügen enorm verschärft. Sie wurden nun offen Ziel religiös motivierter Vernichtung. Von da an mutierten die Juden zum „teuflischen Antichrist“. Zwar standen sie unter dem direkten Schutz des Kaisers. Aber das hatte nur den einen Grund, nämlich, dass sie zu einer der wenigen unmittelbaren Steuerquellen gemacht werden konnten. Der kaiserliche Schutz kam sie teuer zu stehen, und er war wenig wert. Zwar stellte die Beraubung oder Ermordung von Juden an sich einen Bruch des Landfriedens dar, aber die kaiserliche Schutzmacht war im Bedarfsfall nicht erreichbar oder nicht handlungsfähig oder -willig. Mehr noch: Die Schutzbefohlenen galten als kaiserliche „Kammerknechte“ (Leibeigene) mit all ihrem Hab und Gut. Ja sogar ihr Leben lag in des Kaisers Hand, wie eine spätere Urkunde aus dem Jahr 1462 offen zeigt: „dann so ein yeder Romischer konig oder kayser gekrönet wird, mag er den Juden allenthalben jm Rich all jr gut nehmen, darzu jr leben, und sie tödten …“. Damit sie aber Leben und Freiheit behalten konnten, mussten sie als eine Art „Reichssondersteuer“ bei jeder Kaiserwahl ein Drittel ihres gesamten Vermögens einliefern (STOBBE 1866, 17). Benötigte der Kaiser Geld, so konnte er „seine“ Juden – was bald gängige Praxis wurde – an die Reichsstädte verpachten oder verkaufen und danach als sein ehemaliges Eigentum mit Zusatzsteuern wie den „güldenen Opferpfennig“ belegen. Er erhob damit Zinsen auf ein Pfand, eine Rechtspraxis, die eigentlich bei Todesstrafe verboten war, die sich vor allem während der Regierungszeit Kaiser Wenzels (1361-1419) entfaltete.
So griffen im ausgehenden Mittelalter sozial, ökonomisch und religiös motivierte Abneigungen sich wechselweise legitimierend ineinander, um immer wieder in die von religiösem Wahn und Habgier angefachten Katastrophen einzumünden. Im Gefolge der Kreuzzüge hatte sich das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in Europa völlig verändert. Mit der Verlagerung der Handelswege auf das Mittelmeer und durch Landnahme im Nahen Osten verloren jüdische Händler an Bedeutung. Der Aufstieg Venedigs, der Verlust von Byzanz an die Türken oder die Rückeroberung Spanien sollen als Bezugespunkte den ökonomischen Wandel nur andeuten.
Es scheint ein Erbe der Kreuzzugsperiode zu sein, dass hier erstmals die Vorstellung Oberhand gewann, eigenes Heil sei durch Gewalttaten an Fremden und Ungläubigen zu erlangen. Heilsgewinn statt Schuldgefühle: Die damit verbundene Senkung der Tötungshemmung wurde schließlich seitens geistlich-obrigkeitlicher Macht legitimiert. Als Entlastung diente, durch päpstlichen Segen bereits vorab von den Schuldgefühlen der eigenen Gewalttaten entlastet zu werden. Die Dämonisierung der Gegenseite machte es möglich, dass man mit ihrer Vernichtung nicht nur das eigene Sendungsbewusstsein legitimierte; man konnte sogar durch Mord und Gewalt zu einem besseren Christenmenschen werden. Es könnte sein, dass die wechselseitige Projektion der eigenen Dämonen auf den jeweils Anderen vielleicht als das nachhaltigste Erbe der Kreuzzüge bis heute angesehen werden kann.
Die Separation verschärfte sich im Gefolge der Reformation, vor allem unter dem Einfluss des Luther'schen Verdikt über die Unbelehrbarkeit der „halsstarrigen Juden“, die Christus als in die Welt gekommenen Messias verleugneten und damit das Christentum zentral in Frage stellten. LUTHERs Urteil über die Juden fällt in jeder Hinsicht vernichtend aus:
„Dazu wissen wir noch heutigen Tages nicht, welcher Teufel sie her in unser Land bracht hat. Wir haben sie zu Jerusalem nicht geholet. Zudem hellt sie noch itzt niemand, Land und Straßen stehen jnen offen, muegen sie zihen in jr Land, wenn sie wollen. Wir wollten gern geschenck dazu geben, das wir jr los weren. Denn sie uns eine schwere last, wie eine Plage, Pestilentz und eitel unglueck in unserm Lande sind.“ (LUTHER 1543, 520 f.).
Und er fährt fort, indem er die realen Verhältnisse auf den Kopf stellt und die gesamte Christenheit als in jüdischer Sklaverei befindlich darstellt:
„Heisst das gefangen halten, wenn man einen nicht leiden kan im Lande oder Hause? Ja wol, sie halten uns Christen in unserm eigen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten im nasen schweis, gelt und gut gewinnen. Sitzen sie die weil hinter dem Ofen, faulentzen, pompen (prassen) und braten birn, fressen, saufen, lenen sanfft und wol von unserm ererbeitem gut. … Sind also unsere Herrn, wir jre Knechte mit unserm eigen gut, schweis und erbeit, fluchen darnach unserm Herrn und uns zu lohn und zu dank.“
Aus dieser theologisch noch viel weiter begründeten Sichtweise zieht LUTHER den radikalen Schluss: Mit diesen „Teufelskindern“ kann es keine Gemeinschaft geben. Sie müssen verschwinden, so oder so. Und er fordert:
„Erstlich, das man jre Synagoga oder Schul mit feur anstecke und, was nicht verbrennen will, mit erden uber heuffe und beschütte, das kein Mensch ein stein oder schlacke davon sehe ewiglich. Und solchs sol man thun, unserm Herrn und der Christenheit zu ehren…
Zum andern, das man ihre Heuser des gleichen zerbreche und zerstöre…
Zum fünfften, das man den Jueden das Geleid und Strasse gantz und gar aufhebe …(d. h. sie für vogelfrei erklärt)
Zum sechsten, das man jnen den Wucher verbiete und neme ihnen alle barschafft und Kleinod an silber und Gold … Und dies ist die ursache: Alles, was sie haben … haben sie uns gestolen und geraubt durch jren Wucher …
Zum siebenden, das man den jungen starcken Jueden und Juedinin die hand gebe flegel, axt karst, spaten rocken, spindel und lasse sie ir brot verdienen im schweis der nasen …“ (LUTHER 1543, 523-526).
War vorher das Leben der Juden, vor allem „unter dem Krummstab“, zwar immer bedroht, doch dann auch wieder einigermaßen erträglich gewesen, so verschlechterte sich mit dem Erstarken des Protestantismus die soziale Lage der Juden zusätzlich. Der Furor des alternden Martin LUTHER zeigte nachhaltige Wirkung.
Dennoch gelang es einigen jüdischen Finanzgenies in der Zeit des Absolutismus, aus dem Ghetto heraus Netzwerke zu jüdischen Gemeinden in anderen Teilen Deutschlands und darüber hinaus aufzubauen, um im Auftrag ihrer Landesherren Bank-, Kredit- und Wechselgeschäfte aufzuziehen. Dabei kam ihnen ihre einfache Lebensweise ebenso zu Gute wie ihre relative Unabhängigkeit vom höfischen Intrigenspiel in den deutschen Kleinstaaten. Vor allem halfen ihnen einige im Überlebenskampf geschulte soziale Kompetenzen, so z. B. ihr überlegenes ökonomisches Wissen, ihre Improvisationsfähigkeit, ihr Organisationstalent, aber auch ihre Genügsamkeit und gemeindeinterne Solidarität; kurzum Talente also, die sie prädestinierten, den Widerspruch zwischen der aufgeblasenen barocken Hofhaltung und der Rückständigkeit der Finanzverwaltungen in den deutschen Kleinstaaten mit neuen Ideen konstruktiv zu bearbeiten. An fast allen europäischen Höfen agierten Juden mit großem Geschick. Aber auch diese „Hofjuden“ kennzeichnete der Widerspruch zwischen ihrer individuellen wirtschaftlichen Machtstellung und ihrer kollektiven sozialen Ohnmacht, wie das traurige Schicksal des württembergischen Finanzienrats Süß Oppenheimer zeigt. In dieser Zeit entstand das Gerücht vom „reichen Juden“, das sich als literarische Figur bis in die Neuzeit hielt. (So z. B. direkt in dem Grimm'schen Märchen „Der Jude im Dorn“, in dem ein ausgeraubter Jude neben dem Spott des christlichen Umfeldes auch kein Recht gegenüber dem Räuber erhält, frei nach dem Motto, der Raub jüdischen Eigentums sei gerechtfertigte Rückführung zu Unrecht angeeigneten Eigentums. Vgl. hierzu auch Rolf Seubert, Fassbinder und der „Reiche Jude“. Zu Geschichte und Virulenz eines Vorurteils, in: Medium, Jg. 16 (Heft 1/1986), 17-23. ) Und es ist diese exekutive Tätigkeit einzelner Finanzjuden, die auf die Gesamtheit der Juden zurückschlägt und immer wieder den Hass der Landstände und des städtischen Kleinbürgertums hervorruft. Denn die Fürsten von „Gottes Gnaden“ für die repressiven wirtschaftlichen Verhältnisse verantwortlich zu machen und gegen sie aufzubegehren, kam Hochverrat gleich; die Unzufriedenheit auf die Juden und ihren Wucher abzulenken, fiel den Herrschenden dagegen leicht. (Vgl. hierzu beispielhaft Isidor Kracauer , Geschichte der Juden in der Stadt Frankfurt a. M., Bd. I, Frankfurt am Main 1925, insb. Kap. IX, Die Frankfurter Juden im Fettmilch'schen Aufstand, 358-390. )
Allerdings setzten sich bereits im 18. Jahrhundert, wenn auch zaghaft, realistischere Auffassungen über die soziale Lage der Juden durch. (So analysierte in England beispielsweise John Toland (1670-1722) 1714 die religiös bedingten Vorurteile der anglikanischen Kirche und die eine jüdische Konkurrenz fürchtende Mehrheit des englischen Bürgertums. Seine frühmerkantilistischen Betrachtungen, die auf einen rational handelnden und durch religiöse Toleranz gekennzeichneten Staat ausgerichtet waren, blieben allerdings ohne Wirkung. England lehnte 1753 jede Immigration ab mit der Begründung, eine Rücknahme der Vertreibung und die Wiedereinbürgerung der Juden lege „Hand an das Fundament unserer Kirche“ und berühre „die Existenz des Christentums“. Vgl. hierzu Herbert Mainuschs Einleitung zu seiner Übersetzung von John Tolands, Gründe für die Einbürgerung der Juden in Großbritannien und Irland, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1965, 25. ) So schrieb Johann Jacob SCHUDT 1714 über die vermeintlich naturhafte jüdische Neigung zum Wucher: „Die Veranlassung, dass die Juden so gern wuchern, ist entstanden theils von denen Christen, theils von denen Juden; Von den Christen kommt die Veranlassung her, weil man ihnen keine Handwercker zu treiben erlaubt …“ (SCHUDT 1714, 169). Als Jugendliche, so Schudt, wären sie dazu verurteilt, „in Müßiggang aufzuwachsen“. Sie seien gezwungen, „sich insgemein alle von handeln und schachern (zu) nähren, (wodurch sie) hingegen zu keiner Arbeit kommen“. An den meisten Orten würden sie erst gar nicht zur Lehre zugelassen und erhielten auch kein Niederlassungsrecht. Von Vorschlägen wie die des berühmten Hallischen Juristen Böhmer, man solle sie zum Handwerk zulassen, hielt Schudt entgegen eigener Einsicht wenig. Die Juden würden doch nur, so schrieb er als Kind seiner Zeit, „mit ihrer Stümplerey“ die Handwerke ebenso verderben, „wie sie die Handlung verstümpeln“. Unter Berufung auf Luther und in seinem Stil fuhr er fort, die Juden sollten einfache Handarbeiten ergreifen; man solle sie „grobe gemeine Handwerck lernen und treiben lassen … sie sollen Wälle und Gräben lernen machen, Holtz und Stein hauen, Kalck brennen, Schornstein und Cloac fegen …“ (SCHUDT 1714, 170).
Diese Einstellung hielt sich nahezu unverändert bis in die Zeit der Aufklärung. Diese begann in Preußen nach 1750 und ist damit gleichbedeutend mit dem Zeitalter Friedrichs II. In dessen rationalem Verwaltungsstaat entwickelten sich nach dem siebenjährigen Krieg die bürgerlichen Freiheiten aus merkantilem Interesse und der Notwendigkeit des Wiederaufbaus. Vom wirtschaftlichen Aufschwung blieben die preußischen Juden allerdings zunächst ausgeschlossen. Sie waren auf Grund der harten Ausnahmegesetze in ihrer beruflichen Betätigung weiterhin so stark eingeengt, dass sie im Zustand bedrückender Armut lebten. Auch im vorwiegend protestantischen Preußen war die Reduktion auf Geld- und Bankgeschäfte sowie den so genannten „Nothandel“ neben der religiös motivierten Judenfeindschaft die Hauptursache für soziale Verachtung und hassvolle Ablehnung durch die christliche Mehrheit.
Das Zeitalter der Aufklärung repräsentiert in Bezug auf die Emanzipationsbewegung des Judentums der preußische Staatsrat Christian Wilhelm DOHM (1751-1820) wie kaum ein anderer. Sein am französischen Rationalismus und der Idee des merkantilen Verwaltungsstaats geschulter Geist, beeinflusst auch von seinen Auseinandersetzungen mit den Schriften Lessings und Moses Mendelsohns, erkannte, dass die Entfaltung eines Staatwesen auf den für alle Bürger verlässlichen Prinzipien des Rechts aufgebaut sein müsse. Wirtschaftliche Entwicklung setze die Beseitigung aller überlieferten Vorurteile und Rechts-ungleichheiten seiner Bürger voraus. Seine Auffassungen legte er in einer zweibändigen Schrift „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“ dar, erschienen 1781 und 1783. Sie setzte im deutschsprachigen Raum eine Debatte in Gang mit dem Ziel, die bürgerliche Gleichstellung der Juden zum Paradigma der für die bürgerliche Gleichstellung schlechthin zu machen. Den Juden in Preußen galt diese Schrift DOHMs als die „Bibel der Emanzipation“, so das Jüdisches Lexikon. DOHM gewann aus gründlicher Kenntnis der deutsch-jüdischen Geschichte die Einsicht, dass die völlig unzureichende Stellung der Juden im bisherigen Staatswesen durch nichts anderes verschuldet sei als durch uralte christliche Vorurteile. Und er zog daraus den Schluss, dass deren elende soziale Lage „ein Überbleibsel der unpolitischen unmenschlichen Vorurtheile der finstersten Jahrhunderte“ sei und unwürdig, in „unseren Zeiten fortzudauern“ (DOHM 1781), da diese für den preußischen Staat in jeder Hinsicht nachteilig seien. Folglich müssten die Juden als Bürger die gleichen Rechte wie die christlichen Untertanen genießen. Er forderte, jede Art von Sonderbesteuerung der Juden abzuschaffen, ihnen den Zugang zu den staatlichen Bildungseinrichtungen bis zu den Universitäten zu erlauben, den Erwerb von Grundbesitz zu gestatten und die jungen Juden dem Ackerbau und dem Handwerk zuzuführen. DOHM gab sich in Bezug auf die Umsetzung seiner Forderungen keiner Illusion hin. Er beschrieb die aktuelle Lage der Juden überaus realistisch:
„In jedem Geschäfte des Lebens sind die Gesetze mit äußerster Strenge gegen ihn (den Juden) gerichtet, und die mildere Behandlung der übrigen Menschen, unter denen er lebet, macht die seinige nur desto härter. Und bey diesen so mannigfaltigen Abgaben ist der Erwerb des Juden aufs äußerste beschränkt. Von der Ehre, dem Staat sowohl im Frieden als im Kriege zu dienen, ist er ausgeschlossen; die erste der Beschäftigungen, der Ackerbau, ist ihm allenthalben untersagt, und fast nirgends kann er in seinem Namen liegende Gründe eigenthümlich besitzen. Jede Zunft würde sich entehrt glauben, wenn sie einen Beschnittenen zu ihren Genossen aufnähme, daher ist der Hebräer fast in allen Landen von den Handwerken und mechanischen Künsten ganz ausgeschlossen.“ (DOHM 1781, 9).
Vor allem in der Religion sah DOHM den zentralen Hemmschuh für die Integration in den Staat, ein nachgerade moderner Gedanke:
„Jede Religion flösset also ihren Anhängern eine Art von Abneigung gegen die aller übrigen ein, eine Abneigung, die bald mehr an Haß, bald an Verachtung gränzt … Wenn also jede Religion mehr oder weniger die natürlichen Bande der Menschheit zerreißt … so kann es (doch) nicht für einen Grund gelten, deßhalb den Anhängern irgend eines Glaubens die Rechte der Bürger zu versagen.“ (DOHM 1781, 23).
DOHM schätzte den geschlossenen Widerstand, der seinen Ideen von den staatstragenden Schichten ebenso entgegengesetzt würde wie von den an ihre beschränkte Lebensweise gewöhnten Juden, durchaus realistisch ein. Er ahnte, dass vor allen anderen ständischen Organisationen „die Zünfte sich der Aufnahme der Juden widersetzen würden“ (DOHM 1781, 113). Als ein „Aufklärer von oben“ setzte er auf eine Art Doppelstrategie: Zunächst sollten die Juden im Staat die gleichen Rechte erhalten. Sodann vertraute er als Kind seiner Zeit auf die wechselseitige Annäherung durch die Allmacht der Erziehung. Dabei sah er vor allem im Handwerk das „wesentliche Mittel zur Besserung der Juden“ und zugleich als Maßnahme, der „übertriebenen Neigung zum Handel wirksam“ entgegen arbeiten zu können (DOHM 1783, 297). Dem Staat wäre es zweckmäßig, „die Juden zu den Arbeiten des Handwerkers zu gewöhnen und dadurch sie zu besseren Gliedern der Gesellschaft umzubilden.“ (DOHM 1783, 288). Von den Juden forderte er, vom Handel abzugehen, der „ihrem sittlichen und politischen Charakter eine nachtheilige Richtung gegeben“ habe; der Staat solle zugleich Anreize schaffen, „diejenige Art des Erwerbs vorzuziehn, welche am meisten einen entgegengesetzten Geist und Gesinnungen einzuflössen fähig ist; – ich meyne die Handwerke“ (DOHM 1781, 111) , also Einbindung in die handwerkliche Arbeit als Ansatz zur Aufhebung wechselseitiger Vorurteile.
Gegen die DOHM 'sche Schrift erhob sich ein Sturm der Entrüstung. In seinem zweiten Band, der 1783 erschien, setzte er sich mit einer Reihe von Publikationen und Zuschriften auseinander. A usführlich ging er auf das Vorurteil ein: „Die Juden sind wohl nicht fähig, Handwerke zu erlernen und auszuüben, und die Schwierigkeiten, die sich hiebey finden, scheinen kaum überwindlich.“ (DOHM 1783, 266). Es sind vor allem die beiderseitigen religiösen Besonderheiten, die es unmöglich machten, junge Juden bei christlichen Meistern in die Lehre zu geben. Nicht nur, dass die einen den Sabbat, die anderen den Sonntag als arbeitsfreien Tag ehren müssten; das gleiche gelte für die unterschiedlichen religiösen Feiertage. Und wie sollten jüdische und christliche Lehrlinge harmonisch unter einem Dach wohnen und ihre unterschiedlichen Zeremonialgesetze einhalten? Doch all diese Hemmnisse sah Dohm bei gutem Willen als überwindbar an, so dass er abschließend feststellte: „Ich sehe also keinen Grund, warum man nicht die Zünfte anhalten wollte, auch jüdische Knaben in die Lehre zu nehmen.“ (DOHM 1783, 184). Sollten die Meister sich allerdings stur zeigen und ausgelernten jüdischen Handwerkern das Niederlassungsrecht verweigern, sei es wiederum Aufgabe des Staats, das Zunftmonopol dadurch zu brechen, dass er „jüdische Arbeiter zu Freymeister erklärte“ (DOHM 1783, 287).
Der aufklärerische Impuls DOHMs lässt sich als für Preußen typische, staatlich verordnete „Emanzipation von oben“ beschreiben. Vor allem in den jüdischen Gemeinden wurde DOHMs Schriften erfreut aufgenommen. Aber auch in Frankreich wurde nach 1789 wurden seine Gedanken über die persönliche Bekanntschaft mit dem Comte de Mirabeau, einem führenden Kopf der französischen Revolution, rezipiert. DOHM wurde ein wichtiger Impulsgeber für die 1791 im französischen Parlament beschlossene bürgerliche Gleichstellung der Juden.
DOHMs Schriften bewirkten in der Realität zunächst recht wenig. Er fand wenig Nachahmer. (So sprach eine anonyme Schrift, Blinde Kuh in der Handlung. Ein Gegenstück zu der Schrift: Sind sie der Handlung schädlich? Frankfurt am Main, 1803, 10 f. von „missverstandener Aufklärung“: „Die Juden sind als Fremdlinge unter uns aufgenommen. ... (Sie) sind von undenklichen Zeiten ... her Leibeigene, Eigenthum und Sclaven, der Kaiser und des römischen Reiches in Deutschland. Ein Leibeigener darf um seine Freilassung bitten; sein Leibherr kann sie ihm aus besonderer Bewegung schenken; aber kein Leibeigener hat das Recht, seine Freyheit zu verlangen.“ ) Sie wurden vor allem bei jüdischen Denkern aufgegriffen. Sie blickten voller Spannung auf die französische Entwicklung. Sie schien ihnen Vorbild und Hoffnung gleichermaßen (O. V. 1806). Der anonyme Autor beklagte, der Vorwurf, die Juden hätten nur einen Hauptzweig der Nahrung, den „herumziehenden Handel oder Schacher“. Und er verwies auf die Ursachen dieses Missstandes: „Die Juden können keine Handwerke, sie müssen sie erst erlernen, und können dazu nur ihre Kinder bestimmen. ... Und da die Lehrlinge nur von christlichen Meistern gebildet werden können, ... und sie sich allen bestehenden Zunftgesetzen unterwerfen müssen, so kann ihre künftige Aufnahme keinen Schaden bringen.“ (O. V. 1806, 58).
In den jüdischen Gemeinden wurden DOHMs Ideen aufgegriffen. Nicht zuletzt aus der Einsicht heraus, dass die gewachsenen Vorurteile nur mit neuen Ideen bekämpft werden können, propagierten ihre Sprecher für die ärmeren Bevölkerungsschichten den Gedanken der handwerklichen Berufsausbildung. Allerdings sollte DOHM seine Ahnung vom harten Widerstand der Meister nicht getrogen haben. Denn wie keiner vorher hatte er klargestellt, dass die wirtschaftliche Gesundung Deutschlands nicht gelingen konnte, wenn die Bildungs- und Ausbildungsblockaden reaktionärer Zünfte gegenüber den niederen, für „unzünftig“ gehaltenen Ständen nicht überwunden werden konnten. Die Führer der preußischen Reformbewegung, allen voran Wilhelm von Humboldt setzten im Reformjahr 1812 die Einführung der Gewerbefreiheit und die bürgerliche Gleichstellung der Juden für die preußischen Kernlande durch. Mit beiden Edikten sollte endlich das Zunftmonopol in der Berufsausbildung gebrochen werden; ein formaler Akt nur, aber Voraussetzung dafür, dass u. a. die gewachsene antijüdische Einstellung durch kooperative Annäherung „vor Ort“ überwunden werden könnte.
Die Voraussetzungen hierfür waren in dieser Zeit günstig wie nie. Alles war im Umbruch seit das marode Kaiserreich 1806 unter Napoleons Expansion nach Osten wie ein Kartenhaus zusammengebrochen war. Die deutschen Juden der unter französische Besatzung geratenen Rheinbundstaaten hofften zunächst auf die Übertragung der durch die französische Nationalversammlung am 13. November 1791 proklamierten bürgerlichen Gleichstellung und damit auf freie wirtschaftliche Betätigung. Aber der Empereur brauchte Geld für seine Eroberungsfeldzüge. Also bot er an, die Gleichstellungsrechte, die er all jenen Juden gewährte, die den Bürgereid leisteten, in seinen deutschen Vasallenstaaten zu verkaufen. Das Emanzipationsedikt von 1811 des Fürstbischofs und Führers des Rheinbundes von Dalberg brachte zwar den Juden die ersehnte Gleichheit, aber sie kosteten allein die jüdische Gemeinde in Frankfurt die riesige Summe von 440.000 Gulden. Einerlei, erstmals seit Jahrhunderten waren die Juden von der Leibeigenschaft befreit. Sie waren endlich gleichberechtigte Bürger, allerdings von Napoleons Gnaden, ein Akt mit nachhaltigen Folgen.
Frankfurt entwickelte sich in der Besatzungszeit zum europäischen Dreh- und Angelpunkt des organisierten Schmuggels mit England. Unter den Augen ihrer Besatzer blühte der Handel mit „Kolonialwaren“, die auf verschlungenen Wegen durch die Kontinentalsperre nach Frankfurt gelangten oder von hier aus verschoben wurden. Hier wurden auch klammheimlich die dazu erforderlichen Finanztransaktionen abgewickelt. (Einen ausgezeichneten Überblick über die bedrückende wirtschaftliche Lage unter französischer Besatzung gibt die Geschichte der Handelskammer zu Frankfurt a. M. (1707-1908) , hrsgg. von der Handelskammer zu Frankfurt a. M., Frankfurt am Main 1908, 176-216 ) Im November 1810 schlug die Besatzungsmacht zu: Alle von England aus eingeführten Waren sollten deklariert und konfisziert werden. Truppen wurden in die Kontore und Warenhäuser geschickt. War die Herkunft der oft umetikettieren Waren nicht eindeutig zu klären, wurden sie abtransportiert und vor den Toren der Stadt aufgetürmt und angezündet. Tagelang loderten die Flammen. Eine große Erregung bemächtigte sich der Stadt. Sie war an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen. Und wieder verdächtigte man die Frankfurter Juden, sie hätten als „Franzosenfreunde“ mit den Besatzern kollaboriert und seien weniger hart betroffen gewesen. Der frisch entfachte Hass auf den „Erbfeind“ verband sich mit dem historisch gewachsenen der von ihm emanzipierten Juden. Diese scharfe antifranzösische Stimmung verriet den Juden der Stadt nichts Gutes.
Das Glück, ein freier, mit gleichen Rechten ausgestatteter Bürger zu sein, war nur von kurzer Dauer. Kaum war Napoleon nach der Schlacht bei Hanau am 31. Oktober 1813 für immer über den Rhein verschwunden, meldete sich der reaktionäre Geist der alten Reichsstadtherrlichkeit zurück: Die Bürgerschaften Frankfurts und der Hansestädte restituierten sofort ihre alten Stadtverfassungen mit dem Ziel, die bürgerliche Gleichstellung wieder aufzuheben. Bis zur politischen Neuordnung Deutschlands sollten die Freien Reichsstädte wieder in ihre alten Rechte eingesetzt werden, sollte in Frankfurt fortan die alte Judenstättigkeit von 1616 wieder gelten.
Der Wiener Kongress von 1815 befasste sich ausführlich mit der Emanzipationsfrage. Aufkommendes nationales Selbstbewusstsein und restaurative Tendenzen des in seine vorrevolutionären Rechte wieder eingesetzten Adels waren die herrschende Grundströmung der deutschen Neuordnung. Sehnten sich erstere nach einem deutschen Nationalstaat, wollten die Regierenden einen losen und damit schwachen Bundesstaat. Der künftige politische Status der Juden war ein wichtiges Thema. Zunächst schien der Kongress geneigt, die bürgerliche Gleichstellung beizubehalten. Artikel 16 der Deutschen Bundesakte wurde so formuliert, dass den Juden die bisher in den einzelnen Bundesstaaten eingeräumten Rechte erhalten bleiben sollten. Dagegen setzten sich die freien Reichsstädte Frankfurt, Hamburg und Bremen mit allen juristischen Mitteln zur Wehr. Eingaben wurden gemacht; Bestechungsgelder flossen. Die Frankfurter warfen „ihren“ Juden grobem „Undank“ vor und die „gewissenlose Verletzung des Huldigungseids“, eines seit Jahrhunderten geübten Brauchs, der zugleich mit der Entrichtung der jährlichen Sondersteuer auf das Wohnrecht abgeleistet wurde. Nach altem kaiserlichem Recht, das nun wieder hergestellt sei, seien ihre Ansprüche auf das Bürgerrecht grundsätzlich unzulässig, so die harte Position der Stadt (vgl. SCHLOTZAUER 1984, 129-161). In der Hochphase der Aufklärung wurden die deutschen Juden in die mittelalterliche Leibeigenschaft zurückgeworfen. Von der antisemitischen Stimmung getragen, konnte die Mehrzahl der wiederhergestellten Regierungen den Juden die kaum gewonnene bürgerliche Gleichstellung wieder nehmen und sich damit eine erhebliche Steuerquelle sichern ( ENZYCLOPÄDIA JUDAICA 1930, 570).
Diesem Rechtsstreit kam prinzipielle Bedeutung für den gesamten Deutschen Bund zu. Er sollte sich zu einem jahrelangen Rechtsstreit führen, in dem beide Seiten eine Fülle von Rechtsgutachten einbrachten. Er endete erst 1824 mit dem faulen Kompromiss einer „israelitischen Staatsbürgerschaft“, also einer Staatsbürgerschaft minderen Rechts. In wirtschaftlicher Hinsicht wurde der Handlungsspielraum gegenüber der vornapoleonischen Zeit zwar erweitert, jedoch in Bezug auf die Gewerbefreiheit wurde festgelegt, es sei die Pflicht jedes Staats, „die bürgerlichen Rechte seiner jüdischen Einwohner so zu regulieren, dass der Nahrungs- und Gewerbstand der christlichen Bürgerschaft als des wesentlichen Bestandtheils des christlichen Staates daneben bestehen kann“ (BENDER 1833, 68). Dies bedeutete, dass die Erlaubnis jüdischer Wirtschaftstätigkeit in den einzelnen Gewerbezweigen abhängig war von den nach wie vor möglichen Einsprüchen christlicher Konkurrenten. Allerdings wurde ihnen – Ironie der Geschichte – das Recht eingeräumt, ihre Interessen auf das entwicklungsträchtige Feld der Fabrikgründung zu richten.
Aber zunächst stellten der wirtschaftliche Wiederaufbau nach 1815 und die schweren Hungerjahre der Nachkriegszeit die deutschen Staaten vor große Herausforderungen. Überall entstanden nach 1815 als Teil der wirtschaftlichen Einigungsbewegung netzwerkartig verbundene Gewerbefördervereine. Vom liberalen Bürgertum getragen, gingen von ihnen starke Impulse zur lokalen Wirtschaftsförderung aus. Die gewerbliche Bildungsfrage war ein wichtiger Teil dieses wirtschaftlichen Entwicklungsprogramms. Die Fördervereine trugen maßgeblich zur Hebung des Bildungsstands der Handwerker bei, indem sie die Gründung beruflich orientierter Sonntagsschulen und Gewerbebildungsanstalten forcierten (vgl. SEUBERT 1994, 169-186).
Diese Entwicklung wurde in den jüdischen Gemeinden genau verfolgt. Allerdings war für sie das ökonomische Motiv der Teilhabe am wirtschaftlichen Aufstieg eher sekundär. Der Antrieb war primär sozialpolitischer Natur: Erstens konnte die große Zahl armer jüdischer Familien dadurch gemindert werden, dass ihre (männlichen) Jugendlichen zu christlichen Meistern in die Lehre gegeben würden. Zweitens sollte der Vorwurf widerlegt werden, die Juden seien zu keiner handwerklichen Arbeit, sondern nur zum Schacher fähig. Das machte es erforderlich, dass die jüdischen Gemeinden sich dieser neuen Aufgabe mit konstruktiven Ideen zuwendeten. Ausgehend von dem sich seit 1808 durch den einflussreichen Braunschweiger Finanzrat Israel Jakobsohn ausgelösten so genannten Frankfurter Schriftenstreit um die bürgerliche Gleichstellung war in Berlin unmittelbar nach dem Emanzipationsedikt von 1812 erstmals eine „Gesellschaft zur Beförderung der Industrie unter den Juden“ gegründet worden (WEINRYB 1936, 21). Seither suchten die jüdischen Gemeinden nach neuen Wegen, dem Vorwurf einseitiger Berufsorientierung konstruktiv zu begegnen.
Die preußische Gesellschaft war Vorbild zur Gründung des „Vereins zur Beförderung der Handwerke unter den israelitischen Glaubensgenossen“ in Frankfurt am Main 1823. Im 1. Jahresbericht nach der Vereinsgründung erläuterte der Vorstand das Gründungsmotiv:
„Es war augenscheinlich, daß nicht sowohl die Unterstützung Einzelner als die Beförderung der Handwerke unter den Israeliten überhaupt, Sinn und Streben des Vereins seyn müsse, wenn dieser mehr als eine gewöhnliche Hilfsanstalt seyn, und auf die bürgerliche Verbesserung der Israeliten einigermaßen einwirken sollte.“ (STADTARCHIV FRANKFURT AM MAIN 1825, 5).
Vor allem sollte das Vorurteil bekämpft werden, „dass die Armen, welche als Trödler und Hausirer sich und dem Staate zur Last sind, diesen verachteten und mühseligen Stand nicht darum ergreifen, weil er einen inneren Reitz für sie hat, sondern weil die eiserne Not dazu zwingt; und die Meisten ihre Kinder gern zu etwas Besserem bestimmen würden, wenn man ihnen die Mittel dazu in die Hand gäbe“ (STADTARCHIV FRANKFURT AM MAIN 1825, 4). Dazu bedurfte es erheblicher finanzieller Anstrengung der jüdischen Gemeinde.
Aber bereits im ersten Vereinsjahr 1824 konnten 40 Lehrlinge in 17 verschiedenen Berufen unterstützt werden. Dies war möglich, weil der Verein 4.500 Gulden Startkapital erhalten hatte. Allein die Gebrüder Rothschild des gleichnamigen Bankhauses hatten 1.300 Gulden gespendet. Die genaue Ausgabenaufstellung spiegelt die damaligen Kosten einer Lehrlingsausbildung bei christlichen Meistern wider. Danach war das Lehrgeld mit 1.285 Gulden der größte Posten, gefolgt von Ein- und Ausschreibgebühren sowie Handwerksgerät und Zeichenmaterial. Dagegen war der Besuch der gewerblichen Sonntagsschule frei. Sie war 1818 von der Frankfurter „Gesellschaft zur Beförderung der nützlichen Künste“, Teil des gesamtdeutschen polytechnischen Netzwerkes gegründet worden. In ihren Statuten hieß es ausdrücklich, dass der Besuch allen Konfessionen, also auch den jüdischen Lehrlingen offen stehe.
In seinem über hundertjährigen Bestehen förderte der Verein die Berufsausbildung vieler tausend Jugendlicher in sehr unterschiedlichen Berufszweigen. (Es ist hier nicht möglich, die vielen Jahresberichte, die bis zur Schließung des Vereins in den 30er Jahren während der NS-Zeit, gedruckt wurden auszuwerten, geschweige denn diejenigen der anderen großen jüdischen Gemeinden Deutschlands. ) Erst während der NS-Zeit wandelte sich zwangsweise der Vereinszweck. Bis zur Machtergreifung Hitlers galt die Zielsetzung, durch Förderung der Berufsausbildung einen wichtigen Beitrag für die Integration der deutschen Judenheit in die deutsche Nation zu leisten, sie durch „Berufsumschichtung“ wirtschaftlich und gesellschaftlich in ihr aufgehen zu lassen. Jetzt bestand der Vereinszweck nur noch in der beruflichen Vorbereitung der Auswanderung. Denn nach 1933 wurde das politische Ziel, Deutschland von den „steten Fremden“ zu befreien, mit dem sogenannten Antiboykotttag jüdischer Geschäfte in Angriff genommen. Es folgten schrittweise immer neue Einschränkungen wirtschaftlicher Betätigung, bis schließlich „arisiert“ wurde. Und diejenigen, die das Land nicht schnell genug verlassen konnten oder nach 1939 in den deutschen Herrschaftsbereich gerieten, fielen der über Jahrhunderte immer wieder ausgestoßenen Drohung der Ausweisung und Vernichtung zum Opfer.
BARON, E. (1927): Handwerk bei den Juden. In: JÜDISCHES LEXIKON, Bd. II. Berlin, 1401-1424.
BENDER, J. A. (1833): Der frühe und jetzige Zustand der Israeliten zu Frankfurt am Main. Frankfurt am Main.
BÜCHER, K. (1914): Die Berufe der Stadt Frankfurt im Mittelalter. Leipzig .
BÜCHLER, A. (2001): Obadyah the Proselyte and the Roman Liturgy. In: Medival Encounters, 7, H. 2, 172.
CLEMENTZ, H. (1959): Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer. Übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen, II. Bd. Köln (Nachdruck der Ausgabe von 1899).
DOHM, C. W. von (1781): Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Bd. I. Berlin und Stettin.
DOHM, C. W. von (1783): Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. Band II. Berlin und Stettin.
ENZYCLOPÄDIA JUDAICA (1929), Bd. 7, Berlin.
ENZYCLOPÄDIA JUDAICA (1930), Bd. 6, Berlin.
HANDELSKAMMER ZU FRANKFURT AM MAIN (Hrsg.) (1908): Geschichte der Handelskammer zu Frankfurt a. M. (1707-1908). Frankfurt am Main.
HERCHERT, G. (2003): Recht und Geltung : zur bildungsgeschichtlichen Deutung des Begriffs der Geltung im Mittelalter. Königshausen & Neumann.
KRACAUER, I. (1925): Geschichte der Juden in der Stadt Frankfurt a. M. Bd. I. Frankfurt am Main.
LUTHER, M. (1543): Von den Juden und ihren Lügen. In: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 53. Weimar 1920, 520.
O. V. (1806): Darstellung des Zustandes der Juden in Frankfurt. Frankfurt am Main.
SCHLOTZAUER, I. (1984): Die bürgerliche Gleichstellung der Frankfurter Juden im Urteil der zeitgenössischen Schriften 1816/17. Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 34. Marburg.
SCHUDT, J. (1714): Jüdische Merckwürdigkeiten. Frankfurt und Leipzig.
SEUBERT, R. (1986): Fassbinder und der „Reiche Jude“. Zu Geschichte und Virulenz eines Vorurteils. In: Medium, 16, H. 1, 17-23.
SEUBERT, R. (1993): Die Judengasse in Frankfurt. In: Diagonal, 1993, H. 2, 41-62.
SEUBERT, R. (1994): ‚Eingeschickter, in jeder Hinsicht gebildeter Handwerker'. Zum Anteil der polytechnischen Gesellschaften an der Berufsbildungsentwicklung in Deutschland. In: Berufsbildung und Gewerbeförderung. Heft 21 der Tagungen und Expertengespräche zur beruflichen Bildung, hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Berlin und Bonn. 169-186.
SEUBERT, Rolf (1998): Die alte Brücke zu Frankfurt am Main. Schauseite und Kehrseite eines Bauwerks. In: Diagonal, 1998, H. 2.
STADTARCHIV FRANKFURT AM MAIN (1825): Bericht über die Entstehung und den Fortgang des Vereins in Frankfurt a. M. zur Beförderung der Handwerke unter den israelitischen Glaubensgenossen. Sig. KS 650, 156/1969. Frankfurt.
STOBBE, O. (1866): Die Juden in Deutschland während des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung. Braunschweig.
TOLAND, J.(1714/1965): Gründe für die Einbürgerung der Juden in Großbritannien und Irland. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Herbert Mainusch. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz.
WEINRYB, S. B. (1936): Der Kampf um die Berufsumschichtung. Berlin.
zuletzt gespeichert am: 17.01.2009 10:59 AM