+
+ www.bwpat.de + + www.bwpat.de + + www.bwpat.de + + www.bwpat.de + +
www.bwpat.de + + www.bwpat.de +
+
URL: http://www.bwpat.de/spezial1/gaitanides-acker-p.shtml
saved on:
15.09.04
MICHAEL GAITANIDES und INGMAR ACKERMANNDie Geschäftsprozessperspektive als Schlüssel zu betriebswirtschaftlichem Denken und Handeln |
1 Einführung
2 Epistemologische Perspektiven der Prozessorganisation
2.1 Prozessorganisation - die praxeologische Perspektive
2.2 Prozessorganisation - die ökonomische Perspektive
2.3 Prozessorganisation - die konstruktivistische Perspektive
3 Elemente des Prozessmodells
3.1 Ablösung funktionaler Organisationsprinzipien
3.2 Kundenorientierung
3.3 Informationstechnologische Unterstützung
4 Phasen der Prozessgestaltung
4.1 Prozessidentifikation
4.2 Prozessdesign/-modellierung
4.3 Prozessimplementierung
5 Interorganisationale Prozessorganisation - von der Innensicht zur Außensicht
Literatur
1 Einführung
Seit gut einem Jahrzehnt finden prozessorientierte Methoden der Reorganisation
großes Interesse sowohl in der Unternehmenspraxis wie auch in der
betriebswirtschaftlichen Fachliteratur. Als gemeinsames Ziel dieser Ansätze
lässt sich das Streben nach kostengünstigeren, schnelleren und
fehlerfreieren unternehmensinternen Prozessen identifizieren. Kurzum:
Die Abläufe sollen insgesamt effizienter werden. Weitgehend unberücksichtigt
bleibt angesichts des operativen Optimierungsstrebens jedoch oftmals die
Frage nach der Gesamtkonzeption des Prozessmanagements.
Im Rahmen dieser Arbeit soll Prozessmanagement als ein mögliches
Konzept zur Effizienzsteigerung und Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit
dargestellt werden. Dabei möchten wir uns nicht jener Euphorie anschließen,
welche unter den Schlagworten "Prozessmanagement", "Business
(Process) Reengineering" oder einfach "Reengineering" zu
einer "Business Revolution", einem "völligen Neubeginn"
oder einer "Radikalkur für das Unternehmen" (vgl. Hammer/
Champy 1994) auffordert. Statt dessen soll veranschaulicht werden, was
Prozessmanagement bedeutet, was es leisten kann und wie es als Managementkonzept
in einem Unternehmen eingeführt werden kann.
In diesem Sinne soll der vorliegende Beitrag Aufklärung und Anregung
zugleich bieten, um der Gefahr der oberflächlichen Rezeption der
Ideen des Prozessmanagements entgegen zu wirken.
2 Epistemologische Perspektiven der Prozessorganisation
Was Prozessorganisation ist und was sie leisten soll, kann aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet werden. Vereinfachend lässt sich eine praxeologische,
eine ökonomische und eine konstruktivistische Perspektive unterscheiden.
2.1 Prozessorganisation - die praxeologische Perspektive
Im deutschen Sprachraum werden seit Nordsieck und Kosiol organisatorische
Gestaltungsprobleme in Aufbau- und Ablauforganisation unterschieden (vgl.
Nordsieck 1934; Kosiol 1962)(Im angelsächsischen Raum ist diese Zweiteilung
unüblich. Unter "Organization" wird in aller Regel nur
die Aufbauorganisation verstanden. Ablauforganisatorische Gestaltungsfragen
wurden bis vor einigen Jahren vereinzelt im Rahmen des "Industrial
Engineering" oder "Production Management" diskutiert. Seitdem
Geschäftprozesse in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt
sind, zeigt sich auch hier eine größere Berücksichtigung
ablauforganisatorischer Phänome, z.B. im Kontext eines "Business
Process Reengineering" oder neuerdings im "Supply Chain Management".).
Unter Zugrundelegung einer praxeologischen Perspektive leitet sich die
"prozessorientierte Organisation" aus dieser klassischen Differenzierung
ab (vgl. Gaitanides 1983), die sich zum einen auf den Aufbau der Unternehmung
als Gebilde und Beziehungszusammenhang sowie zum anderen auf den Ablauf
des Geschehens in der Unternehmung als Arbeitsprozess erstreckt (vgl.
Kosiol 1962, S. 32).
Formale aufbauorganisatorische Gestaltungsmaßnahmen sind also solche,
die Einfluss auf die Gliederung von Organisationen in Teileinheiten, die
Anzahl der Hierarchiestufen, die Stellenbildung sowie die Zuordnung von
Weisungsbefugnissen haben. Zu diesen strukturbildenden Maßnahmen
zählen auch Aspekte der Institutionalisierung des Prozessmanagements,
die sich in der Schaffung eigenständiger organisatorischer Einheiten
und Funktionen widerspiegeln.
Die Ablauforganisation legt hingegen fest, wie die operativen Prozesse
durch die aufbauorganisatorisch determinierten Strukturen laufen. Sie
beinhaltet die Gestaltung der Arbeitsprozesse innerhalb einer gegebenen
Stellenaufgabe, die im Zuge der aufbauorganisatorischen Gestaltungsmaßnahmen
entstanden sind. Während die Aufbauorganisation also etwas mit der
Bildung von organisatorischen Potenzialen zu tun hat, steht im Rahmen
der Ablauforganisation der Prozess ihrer Nutzung im Vordergrund (vgl.
Gaitanides 1992, Sp. 1). Analog spricht Kosiol von der Aufbauorganisation
als "Bestandsphänomen" und von der Ablauforganisation als
"Prozessphänomen" (Kosiol 1962, S. 186).
Der einer Stelle damit zugewiesene Arbeitsgang ist in einer Wertschöpfungskette
mit Arbeitsgängen vor- und nachgelagerten Stellen verknüpft.
"Prozessoptimierung" kann aus dieser Sicht verstanden werden
als vertikale, gegebenenfalls auch horizontale Abstimmung von Arbeitsgängen
in mengenmäßiger und zeitlicher Hinsicht innerhalb einer gegebenen
aufbaustrukturellen Logik.
Obwohl schon Kosiol betonte, dass es sich bei der gedanklichen Abstraktion
von Aufbau und Ablauf zwar um einen methodisch wichtigen Vorgang handelt,
der im Wesentlichen aber doch den gleichen Tatbestand des Wirtschaftsgeschehens
in der Unternehmung umschreibt, so wurde jedoch faktisch die Ablauforganisation
von der Aufbauorganisation dominiert. Die Ablauforganisation degenerierte
quasi zum Lückenbüßer: Während die Aufbauorganisation
die Prämissen setzte, wurden die Abläufe zu einer nachgeordneten,
möglichst algorithmisierbaren Angelegenheit (vgl. Osterloh/Frost
1994, S. 358). Zur Verwirklichung des Ganzheitlichkeitsanspruches des
Prozessmanagements sollte daher die ablauforganisatorische Dimension in
den Vordergrund gerückt und das Unternehmen als Verknüpfung
von Flüssen und Prozessen betrachtet werden (vgl. Fantapié-Altobelli/
Gaitanides 1999, S. 596). Prozessorientierte Organisationsgestaltung folgt
diesem Gestaltungsmuster. Das bedeutet, dass Arbeitsgänge und Arbeitsgangfolgen
unabhängig von dem aufbauorganisatorischen Kontext zu entwerfen und
Stellen erst auf der Basis integrierter Verrichtungskomplexe zu bilden
sind. Anstelle der Logik "Ablauforganisation folgt Aufbauorganisation"
gilt nun: "Aufbauorganisation folgt Ablauforganisation".
2.2 Prozessorganisation - die ökonomische Perspektive
Die ökonomische Perspektive des Prozesskonzepts besteht in der Anwendung
der Transaktionskostentheorie auf die interne Organisation (vgl. Williamson
1985; Theuvsen 1997, S. 972 ff.). Zwischen Funktional- und Spartenstruktur
gibt es hybride Strukturmuster, die das Verrichtungs- und Objektmodell
miteinander verknüpfen. Die Prozessorganisation verbindet Verrichtungs-
mit Objektzentralisation, wobei produkt-, kunden- oder projektgruppenspezifische
Varianten der Spezialisierung gewählt werden können. Tabelle
1 verdeutlicht den Zusammenhang.
Den Segmentierungsalternativen lassen sich idealtypisch bestimmte Koordinationsinstrumente
zuordnen, mit denen Transaktionen zwischen Organisationseinheiten abgewickelt
werden sollen. Funktionale Spezialisierung korrespondiert mit hierarchischer
Koordination, produkt- oder kundenorientierte Differenzierung mit internen
Marktbeziehungen (Verrechnungspreissystemen).
Zur Koordination der prozessinternen crossfunktionalen Transaktionen,
d.h. der Aktivitäten eines Prozesses, haben sich teamartige Kooperationsstrukturen
als effiziente Abstimmungsinstrumente herausgebildet. Selbstabstimmung
bezweckt - im Unterschied zur Arbeitsverteilung in der klassischen Ablauforganisation
- immer auch einen integrierten Prozessvollzug.

Tabelle 1: Segmentierungsmodelle
Der Informations- und Leistungsaustausch zwischen den Prozessteams bzw.
den "process ownern" werden durch langfristige Vereinbarungen
("service level agreements") abgestimmt. Die Schnittstellen
zwischen Prozessen werden als Kunden-Lieferanten-Beziehungen definiert,
Verrechnungspreise als Koordinationsinstrumente indessen eher selten genutzt.
Vielmehr bietet sich "inside contracting" (Williamson 1985,
S. 68 ff.) als geeignetes Koordinationsinstrument an.
Williamson unterscheidet institutionelle Kooperationsformen hinsichtlich
einer Reihe von Effizienzkriterien, die sich auf die Höhe der Transaktionskosten
auswirken (vgl. Williamson 1991, S. 277 f.):
-
die Anreizintensität als das Ausmaß intrinsischer oder extrinsischer Motivation,
die Anpassungsfähigkeit als Fähigkeit, autonom oder kooperativ auf Änderung von -
Umweltparametern reagieren zu können,
das Ausmaß des Vertrauens auf bürokratische Steuerung und Kontrolle, das opportunistisches bzw. suboptimales Verhalten der Transaktionspartner verhindern kann (Governance-Vertrauen),
-
die Kosten der Etablierung und Nutzung des Koordinationssystems.
-
Darüber hinaus müssen bei der Betrachtung von Koordinationskosten auch Produktionskostenunterschiede berücksichtigt werden (vgl. Theuvsen 1997, S. 985), die sich vor allem aus Skaleneffekten ergeben.
Die Effizienz der alternativen Koordinationsformen ist in Abbildung 1
zusammengefasst.
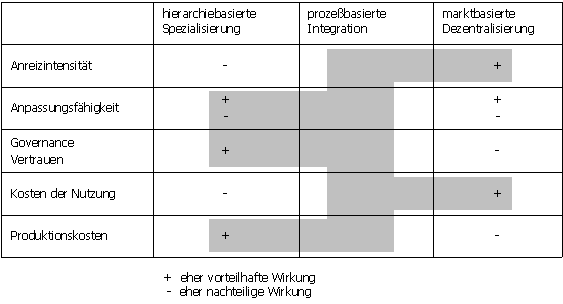
Abb. 1: Effizienz alternativer Koordinationsmuster
Die Höhe der Transaktionskosten wird von den Transaktionsbedingungen
Spezifität, Unsicherheit und Häufigkeit bestimmt. Prozessorientierte
Integration ist besonders effizient bei einem standardisierbaren, nicht
auf eine spezielle Verwendungsmöglichkeit zugeschnittenen Leistungsaustausch.
Ist der für die Austauschprozesse benötigte Ressourceneinsatz
hoch spezifisch, oder handelt es sich um unspezifische, auch über
externe Märkte beziehbare Standardleistungen, dann verliert die prozessorientierte
Integration ihre ökonomischen Vorteile (vgl. Göbel 2002, S.
248). Markteffizienz einerseits und Ressourceneffizienz andererseits schaffen
Bedingungen, welche die Effizienz des Prozessmodells begrenzen. Besonders
sichere bzw. unsichere Transaktionsbedingungen, hervorgerufen z.B. durch
das Ausmaß an Marktdynamik, sind daher ebenfalls nicht die Domäne
der prozessorientierten Integration. Nicht anders verhält es sich
mit der Häufigkeit, mit der sich Transaktionen wiederholen. Auch
hier liegt die Vorteilhaftigkeit der Prozessorganisation bei mittlerer
Wiederholungshäufigkeit, wobei sehr hohe Wiederholungshäufigkeit
eine Spezialisierung des Ressourceneinsatzes, geringe Wiederholungshäufigkeit
indes eine marktliche Dezentralisierung effizient erscheinen lässt.
Die prozessorientierte Integration entfaltet ihre Vorteile als effizienter
Koordinationsmechanismus immer dann, wenn die Austauschbeziehungen nicht
extremen Ausprägungen von Spezifität, Unsicherheit und Häufigkeit
des organisationsinternen Leistungsaustausches unterworfen sind.
2.3 Prozessorganisation - die konstruktivistische Perspektive
Mit dem Anliegen, die funktionale Arbeitsteilung zu überwinden,
die Aufgabenspezialisierung durch Abteilungsgrenzen überschreitende,
schnittstellenfreie Geschäftsprozesse zu ersetzen und ganzheitliche,
selbstbestimmte Arbeit zu ermöglichen, wird fraglos ein für
Betroffene und Beteiligte attraktives Modell organisatorischer Koordination
entworfen. Es vermittelt ihnen, warum in der Vergangenheit Wandlungsbedarf
aufgetreten ist, und welche besseren organisatorischen Lösungen sich
in Zukunft bieten.
Begriffliche Konstrukte wie Geschäftsprozess, Prozessorganisation
und Prozessmanagement sind plastisch und bildhaft. Sie lassen sich leicht
verständlich machen, ihrer Sinnhaftigkeit vergewissern und kommunizieren.
Sie eröffnen Interpretationsspielraum, aus dem heraus jeder Betroffene
seine Alltagserfahrung kommentieren und mitteilen kann. Interpretationen
erlauben den Adressaten der Botschaft Bedeutungszuweisungen auf Basis
der eigenen Lebenserfahrung, ihren Überbringern visionäre und
pragmatische Kompetenz.
"Prozessorganisation" ist ein Konstrukt, das erst durch Kommunikation
und Interaktion, also durch Sprache vermittelt, zur Realität wird
- ebenso wie das, was ein Prozess ist und was er leistet. Erzeugung und
Etablierung der Prozessorganisation erhalten durch Kommunikation ihre
faktische Geltung. In dem über Prozesse und ihre Organisation kommuniziert
wird, werden sie zur Realität. Prozessorganisation ist in diesem
Sinne nicht ein an einer Rezeptur oder an einem Referenzmodell festzumachendes
organisatorisches Design, sondern eine kollektiv erzeugte und mithin sozial
konstruierte Realität. Aus Interpretationen, Bedeutungszuweisungen
und geistigen Konstrukten entwickelt, hat sie sich zu Strukturen verfestigt
und ist doch immer wieder Objekt neuer Rekonstruktionen geworden. Die
Reichweite der Konstruktionsmuster erstreckt sich von der Organisationstechnik
bis hin zur Theorie der Unternehmung.
So eignet sich Prozessorganisation in besonderer Weise als "Redeinstrument",
da sie als Orientierungsmuster zum Verständnis komplexer Koordinationsprobleme
zur Verfügung steht, was ihren herausragenden Stellenwert in der
Sprache der Organisierenden begründet. Mittlerweile hat sie den Rang
einer gesellschaftlichen Institution des Organisierens erhalten. Sie ist
die programmatische Metapher für Modernität in Wirtschaft und
Verwaltung, als DIN-Norm formalisiert und in Lehrplänen verewigt.
3 Elemente des Prozessmodells
Trotz der vielfältigen Beiträge zum Thema Prozessmanagement/
Prozessorganisation gibt es konzeptionelle Gemeinsamkeiten, die im Folgenden
dargestellt werden.
3.1 Ablösung funktionaler Organisationsprinzipien
Das fraglos wichtigste Fundament stellt das Prozesskonzept dar. Es beinhaltet
die Ablösung von funktionalen Organisationsprinzipien durch eine
konsequente Orientierung auf bereichsübergreifende Geschäftsprozesse.
Gleichwohl können sich organisatorische Gestaltungsmaßnahmen
grundsätzlich sowohl auf die Ablauforganisation, und somit auf institutionale
Probleme und Bestandsphänomene, als auch auf die Aufbauorganisation
als raumzeitliche Strukturierung der Arbeits- und Bewegungsvorgänge
beziehen. Ein entsprechendes organisatorisches Design unterscheidet Kern-
und Supportprozesse. Währende erstere in der Regel auf externe Kunden
ausgerichtet sind und Wettbewerbsvorteile generieren, sollen Letztere
für interne Kunden bzw. andere Geschäftsprozesse Leistungen
erzeugen. Schnittstellen zwischen Bearbeitungsschritten können so
entfallen, mit dem Ziel Abstimmungsaufwand zu reduzieren.
Eine Funktion ist das Ergebnis einer strukturorganisatorischen Zusammenfassung
einer oder mehrerer Teilaufgaben. Dies kann stellenbezogen eine einzelne
Tätigkeit oder stellenbereichsbezogen eine Abteilung sein. Somit
sind stellen- oder abteilungsgebundene Arbeitsumfänge und -inhalte
die Schwerpunkte der funktionalen Sichtweise. Wird nun jeder Bereich bzw.
jede Abteilung nach spezifisch funktionalen Zielsetzungen für sich
optimiert, so entspricht diese Gestaltung organisatorischer Strukturen
der herkömmlichen Strategie der "funktionalen Exzellenz"
(vgl. Gaitanides/Scholz/Vrohlings 1994, S. 11). Für einfache Tätigkeiten,
die nur einen geringen Vernetzungsgrad bei geringer inhaltlicher Abhängigkeit
aufweisen, sind die hieraus resultierenden stark arbeitsteiligen Strukturen
sinnvoll und vorteilhaft. Mit zunehmender Komplexität der Produkte
und der dazugehörigen Tätigkeiten stellt sich jedoch die Annahme,
die Summe einzeln optimierter Abteilungen führe auch zu einem ganzheitlichen
Optimum, als Trugschluss heraus. Als Ursache hiefür wird in der Literatur
oftmals ein so genannter Ressort- bzw. Bereichsegoismus genannt, welcher
durch unterschiedliche abteilungsbezogene Zielsetzungen nur zu suboptimalen
Gesamtlösungen führt. Gleichzeitig verursacht dieses Bereichsdenken
Schnittstellen und erhöht somit den Koordinationsbedarf zwischen
den einzelnen Wertschöpfungsstufen.
Immer häufiger wird daher der Prozessorganisation Vorrang gegenüber
funktions- und objektbezogenen Strukturierungsprinzipien eingeräumt.
Bei Prozessen handelt es sich um Objekte, die funktionsübergreifend
angelegt ist. Ein Prozess ist eine zeitlich und räumlich spezifisch
strukturierte Menge von Aktivitäten mit einem Anfang und einem Ende
sowie klar definierten Inputs und Outputs. Zusammenfassend: "A structure
for action". Hammer/Champy definieren Prozesse als Gruppen verwandter
Aufgaben, die zusammen für den Kunden ein Ergebnis von Wert ergeben
(vgl. Hammer/Champy 1993, S. 52). Kundennutzen entsteht nicht durch die
Einzelaktivitäten einzelner Vorgänge oder Teilprozesse, sondern
durch das Bündeln von Teilleistungen, die in ihrer Ganzheit einen
identifizierbaren Wert für Kunden enthalten. Prozesse sind danach
Tätigkeitsfolgen, die Kundenwert schaffen.
Obwohl sich diese Sichtweise inzwischen längst durchgesetzt hat,
überwiegt dessen ungeachtet eine funktionsorientierte Denkweise in
der Praxis (So zeigt bspw. eine empirische Untersuchung von Braßler/Schneider,
dass lediglich 50 v.H. der Vertreter von Automobilherstellern die Organisation
ihrer Unternehmen als prozessorientiert einstufen, bei den Zulieferern
sind es weniger als 20 v.H. Vgl. Braßler/Schneider 2001, S. 149.).
Diese hat zur Folge, dass die Aufbaustruktur die Freiheitsgrade bei der
Prozessgestaltung erheblich einschränkt und wesentliche Potenziale
zur Optimierung der Abläufe verloren gehen. In einer funktionsorientierten
Organisation gibt es gegenüber dem prozessorientierten Äquivalent
erheblich mehr Schnittstellen, die bei der Auftragsabwicklung überwunden
werden müssen. Da Schnittstellen immer auch Liegestellen und Irrtumsquellen
sind, ist eine solche Organisationsform als ineffizient zu bezeichnen.
Der grundlegende Unterschied zwischen einer funktionsorientierten und
einer prozessorientierten Organisationsgestaltung wird in Abbildung 2
verdeutlicht.

Abb. 2: Unterschied zwischen einer funktions- und prozessorientierten Organisationsgestaltung
Ziel der Prozessorganisation ist es, möglichst durchgängige,
schnittstellenfreie Prozesse zwischen Beschaffungs- und Absatzmarkt zu
gestalten. Die konsequente Orientierung an Prozessen ermöglicht Transparenz
über diese, über deren Ressourcenverzehr und deren Beitrag zur
Wertschöpfung. Damit kann sowohl die Flexibilität als auch die
Beherrschung von Unternehmensabläufen gefördert und die nachhaltige
Differenzierung vom Wettbewerb erreicht werden. Allein die Transparenz
der crossfunktionalen Abläufe innerhalb von Unternehmen deckt Ineffizienzen
durch Schnittstellen, Liegezeiten oder Doppelspurigkeit auf. In diesem
Sinne wird mit der Prozessorientierung ein Weg zu Rationalisierungsvorteilen
beschritten. Denn prozessorientiertes Denken initiiert eine kontinuierliche,
inkrementale Verbesserung der Organisation, ohne dass endgültige
Zielzustände vorgegeben werden. Reorganisationsbemühungen müssen
aus diesem Grunde crossfunktional und prozessorientiert ablaufen, so dass
Abstimmungsverluste und Suboptima minimiert werden (vgl. Gaitanides/Scholz/Vrohlings
1994, S. 12f.).
3.2 Kundenorientierung
Ein zweites wesentliches Element ist die Kundenorientierung. Intern wie
extern orientierte Prozesse werden an ihren Leistungen für Kunden
beurteilt und ihre Wertschöpfung am Kundennutzen gemessen. Leistungsniveaus,
sogenannte "service level agreements", werden zwischen den "process
ownern" ausgehandelt. Benchmarking und Outsourcingentscheidungen
von Prozessen orientieren sich an dem Kriterium "Kundennutzen".
Die kundenorientierte oder vorgangsorientierte Rundumbearbeitung als ein
weiteres Element erfolgt durch teamartige Zusammenarbeit in den "process"-
oder "case"-Teams. Sie sollen Vorgänge ganzheitlich und
integrativ bearbeiten, um die Servicequalität des Prozesses zu verbessern
und Durchlaufzeiten zu verringern. Entsprechend der Komplexität des
Bearbeitungsvorganges einzelner Objekte bzw. Objektgruppen lassen sich
Prozesse nach Produkt-, Kunden-, Lieferantengruppen segmentieren.
Kundenorientierung und integrierte Rundumbearbeitung setzen voraus, dass
Mitarbeiter ausreichende Handlungsspielräume besitzen und befähigt
werden, nutzenstiftende Initiativen zu entfalten ("empowerment").
3.3 Informationstechnologische Unterstützung
Bei der Durchführung von Geschäftsprozessen werden Informationen
benötigt, erzeugt, gespeichert, verarbeitet und zur Verfügung
gestellt. Nur wenn diese Informationen bestimmten Qualitätskriterien
genügen, können Prozesse erfolgreich generiert, strukturiert
und beherrscht werden, so dass der Output hinsichtlich Zeit, Kosten und
Qualität den geforderten Normen entspricht. Ein typischer inhaltlicher
Schwerpunkt von Beiträgen zur Prozessorganisation ist deshalb die
Betonung der Rolle der Informations- und Kommunikations-(IuK-)technologie
als Katalysator bei der Optimierung von Geschäftsprozessen. Dabei
wird herausgestellt, dass IuK-Technologie neben der Unterstützung
bereits bestehender Prozesse, auch grundlegend neue organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten
eröffnet. Im Zusammenhang mit einem prozessorientierten Informationskonzept
stehen insbesondere Begriffe wie Prozessstrukturtransparenz und Prozessleistungstransparenz.
Transparenz ist der Schlüssel dafür, die komplexen Wirkungszusammenhänge
im Unternehmen beherrschbar machen zu können. Ein modernes Informationssystem
ist daher bei allen organisatorischen Umgestaltungsbemühungen als
elementar anzusehen.
Kundenorientierung und Rundumbearbeitung verlangen dezentralen Datenzugriff.
Informationstechnologie wird daher als "enabler" begriffen.
Die IT ermöglicht es erst, integrierte Geschäftsprozesse zu
entwickeln und ganzheitliche Vorgangsbearbeitung zu realisieren. Ihr kommt
daher besondere Bedeutung beim innovativen Entwurf und effizienter technischer
Umsetzung von Geschäftsprozessen ("work flow") zu.
In der Informations- und Datenverarbeitungs(DV-)literatur steht die Binnenstrukturierung
von Prozessen im Vordergrund. Die Frage, wie Prozesse strukturiert sind,
ist wichtig, um Zeit und Kosten eines Prozesses messen zu können.
In der DV-orientierten Literatur werden zum besseren Prozessverständnis
Referenzmodelle empfohlen. Vorgefertigte Prozessmuster sollen es erleichtern,
integrierte Geschäftsprozesse zu definieren und zu beschreiben. Ein
wesentlicher Bestandteil des Prozessverständnisses besteht darin,
dass die Aktivitäten in einer Reihenfolge zu strukturieren sind,
wobei es sich um den Fluss bzw. die Transformation von Material, Information,
Operationen und Entscheidungen handeln kann.
Zur Unterstützung der Prozessgestaltung existiert eine Vielzahl von
Softwaretools, mit deren Hilfe Geschäftsprozesse dargestellt, analysiert,
simuliert, optimiert, modelliert und dokumentiert werden können.
Meist sind sie auf spezifische Anwendungen spezialisiert. Tabelle 2 zeigt
einige ausgewählte Tools und ordnet sie ihren Anwendungsmöglichkeiten
zu:

Tabelle 2: Softwaretools zum Geschäftsprozessmanagement
4 Phasen der Prozessgestaltung
Die Einführung der Prozessorganisation umfasst eine Vielzahl aufeinander
bezogener Aktivitäten. So werden Aktivitäten der Identifikation,
des Designs bzw. der Modellierung sowie der Implementierung unterschieden.
4.1 Prozessidentifikation
Die Diskussion "Funktion" versus "Prozess" ist nicht
zuletzt Folge eines Wissensdefizits bezüglich der Identifikation
und Definition von Prozessen. Wie Prozesse zu erkennen und zu erheben
sind, wird in der Literatur nur unzureichend thematisiert. Prozesse werden
als gegeben und bekannt unterstellt, Probleme werden allenfalls im Bereich
der Optimierung bestehender Prozesse und weniger in dem Design und der
Implementierung zukünftiger Prozesse gesehen. Bei der Prozessidentifikation
handelt es sich fraglos um die alle weiteren Aktivitäten determinierende
und damit zugleich erfolgsbestimmende Phase. Um so unverständlicher
ist, dass ihr nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Unter Prozessidentifikation und -selektion werden folgende Schlüsselaktivitäten
verstanden:
-
Enumeration der Hauptprozesse,
-
Festlegung der Prozessgrenzen,
-
Bestimmung der strategischen Relevanz der Prozesse,
-
Analyse der Pathologie bzw. Verbesserungsbedarf der Prozesse,
-
unternehmenspolitische und -kulturelle Bedeutung der Prozesse.
In der Literatur lassen sich zumindest Hinweise für grundsätzliche Vorgehensweisen bei der Prozessidentifikation finden. Beispielsweise wird darauf verwiesen, dass die für die Kernkompetenz eines Unternehmens wettbewerbskritischen Prozesse zu erheben und zu verbessern sind (vgl. Gerpott/ Wittkemper 1994, S. 8). Prozesse als solche werden also als existent angenommen. Ablaufzusammenhänge sind jedoch oft unscharf, mehrdeutig, uneinheitlich, variabel, zufällig, neuartig und assoziativ. Will man also einzelne Prozesse identifizieren, dann bedarf es einer Konstruktions- bzw. Entwurfsleistung. Sollen diese Prozesse explizit definiert und beschrieben werden, so sind Entscheidungen über deren Anfang und Ende, Inhalt, Art und Umfang zu treffen. Ansätze hierzu lassen sich in singuläre und allgemeine Prozessidentifikation bzw. in eine deduktive und induktive Prozessgenerierung unterscheiden.
Deduktive versus induktive Prozessidentifikation
Ausgehend von allgemeinen Leistungsprozessen, die in allen Unternehmen
in abstrakter Form vorfindbar sind, handelt es sich bei der Identifikation
und Definition des deduktiven Prozessentwurfs allein um deren Konkretisierung.
Bei diesen Prozessen handelt es sich um grundlegende, allgemeingültige
Prozesse im Sinne von "Rahmenprozessen". Sie werden deduktiv
und auf der Basis idealtypischer Geschäftsprozesse identifiziert,
indem allgemeine Rahmenprozesse unternehmensspezifisch differenziert und
ihre Strukturen auf Basis wettbewerbskritischer Erfolgsfaktoren generiert
werden. So lässt sich die Unternehmensstruktur als Netzwerk von Geschäftsprozessen
darstellen. Ein Beispiel dafür geben die so genannten "allgemein
differenzierbaren Leistungsprozesse" in Abbildung 3.

Abb. 3: Allgemeine idealtypische Geschäftprozeßidentifikation (Sommerlatte/Wedekind 1990, S. 3)
Probleme entstehen bei dieser Vorgehensweise dann, wenn das Prozessmodell
auf der Makroebene verändert und an Umweltbedingungen angepasst werden
muss. Lediglich die konkrete Ausformung der "Rahmenprozesse"
ist branchen- oder unternehmensspezifisch vorzunehmen (vgl. Striening
1988, S. 201). Hierbei geht es jedoch weniger um die Identifikation als
um die Beschreibung von Prozessen.
Demgegenüber sieht eine eher induktive Prozessidentifikation, die
an konkreten Leistungen zur Generierung von Kundennutzen ansetzt, den
schrittweisen Aufbau von Kernprozessen bzw. Supportprozessen vor. Sie
setzt an singulären Prozessen an, die in jedem Unternehmen unterschiedlich
sind und entsprechend den Kundenbedürfnissen und der Wettbewerbssituation,
d.h. der individuellen Problemlage erzeugt werden müssen. Das Vorgehen
setzt bei Kundenbedürfnissen an, wobei die Prozesse zielgerichtet
als spezifische Kunden-Lieferanten-Beziehungen definiert werden (vgl.
Abb. 4).
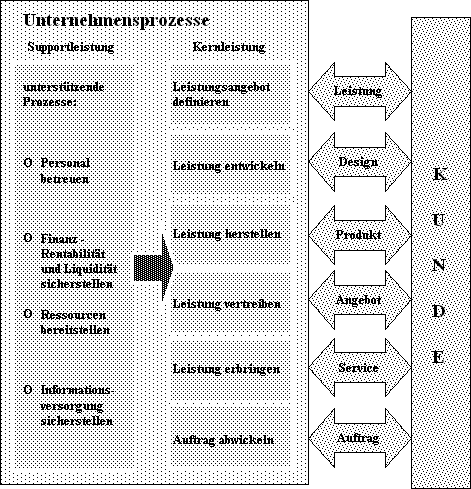
Abb. 4: Situative kundenorientierte Geschäftsprozessidentifikation (Gaitanides/Scholz/Vrohlings 1994, S. 17)
Das Prozessmodell des Unternehmens besteht aus den kundenorientierten
Kernprozessen (Kernleistung) und den sie unterstützenden Supportprozessen
(Supportleistung). Entsprechend den Fähigkeiten und Kompetenzen,
die durch Einsatz und Bündelung von Ressourcen geschaffen werden,
beinhaltet das Prozessergebnis wettbewerbskritische Leistungen, welche
die Stärken bzw. Schwächen des Unternehmens im Vergleich zu
seinen Konkurrenten reflektieren. Erst die Ausdifferenzierung dieser Kompetenzen
und der damit verbundenen kritischen Erfolgsfaktoren führt zur Identifikation
von Kernprozessen. Wettbewerbsstrategische Problemformulierung und Prozessidentifikation
sind kreative und innovative Handlungen, die von erfahrenen Mitarbeitern
oder Arbeitsgruppen erbracht werden müssen. Für die sich anschließende
Prozessbeschreibung bieten sich die meisten Softwaretools an.
Ob die singuläre oder allgemeine Prozessidentifikation bzw. die induktive
oder deduktive Prozessgenerierung gewählt wird, ist für Umfang
und Intensität des Wandels von maßgeblicher Bedeutung. Fundamentaler
und radikaler Wandel - wie häufig gefordert - scheint nur bei induktiver
Prozessgenerierung denkbar. In diesem Fall lassen sich jedoch keine Gestaltungsempfehlungen
für das Vorgehen bei der Prozessidentifikation geben.
Prozessanalyse versus Prozessverstehen
Während die Prozessanalyse das Prozessergebnis als eine gegebene,
gegebenenfalls verbesserbare Größe betrachtet, geht das Prozessverstehen
von einer Reflexion des Prozessergebnisses aus. Prozessverstehen bedeutet,
Ziele und Probleme des Prozesskunden zu erkennen. Es besteht demzufolge
nicht darin, die Funktionsweise eines identifizierten Prozesses, sondern
allein darin, die Funktion dieses Prozesses zu erkennen. Für das
Prozessverstehen reicht es meist aus, die Prozesse abstrahiert von der
Ist-Situation zu beschreiben. Umfangreiche Erhebungsarbeit, Prozessgliederung
in unterschiedlich detaillierten Ebenen kann entfallen. Stattdessen geht
bei der Prozessbeschreibung um einfache Prozessmuster, die ca. 80 % der
Fälle erfassen.
Bei der Prozessanalyse werden darüber hinaus deduktiv die Makro-Prozesse
in detailliertere Teilprozesse zerlegt. Dabei wird das Verfahren der Dekomposition
angewandt. Der Detaillierungsgrad kann bis zum Ausweis der einzelnen Prozessvarianten
gehen. Eliminierung redundanter Tätigkeiten oder Parallelisierung
von Tätigkeiten sind typische Verbesserungsmaßnahmen, die eine
relativ hohe Detaillierung erfordern.
Der Anspruch des Reengineering, Prozesserneuerung - und nicht bloße
Prozessverbesserung - anzustreben, setzt Prozessverstehen voraus. Offen
bleibt allerdings, ob dem Prozessverstehen die Prozessanalyse folgen muss
und bis zu welchem Detaillierungsgrad sie vorzunehmen ist.
4.2 Prozessdesign/-modellierung
Das Hauptaugenmerk gilt dem Design von Prozessen. Konzepte für eine
prozessorientierte Gestaltung von Organisationen sind in den meisten Veröffentlichungen
anzutreffen. "Erfolgsrezepte" werden meist von Unternehmensberatungen
vorgeschlagen, die ihre Kompetenz auf diesem Gebiet reklamieren. Eine
kritische Auseinandersetzung mit ihrem Angebot fällt indes eher dürftig
aus. Prozessoptimierung findet im Spannungsfeld von Qualitäts-, Kosten-
und Zeitkriterien statt. Dabei wird implizit eine "neue Zielharmonie"
unterstellt, wobei oftmals darauf verzichtet wird, der Frage nachzugehen,
ob und unter welchen Bedingungen tiefgreifende Reorganisationsprozesse
komplementäre Lösungen bezüglich dieser Ziele zulassen.
Darüber hinaus werden Gestaltungsziele wie Stärkung der Innovationsfähigkeit
oder Reduzierung der internen Komplexität vorgeschlagen. Die Prozesse
müssen hinsichtlich dieser Kriterien Verbesserungsprogrammen unterworfen
werden, um einer Benchmarking-Analyse der Wettbewerber standzuhalten.
Es zählt zu den gesicherten Wissensbeständen, dass das Redesign
von Prozessen sich nicht in einem, sondern in mehreren Optimierungsschritten
- ergänzt um TQM-Maßnahmen - zu vollziehen habe. Fundamentaler
Wandel (Reengineering) wird von kontinuierlicher Verbesserung (TQM) begleitet.
Wandel und Verbesserung werden mittels Verfahrensempfehlungen wie "Eliminieren",
"Änderung der Reihenfolge", "Hinzufügen fehlender
Schritte", "Integration", "Automatisieren", "Beschleunigen"
oder "Parallelisieren" der Teilprozesse vollzogen. Meist werden
jedoch nur Verfahrensempfehlungen darüber gegeben, was zu reorganisieren
ist, nicht aber, wie Prozesse zu reorganisieren sind.
Kontinuierliche Verbesserung versus Quantensprung
Zwischen den Extremen von evolutionärem und revolutionärem Wandel
gibt es diverse Formen und Intensitätsgrade des Wandels. Hier werden
die Varianten "schrittweise bzw. kontinuierliche Verbesserung"
und "Quantensprung" gegenübergestellt (vgl. Abb. 5).
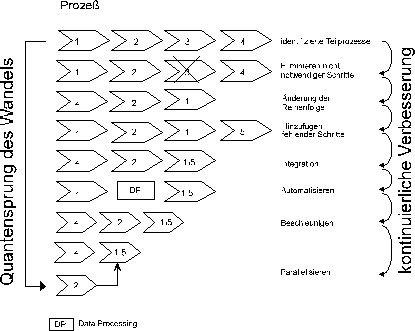
Abb. 5: Tiefe der geschäftsprozessorientierten Reorganisation (Krickl 1994, S. 28)
Individuelles und organisatorisches Lernen bringt kontinuierliche Verbesserungen,
die in der Literatur zum Business Reengineering grundsätzlich als
unzureichend angesehen werden: "Reengineering isn't about making
marginal or incremental improvements but about achieving quantum leaps
in performance" (Hammer/Champy 1993, S. 33).
Dramatische, radikale Sprünge sind jedoch nicht so einfach zu realisieren,
wie es die Verfechter dieses Anspruchs glauben machen wollen: Eine Situation,
in der betroffene Mitarbeiter in eine veränderte interne, die Organisation
in eine veränderte externe Umwelt gestellt werden, ist kaum beherrschbar.
Veränderungen machen ein neuartiges, vom bisherigen Verhalten abweichendes
Verhalten notwendig. Um sich in einer veränderten Umwelt erfolgreich
zu bewähren, bedarf es des "Neulernens" (Reber 1992, Sp.
1242). Neulernen vollzieht sich in individuellen, kontinuierlichen Lernschritten,
mit denen ein Verlernen überholter Wissensbestände und Verhaltensweisen
einher geht (Staehle 1994, S. 846). Erfahrungen im Wege eines Versuch-Irrtum-Verhaltens
können jedoch nicht gesammelt werden, wenn eine neue Umweltsituation
Wege und Ziele des Handelns exogen im Voraus bestimmt.
Reengineering bedeutet für den einzelnen Betroffenen zweierlei: Einerseits
verlieren die Grundprämissen des Handelns, die "theories in
use" (Argyris 1992, S. 216ff.) ihre Gültigkeit, andererseits
müssen Wissensbestände und Verhaltensweisen neu entwickelt und
organisiert werden. Auch für die Organisation bedeutet es eine Veränderung,
denn die neue Wissensbasis ist nicht mehr allen Teilnehmern gemein. Es
genügt daher nicht, dass eine Experten- bzw. Machtelite im Besitz
des "neuen" Wissens ist, vielmehr muss unter allen Prozessbeteiligten
die neue Wissensbasis kommuniziert, akzeptiert und in neue Handlungsmuster
("theories of action") umgesetzt werden. "Radically new
situations require that theories of action be replaced, but organizations
have difficulties doing this" (Hedberg 1981, S. 9).
Während Anpassungslernen sich bei konstanter "theory of action"
vollziehen kann, besteht "turnover"-Lernen oder "turnaround"-Lernen
in der Veränderung des Verhaltensrepertoires und der "theory
of action".
Erfolgreiches Reengineering fordert die Aneignung einer neuen "theory
of action" und Verlernen angeeigneter Verfahrensweisen seitens der
Betroffenen im Wege eines revolutionären Umbruchs. Daher bedarf es
machtvoller "gatekeeper" und Managementeliten (vgl. Staehle
1994, S. 846), die diesen Prozess als Promotoren durchsetzen (vgl. Hauschildt
1993, S. 121). Allenfalls nachdem alle systemkonformen Verhaltensweisen
und Lösungsverfahren nachhaltig gescheitert sind, können paradigmatische
Veränderungsprozesse von den Organisationsmitgliedern selbst getragen
werden. In beiden Fällen werden jedoch die notwendigen Kommunikations-
und Sozialisationsprozesse nicht nur den Engpass in zeitlicher Hinsicht,
sondern auch den Hauptrisikofaktor für das Konzept des "dramatischen",
"radikalen" und "fundamentalen" Wandels bilden.
Partieller versus totaler Wandel
Der Umfang des Wandels hängt davon ab, ob er unternehmensweit stattfinden
oder nur einzelne ausgewählte Kernprozesse betreffen soll. Die Beschleunigung
oder Qualitätssteigerung eines Kernprozesses, welcher unmittelbar
der Befriedigung eines Kundenbedürfnisses dient, wird unter Umständen
eine nachhaltigere Effizienzsteigerung nach sich ziehen als der Neuentwurf
des Prozessmodells des Unternehmens. Berücksichtigt man Kosten, Friktionen
und Zeithorizont des Wandels, so können die Optionen des partiellen
oder totalen Wandels durchaus miteinander konkurrieren.
Sequenzielle versus netzwerkartige Prozessstrukturierung
Der Begriff "Prozess" impliziert eine Sequenz logisch aufeinander
folgender Aktivitäten. Die Vorstellung, ein Prozess sei ein sequenzieller
Fluss intermittierender Prozessschritte, wird durch Beispiele aus der
Auftragsabwicklung oder Beschaffung verstärkt. Gemeinhin wird ein
hoher Grad an sequenzieller Interdependenz unterstellt. Bei sequenziellem
Arbeitsfluss sind einzelne Arbeitsschritte nur indirekt durch weitere
Arbeitsschritte linear miteinander verknüpft. Demgegenüber werden
bei direkter, unmittelbarer Verknüpfung die Arbeitsschritte gegebenenfalls
parallel angeordnet.
Die sequenzielle Struktur bildet die Voraussetzung für das Konzept
der kontinuierlichen Verbesserung (Redesign) bzw. für das Konzept
der Veränderung (Reengineering). Verbesserungsmaßnahmen wie
"Eliminieren", "Änderung der Reihenfolge", "Hinzufügen
fehlender Schritte", "Integration bzw. Zusammenfassung einzelner
Schritte", "Beschleunigen" oder "Parallelisieren"
setzen Sequenzialität im Ausgangsprozess voraus. Weisen Prozesse
diese Eigenschaft nicht auf, dann sind sie offenkundig weder dem Redesign
noch dem Reengineering zugänglich.
Die meisten Prozesse - z.B. Prozesse der Produktentwicklung, Kundenakquisition,
Marktkommunikation, Rentabilitäts- und Liquiditätssicherung
oder Strategieplanung und -umsetzung - sind jedoch durch andere Formen
der Interdependenz geprägt. Die Gesamtheit der Interdependenzen hat
hier eine eher netzwerkartige Struktur; man spricht auch von Aktivitäten-Clustern.
Würde man ein komplexes, netzwerkartiges Aktivitätenbündel
in eine lineare Sequenz bringen, entstünden nicht nur zeitliche,
sondern auch inhaltliche Ineffizienzen.
Neben der logischen Struktur des Prozesses ist die Form der personellen
Zusammenarbeit zu berücksichtigen. Diese lässt sich nach Häufigkeit,
Intensität und Zweiseitigkeit der Kooperation unterscheiden. Vereinfachend
reicht das Kontinuum von teamartiger bis isolierter Zusammenarbeit. Letztere
ist durch den wechselseitigen Informationsaustausch und gegenseitige Abstimmung
zwischen betrieblichen Funktions- oder Tätigkeitsbereichen gekennzeichnet.
Sequenzialität der Aufgabenstruktur und Formen der Zusammenarbeit
bedingen sich gegenseitig. Ihre Ausprägungen sind jedoch nicht beliebig,
sondern ergeben sich aus der Logik der Problemstellung, den informationstechnischen
Möglichkeiten und den Anforderungen der Aufgabenumwelt.
Die Struktur der personellen Zusammenarbeit lässt sich nach den in
Abbildung 6 dargestellten vier Typen unterscheiden.
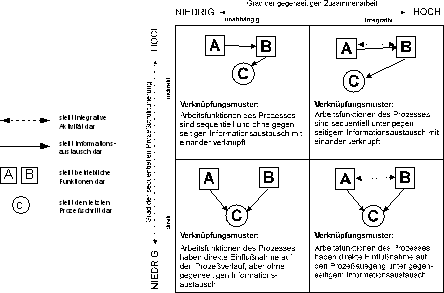
Abb. 6: Sequenzielle oder netzwerkartige Prozessstruktur (Teng et al 1994, S. 15)
Lediglich Typ 1 und 2 sind Prozesstypen im engeren Sinne. Die Typen 3
und 4 enthalten eher netzwerkartige Kooperationsmuster, die der Prozessidee
nicht zugänglich sind. Sie beschreiben teamartige Kooperationsmuster,
wie sie in Projektgruppen oder flexiblen Arbeitsgruppen anzutreffen sind.
Business Reengineering reduziert sich daher auf rein organisatorische
Gestaltungsmaßnahmen und führt damit in folgendes Dilemma:
Prozesse, die nicht sequenziell, sondern netzwerkartig strukturiert sind,
entziehen sich a priori der Reorganisation.
Prozesse, die sequenziell strukturiert sind, können nicht in netzwerkartige
Strukturen überführt werden, da die Instrumente hierfür
fehlen.
Zielsetzung des Redesign bzw. Reengineering kann es zwar sein, die Strukturtypen
1 bzw. 2 in solche vom Typ 3 bzw. 4 zu überführen. Dies ist
jedoch allein mit Maßnahmen der Prozessstrukturierung nicht zu erreichen.
Zu denken ist in diesem Kontext etwa an Konzepte wie Outsourcing oder
Simultaneous Engineering.
Inkrementale versus synoptische Veränderungsstrategie
Der Kern der Änderungsstrategie des Business Reengineering betrifft
die Prozessstruktur. Alle weiteren Maßnahmen, die einen geplanten
Wandel herbeiführen sollen, sind Elemente bekannter Konzepte. Änderungen
im Bereich der Organisationsstruktur, der Unternehmenskultur sowie des
Managementsystems lassen sich auch unabhängig von den genannten Strukturierungsvorhaben
realisieren. Im Rahmen des Reengineering wird jedoch auf diese Maßnahmen
explizit Bezug genommen, da sie als Konsequenz der Prozessstrukturierung
eingesetzt werden müssen. Reengineering bedingt Abflachung der Organisationsstruktur,
Änderung der Arbeitseinstellungen und der Führungskonzepte.
Der Anspruch, ein "fundamentales", "radikales" und
nicht zuletzt "dramatisches" Änderungskonzept vorzustellen,
schließt Veränderungspotenziale jeder Art ein. Prozessuale
Änderungen sind der Ausgangspunkt für organisatorische Änderungen,
welche ihrerseits auch einen kulturellen Wandel erfordern.
Diesem deterministischen Ansatz, der einen "Fit" zwischen diversen
Änderungsprozessen verlangt, lässt sich eine eklektische Änderungsstrategie
gegenüberstellen. Diese stellt die Radikalität ebenso wie die
Kausalität des Änderungsprozesses in Frage.
Um bestimmte Kosten-, Zeit- und Qualitätsziele zu erreichen, können
einzelne geeignete Maßnahmen zur Engpassbeseitigung selektiert und
zu einem Gesamtkonzept integriert werden. Das Prozessdesign erhält
bei dieser Veränderungsstrategie gegebenenfalls nur einen untergeordneten
Stellenwert; es kann die Folge anderer personalwirtschaftlicher oder organisatorischer
Maßnahmen sein.
4.3 Prozessimplementierung
Für die Umsetzung des Redesigns gibt es eine Vielzahl von institutionellen
und prozessualen Implementierungsvorschlägen. Einführungsmodelle
zeichnen sich durch "top-down" angelegte Zielvorgaben und "bottom-up"
generierte Umsetzungsmaßnahmen aus. Die Coaching-Aufgabe des Prozessverantwortlichen
verlangt insbesondere kommunikative Fähigkeiten zur Förderung
der Zusammenarbeit, die bei der Übertragung von Geschäftsprozessen
auf Teams gefordert wird.
In aller Regel wird das Implementierungsproblem als technisch instrumentelle
Fragestellung begriffen, die zu lösen eine Projektmanagementaufgabe
darstellt. Barrieren bei der Umsetzung können den Erfolg von Reorganisationsmaßnahmen
in Frage stellen. Die Auseinandersetzung mit Widerständen ist mithin
ein zentrales Thema der Initiierung des Wandels. Analyse sowie Grundsätze
und Instrumente des Umganges mit dem Widerstand und "die Kunst, den
Wandel zu verkaufen" sollen helfen, strukturelle Veränderungen
vorzubereiten. Das Implementierungsproblem muss aber über die instrumentelle
Fragestellung hinausgehend als grundsätzlicheres Problem des organisatorischen
Wandels begriffen werden. Auch bei Osterloh/Frost wird Prozessmanagement
als das Management von Veränderungsprozessen behandelt (Osterloh/Frost
1998, S. 232). Dabei wird die Intensität des Wandels im Vergleich
von revolutionärer und evolutionärer Strategie des Wandels thematisiert.
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Lern- und Wissenskomponente als
Voraussetzung für erfolgreiche organisatorische Veränderungsstrategien
eingegangen. Erst aus der Integration von Prozess- und Wissensmanagement
können strategische Kernkompetenzen erwachsen. Die Aktivitäten
der Prozessbeteiligten sind dazu in einzigartiger Weise zu Kernprozessen
zu verknüpfen, die es ermöglichen, dass Wissen generiert und
transportiert wird.
Bottom-Up- versus Top-Down-Implementierung
Der Umbau der Organisation von der produktionsorientierten Spezialisierung
zur kundenorientierten Integration beginnt im Business Reengineering an
der Unternehmensspitze. Erfolgreiche Neustrukturierung ist nur durch ein
"top-down"-Vorgehen erreichbar, andernfalls droht die Gefahr
des Scheiterns (vgl. Hammer/Champy 1993, S. 207). Schon die Radikalität
des Wandels schließt ein anderes Vorgehen aus.
Entscheidendes Merkmal für das "top-down"-Vorgehen ist
die Trennung einerseits von Instanzen, die mit der Planung und Einführung
des Reengineering befasst sind, und andererseits von Betroffenen, die
"Prozessarbeit" verrichten sollen. Die Implementierung von Reengineering
wird zahlreichen Verantwortlichen übertragen: "leader",
"process owner", "reengineering team", "steering
committee" und "reengineering czar" (Hammer/Champy 1993,
S. 102 ff.) schaffen gewissermaßen vollendete Tatsachen, mit denen
dann die betroffenen "case worker" umgehen müssen.
Vollzogen werden Geschäftsprozesse dagegen von "case teams",
"case workern", "deal structurers" oder "process
teams" sowie von Mitgliedern der beteiligten Funktionsbereiche (vgl.
Hammer/Champy 1993, S. 51ff. und 65ff.). Dem Grundsatz, Betroffene am
Reorganisationsprozess zu beteiligen, wird offenbar nur unzureichend Rechnung
getragen. Dieses arbeitsteilige Implementierungskonzept widerspricht vor
allem dem Plädoyer der Vertreter des Reengineering für eine
ganzheitliche mehrdimensionale Arbeit, für Delegation von Entscheidungskompetenzen,
für Weiterbildung und Einstellungsänderungen der Mitarbeiter.
Vorgesetzte, so wird unterstellt, sind im Besitz "höheren Wissens"
und frei von funktionalen Suboptimierungsinteressen. Der Quantensprung
des Wandels setzt Fremdstrukturierung und Selbstkoordination voraus.
Für die Nichtbeteiligung der Mitarbeiter des mittleren und unteren
Managements am Reengineering nennen Osterloh/Frost (1994, S. 356ff.) drei
Gründe:
-
Dem mittleren und unteren Management fehlt es an Kenntnis der Wertschöpfungsketten;
-
es fehlt ihm ferner an Entscheidungskompetenzen, um Business Reengineering in aller Radikalität zu entwerfen und umzusetzen;
-
es sei selbst als Objekt in den ReorganisationsProzess involviert und gerate so in Interessenkollision mit den Zielen des Reengineering.
Der kompromisslose Ausschluss von Partizipation zugunsten von Macht-
und Zwangsstrategien erinnert an die Strategie des "erfolgreichen
Bombenwurfs" von Kirsch et al. (1978, S. 249). Auch hierbei wird
die Veränderungsresistenz der Betroffenen durch unvermittelte und
unvorbereitete Konfrontation der Organisation mit einem zunächst
geheimgehaltenen Grobplan für eine tiefgreifende Änderung gebrochen.
Dieses Vorgehen widerspricht freilich den Prinzipien der Organisationsentwicklung
(vgl. Staehle 1994, S. 867) und der Motivationstheorie. Partizipation
der Organisationsmitglieder an fundamentalen Problemlösungs- und
Entscheidungsprozessen wird schon traditionell als Effizienzbedingung
erkannt (vgl. z.B. Coch/French 1947, S. 512ff.).
Dem Konzept der tiefgreifenden Änderung, wie es vom Reengineering
gefordert wird, lässt sich ein eher evolutionäres Entwicklungsmodell
gegenüberstellen, wie es dem Redesign zugrundeliegt. Dies rechtfertigt
sich schon daraus, dass das Ergebnis solcher Eingriffe und Gestaltungsmaßnahmen
nicht voraussagbar sei, denn bei den Interventionen handelt es sich um
solche in vernetzten Systemen (vgl. Probst 1987, S. 118). Das organisierende
Management agiert in diesem Sinn als "Facilitator" (Kieser 1994,
S. 209), das Betroffene beim Finden eigener organisatorischer Lösungen
unterstützt. Kieser verweist allerdings in diesem Zusammenhang darauf,
dass Selbstorganisation "als Gestaltung der Organisationsstruktur
durch die von ihr betroffenen Individuen oder Gruppen (Selbststrukturierung)"
(Kieser 1994, S. 218) nicht ohne Fremdorganisation auskomme. Aus Komplexitätsgründen
müssten Management und Experten am Reorganisationsprozess partizipieren,
was insbesondere auch für den so genannten "kontinuierlichen
Verbesserungsprozess" gelte.
5 Interorganisationale Prozessorganisation - von der
Innensicht zur Außensicht
In den letzten Jahren sticht ein Konzept verstärkt aus der Vielzahl
der möglichen Lösungen zur Begegnung der aktuellen Herausforderungen
der Unternehmensführung heraus: Supply Chain Management. Angestrebt
wird hiermit die Integration der Zielgrößen Kosten, Qualität
und Zeit in einem prozessorientierten, unternehmensübergreifenden
und zugleich kooperationsorientierten Organisations- und Managementkonzept.
Die zugleich intra- sowie interorganisationale Ausrichtung hat zur Folge,
dass sich die Gestaltungs-, Koordinations- und Steuerungsaufgaben auf
alle an der Wertschöpfung beteiligten Unternehmen erstreckt - idealerweise
vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden ("from dirt to dirt")
- und nicht nur auf die aus Sicht des jeweiligen Unternehmens unmittelbar
vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen. Mithin muss die Supply
Chain als eine Einheit begriffen werden, die prozessorganisatorischen
Gestaltungsmaßnahmen unterworfen werden kann.
Die skizzierte Fokussierung auf Prozesse darf im Kontext des Supply Chain
Managements nicht an den Grenzen des Unternehmens Halt machen. Und sie
kann es auch nicht, denn die Ausrichtung formaler Organisationsstrukturen
an Prozessen stellt immer auch die existierenden Unternehmensgrenzen in
Frage (vgl. Ortmann/Sydow 1999, S. 206). Als unproblematisch erweist sich
aber eine solche partielle Grenzauflösung bzw. -verschiebung nicht,
zeigen sich in deren Verlauf doch einige dysfunktionale Folgen, so zum
Beispiel Koordinations- und Loyalitätsprobleme, Identitätsverlust
und Wissensabfluss, denen es auch im Rahmen eines Supply Chain Management
zu begegnen gilt.
In Analogie zu einer Supply Chain kann ein Unternehmen aus analytischen
Gründen zunächst ohnehin als eine prozessuale Verknüpfung
verschiedener organisatorischer Einheiten begriffen werden, so dass sich
die oben dargestellten grundlegenden Integrationserfordernisse auch mit
Blick auf unternehmensinterne Verhältnisse zeigen. Das heißt,
dass zunächst die internen Abläufe und Strukturen prozessorientiert
zu gestalten sind, bevor eine durchgehende Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette
erfolgen kann (vgl. Weber/Dehler 2000, S. 53). Jedoch zeichnen sich Unternehmen
durch einige Besonderheiten im Vergleich zu unternehmensübergreifenden
Wertschöpfungsketten aus, die sich beispielsweise in Aspekten wie
Unternehmenskultur, Führungsstil, Anreizsystemen und anderem niederschlagen.
Die sich hinsichtlich einer interorganisationalen Integration aufdrängende
Frage der Kompatibilität dieser Aspekte legt nun die Vermutung nahe,
dass entsprechende Barrieren zwischen Unternehmen ausgeprägter sein
könnten, als dies innerhalb von Unternehmen der Fall ist. Jedoch
weisen einzelne Überlegungen in eine ganz andere Richtung (vgl. Bowersox/Closs/Cooper
2002, S. 167 ff.). So gehen Bowersox/Cooper/Closs davon aus, dass "[i]n
actual practice, some of the most challenging integration issues involve
cross-functional trade-offs within a specific company" (Bowersox/Closs/Cooper
2002, S. 167). Sie führen dies auf einen Zustand zurück, der
als "the great divide" bezeichnet wird und eine Situation nur
partieller intraorganisationaler Integration beschreibt. In der Praxis
zeigt sich dieses Phänomen unternehmensintern in dem vergleichsweise
hohen Integrationsgrad zwischen den Funktionen Beschaffung und Produktion
einerseits und Distribution und Marketing andererseits bei gleichzeitig
hoher unternehmensexterner Integration dieser Bereiche mit Lieferanten
beziehungsweise Kunden.
Im Ergebnis kann die paradoxe Situation beobachtet werden, dass Unternehmen
an ihren äußeren Grenzen relativ stark integrierte Prozesse
mit anderen Unternehmen der Supply Chain haben, dies intern aber nicht
zu realisieren vermögen. Als Ursachen hierfür werden unter anderem
klarere Machtverhältnisse an den Außengrenzen, die einfachere
Bewertbarkeit von transferierten Produkten und Dienstleistungen sowie
die mangelnde Kenntnis interner Integrationserfordernisse und korrespondierender
Messgrößen angeführt. Bowersox/Cooper/Closs kommen deshalb
zu dem Schluss, dass "... managers seem to achieve more successful
integration with external business partners than they do with managers
and departments within their own firm" (Bowersox/Closs/Cooper 2002,
S. 169). In jedem Fall kann davon ausgegangen werden, dass interne Supply-Chain-Integration
nicht minder anspruchsvoll ist als das unternehmensübergreifende
Pendant.
Ein als ganzheitlich verstandenes Supply Chain Management bezieht sich
also sowohl auf die Prozesse einer Unternehmung selbst (unternehmensinterne
Supply Chain) als auch auf ihre Vernetzung mit ihren Wertschöpfungspartnern
(erweiterte Supply Chain).
Die im Supply Chain Management horizontale und vertikale Integration von
Prozessen wie dem "Auftragsabwicklungs-", "Geschäftsbereitschafts-",
"Produktentwicklungs-" und "Marktwahlprozess" sowie
dem "Controlling"- und "Unternehmensentwicklungsprozess"
(Klaus 1998, S. 439) über mehrere Unternehmen hinweg sind Beispiele
für interorganisationales Prozessmanagement. Dieses setzt voraus,
dass unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse nicht durch
Märkte entkoppelt, sondern durch kooperative Arrangements verknüpft
sind.
Die Wertsteigerungen aufgrund der Senkungen von Transaktions- bzw. Prozesskosten
bei den beteiligten Partnern sowie von Produktions- und Entwicklungskosten
durch bessere Ausnutzung von Netzwerkpotenzialen und Skaleneffekten sind
allerdings nur dann erzielbar, wenn das betreffende Segment der Wertschöpfungskette
als ein unternehmensübergreifender Geschäftsprozess organisiert
ist. Marktliche oder auf Verrechnungspreisen beruhende Koordination in
der Wertschöpfungskette bilden Schnittstellen für das integrierte,
sich an der Geschäftsprozessorganisation orientierende Supply Chain
Management.
Die Integration von interorganisationalen Prozessen ist jedoch nicht nur
für das Supply Chain Management, sondern auch für die diversen
Formen von Unternehmenskooperationen, wie strategische Allianzen oder
Unternehmensnetzwerke die operative Basis, ohne die diese nicht funktionsfähig
sind. So sind strategische Netzwerke in erster Linie immer auch operative
Prozessnetzwerke.
Literatur:
Argyris, C. (1992): On Organizational Learning. Cambridge (Mass.): Blackwell
Business.
Bowersox, D.J./ Closs, D.J./ Cooper, M.B. (2002): Supply chain logistics
management. New York: McGraw-Hill.
Braßler, A./ Schneider, H. (2001): Stand und Entwicklungstendenzen
des electronic Supply Chain Management. In: Zeitschrift Führung +
Organisation, 70. Jg., H. 3, S. 143-150.
Coch, L./ French jr., J.R.P. (1947): Overcoming Resistance to Change,
in: Human Relations, 1. Jg, H. XX, S. 512-532.
Fantapié-Altobelli, C./ Gaitanides, M. (1999): Prozeßorganisation
und Logistik. In: J. Weber/ H. Baumgarten (Hrsg.): Management von Material-
und Warenflussprozessen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, S.
590-606.
Gaitanides, M. (1983): Prozeßorganisation. Entwicklung, Ansätze
und Programme prozeßorientierter Organisationsgestaltung. München:
Vahlen.
Gaitanides, M. (1992): Ablauforganisation. In: E. Frese (Hrsg.): Handwörterbuch
der Organisation. 3. Auflage, Stuttgart: Poeschel, Sp. 1-18.
Gaitanides, M./ Scholz, R./ Vrohlings, A. (1994): Prozeßmanagement
- Grundlagen und Zielsetzungen. In: M. Gaitanides/ R. Scholz/ A. Vrohlings/
M. Raster (Hrsg.): Prozeßmanagement - Konzepte, Umsetzungen und
Erfahrungen des Reengineering. München: Carl Hanser, S. 1-19.
Gerpott, T.J./ Wittkemper, G. (1994): Business Process Redesign (BPR)
- Der Ansatz von Booz Allen & Hamilton. In: M. Nippa/ A. Picot (Hrsg.):
Management prozeßorientierter Unternehmen. Frankfurt am Main: Campus.
Göbel, E. (2002): Neue Insitutionenökonomik. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
Hammer, M./ Champy, J. (1993): Business Reengineering. Die Radikalkur
für das Unternehmen. Frankfurt u.a.: Campus.
Hauschildt, J. (1993): Innovationsmanagement. München: Vahlen.
Hedberg, B. (1981): How organizations learn and unlearn, in: P.C. Nystrom;
W.H. Starbuck (Hrsg.): Handbook of organizational Design, New York: Oxford
University Press, S. 3-27.
Kieser, A. (1994): Fremdorganisation, Selbstorganisation und evolutionäres
Management. In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung,
46.Jg. H. 3, S.199-228.
Kirsch, W./ Esser, W.-M./ Gabele, E. (1978): Reorganisation - theoretische
Perspektive des geplanten organisatorischen Wandels. München: Institut
für Organisation.
Klaus, P. (1998): Supply Chain Management. In: P. Klaus/ W. Krieger (Hrsg.):
Gablers Lexikon der Logistik - Management logistischer Netzwerke und Flüsse,
Wiesbaden: Gabler, S. 434-441.
Kosiol, E. (1962): Organisation der Unternehmung. Wiesbaden: Gabler.
Krickl, O. Ch. (Hrsg.) (1994): Geschäftsprozeßmanagement. Prozeßorientierte
Organisationsgestaltung und Informationstechnologie. Heidelberg: Physica.
Nordsieck, F. (1934): Grundlagen der Organisationslehre. Stuttgart: Poeschel.
Ortmann, G./ Sydow, J. (1999): Grenzmanagement in Unternehmungsnetzwerken:
Theoretische Zugänge. In: Die Betriebswirtschaft, 59. Jg., H. 2,
S. 205-220.
Osterloh, M./ Frost, J. (1994): Business Reengineering: Modeerscheinung
oder "Business Revolution". In: Zeitschrift Führung + Organisation,
63.Jg., H. 6, S. 356-363.
Osterloh, M./ Frost, J. (1998): Prozeßmanagement als Kernkompetenz:
Wie Sie Business Reengineering strategisch nutzen können. Wiesbaden:
Gabler.
Probst, G. (1987): Selbst-Organisation. Berlin u.a.: Pareyl.
Reber, G. (1992): Lernen, organisationales. In: E. Frese (Hrsg.): Handwörterbuch
der Organisation. Stuttgart: Poeschel, S. 1240-1254.
Sommerlatte, T./ Wedekind, E. (1990): Leistungsprozesse und Organisationsstruktur.
In: Arthur D. Little (Hrsg.): Management der Hochleistungsorganisation.
Wiesbaden: Gabler, S. 24-41.
Staehle, W.H. (1994): Management. 7. Aufl., München: Vahlen.
Striening, H.-D. (1988): Prozessmanagement. Frankfurt: Lang.
Teng, J.T.C./ Groover, V./ Fiedler, K. (1994): Business Process Reengineering:
Charting a Strategic Path for the Information Age. In: California Management
Review, 36 Jg., H. 3, S. 9-31.
Theuvsen, L. (1997): Interne Organisation und Transaktionskostenansatz.
In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 67. Jg., H. 9, S. 971-996.
Williamson, O.E. (1985): The economic institutions of capitalism. New
York: Free Pr.
Williamson, O.E. (1991): Comparative Economic Organization: The Analysis
of Discrete Structural Alternatives, in: Administrative Science Quartely,
36. Jg., S. 269-296.