 |
H.-HUGO
KREMER
Qualifizierungsnetzwerke
- Lernumgebung für Lehrkräfte?
|
 (617 kb)
(617 kb)
 print
print |
1 Einführung
Netzwerke werden in der beruflichen Bildung als ein
Schlüssel angesehen, um den aktuellen Veränderungsprozessen
gerecht werden zu können. In dieser Entwicklungstendenz
hat sich auch der Modellversuch CULIK positioniert
und den Workshop 'Gestaltung und Moderierung von Qualifizierungsnetzwerken'
zur Grundlegung der eigenen Arbeit durchgeführt.
CULIK wird unter anderem als ein Qualifizierungsnetzwerk
gekennzeichnet, welches auf 'Selbst-Qualifizierung,
selbständiges und eigenverantwortliches Lernen
von und in Kollegien' ausgerichtet ist. Diettrich/
Jäger weisen darauf hin, dass die berufs- und
wirtschaftspädagogische Literatur zwar "vereinzelt
auf Lernnetzwerke als eine mögliche Lernumgebung
für berufliche Lernprozesse eingeht, wird der
wissenschaftliche Diskurs über das Lernen in
Netzwerken - wenn überhaupt - eher von Vertretern
anderer Fachdisziplinen geführt mit der Folge,
dass zwar Lernen immer wieder als ein Bestandteil
erfolgreicher Netzwerkarbeit thematisiert wird, aber
die Frage nach einer Initiierung und Steuerung von
Lernprozessen und somit auch nach einer didaktischen
Dimension der Netzwerktätigkeit nur selten gestellt
und u. E. auch noch nicht in befriedigender Art und
Weise beantwortet worden ist." (Diettrich/ Jäger
2002, S. 46) Es kann Dehnbostel zugestimmt werden,
dass der Begriff Netzwerk weitgehend unbestimmt bleibt
bzw. vielfältige Interpretationsmöglichkeiten
bietet (vgl. Dehnbostel 2001) und möglicherweise
gerade aus diesem Grund als wichtige Organisations-
und Lernform fungiert. Fraglich ist jedoch, ob herkömmliche
Lern- und Weiterbildungsformen ersetzt bzw. ergänzt
werden können oder neue Begrifflichkeiten für
bekannte Formen des Lernens aufgearbeitet werden müssen.
In diesem Beitrag soll die Diskussion aufgenommen
werden, inwiefern Qualifizierungsnetzwerke als Lernumgebung
der Lehrkräfte dienen können. Netzwerke
sollen so einerseits die Einführung von Neuerungen
und andererseits notwendige Lern- und Arbeitsprozesse
unterstützen (Damit wird nicht das von Wegge
aufgenommene Verständnis aufgenommen, die unter
Qualifizierungsnetzwerken die Kooperation regionaler
Bildungsanbieter diskutiert, vgl. Wegge 1996. ).
Es wurden bereits im Vorfeld des Workshops verschiedene
Thesen zur Diskussion gestellt, die dann im Workshop
aufgenommen wurden. Die Thesen bildeten den Ausgangspunkt
zu einer vertiefenden Diskussion im Zusammenhang mit
Arbeiten aus den Modellversuchen ANUBA und WISLOK
(Es handelt sich um zwei BLK-Modellversuche: ANUBA
steht für Aufbau und Nutzung von Bildungsnetzwerken
zur Entwicklung und Erprobung von Ausbildungsmodulen
in IT- und Medienberufen. WISLOK steht für Wissensforum
als Instrument der Lernortkooperation. Vgl. hierzu
auch die Beiträge von Dilger, Strahler und Tiemeyer
in diesem Band. ). Diese Diskussion hat wiederum neue
Fragen aufgeworfen. Entsprechend des Workshopverlaufs
sollen die Thesen vorgestellt, diskutiert und mit
weiterführenden Fragen versehen werden. Die folgenden
Bereiche wurden im Workshop zur Diskussion gestellt:
Qualifizierungsnetzwerke als Reflex auf gesellschaftliche
Entwicklungen, die Last der Innovationen oder zur
Notwendigkeit von Netzwerken, didaktische Gestaltung
von Netzwerken und Akteure in Qualifizierungsnetzwerken.
Der Beitrag endet mit einigen abschließenden
Bemerkungen.
2 Qualifizierungsnetzwerke als Reflex auf gesellschaftliche
Entwicklungen
Castells hebt hervor, dass Netzwerke die neue soziale
Morphologie unserer Gesellschaft bilden, "und
die Verbreitung der Vernetzungslogik verändert
die Funktionsweise und die Ergebnisse von Prozessen
der Produktion, Erfahrung, Macht und Kultur wesentlich."
(Castells 2001, S. 527) Netzwerkstrukturen binden
sich scheinbar mühelos in verschiedene gesellschaftliche
Diskurse ein. Sind Netzwerke für alles gut? Netzwerke
lassen sich sowohl im Kontext von Globalisierung als
auch von Regionalisierung positionieren oder sowohl
mit der Individualisierungsthese als auch mit einem
zunehmenden Kooperationsbedarf verbinden. Und dennoch
sind Netzwerke nicht gänzlich neu. Diese hat
es "auch zu anderen Zeiten und in anderen Räumen
gegeben, aber das neue informationstechnologische
Paradigma schafft die materielle Basis dafür,
dass diese Form auf die gesamte gesellschaftliche
Basis aufgreift und sie durchdringt." (Castells
2001, S. 527). Netzwerke bieten eine veränderte
Form der sozialen Organisation von Gesellschaft, die
einerseits durch gesellschaftliche Megatrends begünstigt
wird und andererseits diese Entwicklungen nochmals
verstärkt (Die Veränderung von Castells
in der griffigen Formel zusammengefasst, dass mit
Netzwerken eine Macht der Ströme entsteht und
die Ströme der Macht ablöst (Castells 2001,
S. 527).). Bullinger/ Nowak stellen fest, dass der
"historische Prozess der Vergesellschaftung durch
Berufsrollen und Mitgliedschaften in Vereinen und
anderen gesellschaftlichen Organisationen das Individuum
in einer Vielzahl sozialer Netzwerke oder Figurationen
agieren lassen, die sich im Laufe der Geschichte ändern."
(Bullinger/ Nowak 1998, S. 27) Allerdings kann auch
Skepsis dahingehend geäußert werden, dass
eine derartige Durchdringung weite gesellschaftliche
Kreise erfasst bzw. erfassen kann oder mehr oder weniger
versteckt zu einer Abgrenzung bestimmter gesellschaftlicher
Kreise führt. Diese Skepsis sei schon angebracht,
wenn der (jederzeitige) Zugriff auf einen Computer
als Zugang zu Netzwerken notwendig ist (Die Anfangsphase
im Modellversuch Wislok war beispielsweise an allen
Schulen mit der Herstellung einer informationstechnologischen
Ausstattung verbunden, vgl. Dilger/ Kremer 2001. ).
Ebenso sei auch Skepsis dahingehend geäußert,
dass mit Netzwerken eine veränderte gesellschaftliche
Ordnung erzeugt wird. Netzwerkstrukturen können
so dazu beitragen, dass notwendige gesellschaftliche
Probleme nicht wirklich aufgenommen werden und so
die Veränderung darin besteht, dass Akteure sich
in Netzwerke einbringen und nicht einen Erneuerungsprozess
aufnehmen. Gerade für Kooperationen in der beruflichen
Bildung scheint dies eine wichtige zukünftige
Gestaltungsfrage zu sein. Behindern Netzwerke nicht
die grundständige Revision einer Lehreraus- und
-weiterbildung? Damit können die folgenden beiden
Thesen mit den weiterführenden Fragen bestimmt
werden:
· Qualifizierungsnetzwerke als natürliche
Lernumgebung in einer Netzwerkgesellschaft!
Ausgewählte Fragestellungen:
Welche Mechanismen, Kriterien etc. regeln den Zugang
zu Netzwerken?
Unter welchen Konstellationen entstehen Netzwerke?
Was führt zur Auflösung von Netzwerken?
Welche neuen veränderten Strömungsmächte
entstehen?
Wie sind Menschen auf das Leben in einer so genannten
Netzwerkgesellschaft vorzubereiten?
· Netzwerk als Instrument zur Etablierung des
Bestehenden!
Ausgewählte Fragestellungen:
Wie verbinden sich Netzwerke mit bestehenden gesellschaftlichen
Strukturen?
Wie können Netzwerke durch bestehende Strukturen
gelenkt werden?
Welche Handlungsspielräume haben Akteure in
Netzwerken?
3 Die Last der Innovationen oder zur Notwendigkeit
von Netzwerken
In der beruflichen Bildung wird (immer wieder neu)
ein erheblicher Reformbedarf artikuliert. Dies zeigt
sich u. a. durch die Bemühungen zur Einführung
lernfeldstrukturierter Curricula, veränderter
Formen der Lehrerausbildung, Maßnahmen zur Verbesserung
der Lernortkooperation in der dualen Ausbildung, der
Einführung teilautonomer Schulen oder der Nutzung
neuer Technologien auf didaktischer und organisatorischer
Ebene.

Diese Liste könnte problemlos fortgeführt
werden. An verschiedenen Stellen wird darauf verwiesen,
dass der ausgelöste Reform- und Innovationsdruck
kaum zu bewältigen ist (Vgl. hierzu u. a. die
pointierte Darstellung von Dubs 2003, S. 3: "In
letzter Zeit beobachte ich bei Vorträgen oder
an Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrpersonen
zwei Dinge, die mir entweder früher weniger aufgefallen
sind, oder die heute viel prägnanter zum Ausdruck
kommen: Erstens lässt die Innovationsbereitschaft
vieler Lehrpersonen deutlich nach ('nur nicht schon
wieder etwas Neues'). Tief betroffen hat mich beispielsweise
kürzlich die Antwort verschiedener Schulleitungen
auf die Bitte um Mitwirkung in einem kleinen Schulversuch
gemacht. Sie lehnten mit der Begründung ab, sie
hätten ihrer Lehrerschaft versprochen, sie in
nächster Zeit in keiner Weise mehr mit Innovationen
und Untersuchungen zu belasten, damit sie sich wieder
einmal richtig dem Unterricht und ihren Schülern
widmen könnten. Zweitens meine ich eine zunehmende
Skepsis vieler Lehrkräfte und auch von Mitarbeitenden
in der Bildungsverwaltung gegenüber Erkenntnissen
der Erziehungswissenschaften zu erkennen.").
Aus Sicht der Betroffenen mögen sich viele Lehrkräfte
wie ein 'Esel' fühlen, den man mit vielfältigen
innovativen Entwicklungen beladen kann. Die Last der
Innovationen wird zwar an Schulen herangetragen, jedoch
wird diese Last dort oftmals nur geringfügig
bewegt. Der Betrieb stockt einfach. Mit anderen Worten:
Innovationen werden nicht in die Praxis überführt.
Andere Lehrkräfte hingegen sehen die Last als
eine gut zu schulternde Aufgabe, die bereitwillig
aufgenommen und (im Sinne eigener Entwicklungsvorstellungen)
umgesetzt wird (Vgl. z. B. hinsichtlich des heterogenen
Umgangs von Lehrkräften mit lernfeldstrukturierten
Curricula Kremer 2002, S. 252ff. ).
Das Bild des 'Esels' könne nun dazu genutzt
werden, alte wechselseitige Beschuldigungen aufzunehmen
und auf diesem Wege nach einfachen Erklärungsansätzen
für den unterschiedlichen Umgang mit Veränderungen
hinweisen. Dies soll an dieser Stelle nicht erfolgen,
wobei die Bemerkung erlaubt sei, dass beide Verhaltensformen
durchaus nachvollziehbar sein können. Ohne an
dieser Stelle der Frage weiter nachzugehen, ob sich
die Innovationsbereitschaft in berufsbildenden Schulen
erheblich verändert hat, kann festgestellt werden,
dass momentan erhebliche Anforderungen an berufsbildende
Schulen gestellt werden und diese auch zu einer Veränderung
der Tätigkeitsfelder von Lehrkräften führen.
Im Kontext der Einführung lernfeldstrukturierter
Curricula kann festgestellt werden, dass diese mit
einer Erweiterung bzw. Verschiebung des Tätigkeitsfeldes
von Lehrkräften verbunden ist (vgl. hierzu Kremer
2003, S. 282, Kremer/ Sloane 2000). Die Gestaltung
des Veränderungsprozesses kann für die Lehrkraft
selbst als komplexer Lern- und Entwicklungsprozess
interpretiert werden. Die Gestaltung derartiger Prozesse
zeigt sich als komplexe und nur sehr begrenzt steuerbare
Aufgabenstellung. Die Implementation von Veränderungen
in der beruflichen Bildung kann kaum verordnet bzw.
vorweggenommen werden. Nicht der Produzent didaktischer
Theorien entscheidet über die Form der Anwendung,
sondern der Anwender selbst kann als mächtiger
Partner in der Form gesehen werden, dass von dieser
Seite über die Rezeption eine Neu-Entwicklung
der Theorie vorgenommen wird. Die Umsetzung von Neuerungen
erfordert Weiterbildungsprozesse von Lehrkräften
im Voraus. Allerdings ist fraglich, ob derartige Weiterbildungen
in traditioneller Form im Vorfeld erfolgen können
oder nicht andere Lernformen für Lehrkräfte
zu implementieren sind (Vgl. Dubs 2003, S. 5: "Wenn
zudem der Einführung solcher schulgestalterischer
Konzepte keine zielgerichtete Weiterbildung vorausgeht,
und sie nach ihrer Etablierung nicht zum festen Bestandteil
der Lehrergrundbildung werden, verschärft sich
die Problematik nochmals."). Kremer weist darauf
hin, dass die Implementation didaktischer Theorien
selbst als didaktische Problemstellung gekennzeichnet
werden kann. Die Möglichkeiten und Grenzen, die
Arbeitsumgebungen zur Gestaltung didaktischer Innovationen
bieten, entscheiden erheblich über den Erfolg
von Innovationsbemühungen. Der Innovationsprozess
kann als komplexer Lern- und Entwicklungsprozess interpretiert
werden. Damit gewinnen neben Fragen der Produktion
und Präsentation didaktischer Theorien auch Kriterien
zur Gestaltung komplexer Lern- und Arbeitsumgebungen
Relevanz für die Gestaltung von Innovationsprozessen
(vgl. hierzu vertiefend Kremer 2003, S. 336ff.). Dieser
Zusammenhang wird in der folgenden Abbildung nochmals
dargelegt:
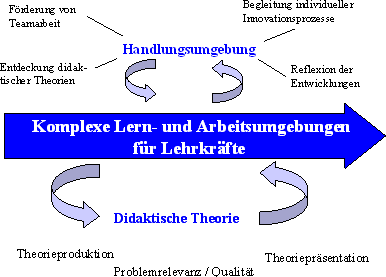
Abb. 2: Komplexe Lern- und Arbeitsumgebungen für
Lehrkräfte
Offen bleibt momentan die folgende Frage: Können
Qualifizierungsnetzwerke Potenziale bieten, um den
notwendigen Weiterbildungsbedarf aufzunehmen und zu
unterstützen oder sind Qualifizierungsnetzwerke
als zusätzliche Anforderung an Lehrkräfte
zu verstehen, die eine weitere Last darstellen?
Es ist so auch aus Sicht der Bildungspraxis durchaus
verständlich, dass Qualifizierungsnetzwerke hinsichtlich
der Verwendung nicht einheitlich aufgenommen werden,
sondern unterschiedlich interpretiert werden. Qualifizierungsnetzwerke
beruhen häufig nicht auf formellen Verträgen
oder ähnlichen Grundlagen, sondern Vertrauen,
Kooperation, interdependente Beziehungen und gemeinsame
Interessenslagen können als Basis von Netzwerken
bezeichnet werden (vgl. hierzu beispielsweise Jütte
2002, S. 23ff). Netzwerke weisen damit aber auch eine
gewisse Störanfälligkeit auf, wenn einzelne
Akteure sich nicht mehr an Interaktionsprozessen beteiligen
oder ganz aus dem Netzwerk aufgrund beruflicher Beteiligungen
ausscheiden. Netzwerke können so die wichtige
Aufgabe unterstützen, dass Generierung und Austausch
von Wissen im Innen- und Außenverhältnis
erfolgen kann. Kritisch kann hingegen festgestellt
werden, dass Qualifizierungsnetzwerke als überaus
störanfällige Felder angesehen werden können,
die durch personelle Veränderungen oder veränderte
Aufgabenstellungen zur Auflösung führen
können. Im Kontext dieser eher allgemeinen Diskussion
können die folgenden drei Thesen aufgestellt
werden:
· Qualifizierungsnetzwerke überschreiten
(System-)Grenzen und sind störanfällige
didaktische Felder!
Qualifizierungsnetzwerke bieten die Möglichkeit,
dass bestehende Kooperationsformen erweitert und differenziert
werden und damit auch neue problemorientierte Interaktionsfelder
entstehen können (Lewin bezeichnet bezugnehmend
auf Einstein "eine Gesamtheit gleichzeitig bestehender
Tatsachen, die als gegenseitig voneinander begriffen
werden" (Lewin 1982, S. 377 als ein Feld. Eine
derartige Verwendung des Feldbegriffs hebt damit eine
(notwendige) ganzheitliche Betrachtung hervor. Sloane
kennzeichnet pädagogische Felder in Anlehnung
an Lewin und Winnefeld auch als mulitvariable Faktorengefüge.
Didaktische Felder stehen demgemäß in einem
interdependenten Zusammenhang. Winnefeld versieht
didaktische Felder mit dem Kennzeichen der Vieldimensionalität
und Komplexität (vgl. Sloane 1983, S. 183, Winnefeld
1957, S. 32). ). Oder ist es nicht doch notwendig,
dass Qualifizierungsnetzwerke auf bestehenden Verbindungen
aufsetzen? Dies mag damit zusammenhängen, dass
so Netzwerken nicht nur explizit eine Aufgabe zugewiesen
wird, sondern diese dann über die 'gemeinsame'
Wissensbasis bereits existiert. Andererseits wäre
zu fragen, wie kann eine Aufgabe in verschiedenen
'Systemen' Bedeutung besitzen? Ebenso wäre in
diesem Kontext klärungsbedürftig, welche
Lebensdauer haben Netzwerke und welche Aufgabenstellungen
sollen von Netzwerken bewältigt werden?
· Die Entwicklung von Qualifizierungsnetzwerken
wird durch die Bereitstellung von neuen Informations-
und Kommunikationstechnologien in Bildungsorganisationen
unterstützt!
Netzwerkstrukturen können erheblich durch neue
IuK-Technologien unterstützt werden. Dies besitzt
auch Gültigkeit für Bildungsorganisationen.
Dementsprechend ist eine IuK-Infrastruktur zur Verfügung
zu stellen, die den Wissensaustausch mit den verschiedenen
Akteuren ermöglicht. Es kann hier nicht darum
gehen, eine einheitliche Plattform zu generieren.
Außerdem sind Informations- und Kommunikationstechnologien
auf den jeweiligen Bedarf anzupassen. Dies verlangt
jedoch, dass von Seiten der Bildungsinstitution der
Bedarf bestimmt werden kann. Die folgenden Fragen
deuten die Problematik nochmals an:
Wer ist für die Bereitstellung einer IuK-Plattform
verantwortlich?
Welche Anforderungen stellen sich an die Plattform,
z. B. Zugang, Bedienerfreundlichkeit etc.?
Wie kann mit Schnittstellenproblemen in der beruflichen
Bildung (z. B. zwischen Schule und Betrieb) umgegangen
werden?
Wer legt Nutzungsformen und damit auch den Bedarf
neuer Technologien fest?
Welche Standards sollen eingehalten werden?
· Qualifizierungsnetzwerke können als
Keimzelle eines Wissensmanagements dienen!
Mit dieser Aussage ist die These verbunden, dass in
der beruflichen Bildung eine Professionalisierung
des Umgangs mit Wissen notwendig erscheint. Eine zentrale
Problemstellung scheint die Überführung
individuellen Wissens in kooperatives Wissen zu sein
und gleichermaßen der Austausch von Informationen.
Damit einher stellt sich die Anforderung, dass in
Schulen Teamstrukturen aufgebaut werden sollen. Kann
dies möglicherweise durch Netzwerkstrukturen
erreicht werden und können diese einen ausreichenden
Wissensfluss sicherstellen oder ist damit nur ein
Wissensaustausch in einzelnen Zirkeln erreicht?
Zusammenfassend kann die Annahme aufgestellt werden,
dass Qualifizierungsnetzwerke einen erheblichen Beitrag
zur Modernisierung beruflicher Bildung leisten können.
Jedoch stellt sich damit auch direkt die Frage nach
einer Präzisierung, welche unterschiedlichen
Formen von Qualifizierungsnetzwerken differenziert
werden können. Qualifizierungsnetzwerke können
beispielsweise der schulinternen Lehrerfortbildung
dienen, der Entwicklung regionaler Bildungsangebote
oder der kooperativen schulnahen Curriculumentwicklung.
An dieser Stelle sollen nur einige Gestaltungsmerkmale
abschließend angeführt werden:
· Art der Aufgabenstellung (curriculare, organisatorische
oder didaktische Aufgabenstellung).
· Form der Zusammenarbeit (Informationsaustausch,
Koordination von Aktivitäten oder Kooperation).
· Herkunft der Akteure (Abteilung, Schule,
Betriebe, Bildungsadministration).
· Größe der Netzwerke (Zahl der
Akteure).
4 Didaktische Gestaltung von Qualifizierungsnetzwerken
Diettrich/ Meyer-Menk verstehen Netzwerke als eine
spezifische Form offenen Lernens, "d. h. als
ein Spezialfall des Lernens in informellen Prozessen,
bzw. an (Lern-)Orten, die nicht primär dem Ziel
des Lernens verpflichtet sind" (vgl. Diettrich/
Meyer-Menk 2002, S. 2) (Diettrich/ Meyer-Menk stellen
die folgende Aspekte zur Kennzeichnung von Netzwerken
aus didaktischer Sicht zusammen, "dass
· die hier betrachteten Lernprozesse z. T.
informell, erfahrungsorientiert und z. T. unbewusst
ablaufen,
· Lernende dafür aber keine formalen Abschlüsse
erhalten und möglicherweise ihre Lernprozesse
nicht beschreiben können,
· didaktisch-curriculare Strukturen als 'Indizien'
für einen Kompetenzaufbau nur begrenzt vorhanden
sind
· und damit die Frage der Bilanzierung von
Kompetenzen durch Instrumente und Verfahren, die am
Individuum ansetzen, neben der Frage der Kompetenzentwicklung
(Lernorte, Lernzeiten, Methoden etc.) eine zunehmende
Bedeutung erhalten." ).
Ebenso wurde bereits darauf hingewiesen, dass Qualifizierungsnetzwerke
besonders gut funktionieren, wenn sie auf 'gewachsene
Strukturen' aufsetzen und nicht vollständig neu
eingerichtet werden. Dies deutet schon auf eine wichtige
Differenzierung hin. Qualifizierungsnetzwerke können
so eine langfristige Plattform zur Initiierung, Aufnahme,
Durchführung und Kontrolle von Lern- und Arbeitsprozessen
bieten. Die Verbindung zwischen den Akteuren muss
nicht jederzeit aktiv sein, jedoch bei Bedarf unproblematisch
von den Akteuren abrufbar sein. Qualifizierungsnetzwerke
können demgemäß als Auseinandersetzungs-
und Anregungsforum interpretiert werden. Damit scheint
ein erheblicher Unterschied zu vielen komplexen Lehr-Lernarrangements
vorzuliegen. Qualifizierungsnetzwerke bedürfen
einer Verankerung in der jeweiligen Arbeitsumgebung
der Akteure und bieten dort eine Erweiterung der Lernmöglichkeiten.
Lernen findet im jeweiligen Handlungsfeld statt. Qualifizierungsnetzwerke
bieten beispielsweise die Möglichkeit, eine Öffnung
nach außen zu erreichen und Schnittstellen zu
anderen Feldern anzubieten. Qualifizierungsnetzwerke
können nun aber auch nicht als alleinige Lern-
und Arbeitsform gesehen werden, da eine weitergehende
und vertiefende Bearbeitung in anderen Formen notwendig
ist. Netzwerke können gewissermaßen die
Halteseile bieten, um komplexe Aufgabestellungen aufnehmen
zu können. Problematisch ist es jedoch, die richtigen
Halteseile und Verbindungen bzw. Interaktionen zu
schaffen. Auch wenn in Netzwerken eine gewisse Interessenhomogenität
vorliegt, besteht dennoch Freiraum unterschiedliche
Vorstellungen, Arbeitsformen, Erfahrungen oder auch
Ziele einzubringen bzw. zu verfolgen. Netzwerke bieten
so eine ideale Plattform zur Unterstützung und
Auslösung selbst gesteuerter Lern- und Arbeitsprozesse.
Damit stellt sich jedoch auch die Schwierigkeit, in
welcher Form sich Netzwerke einrichten und lenken
lassen. Oder was ist zu tun, wenn sich Netzwerke von
selbst nicht aufrechterhalten. Wriebe weist im Kontext
der Unternehmensführung auf das Konzept der Kontextsteuerung
hin. In diesem Konzept wird das Steuerungsinstrument
der Anweisung vermehrt durch das Instrument der Kontextsteuerung
ersetzt. In der folgenden Übersicht werden in
Anlehnung an Wriebe Komponenten der Kontextsteuerung
aufgezeigt:

Abb. 3: Ausgewählte Komponenten der Kontextsteuerung
(leicht verändert entnommen aus Wriebe 2001,
S. 45).
Die Einbindung in und Nutzung von Netzwerken als
Lernumgebung von Lehrkräften stellt damit nicht
nur an die Lehrkräfte neue Anforderungen, sondern
auch an die Führungskräfte in berufsbildenden
Schulen stellen sich neue Anforderungen, da erkennbar
wird, dass funktionierende Netzwerkstrukturen eine
Rückbindung an andere Ablaufprozesse haben und
nicht isoliert von diesen betrachtet werden können.
· Qualifizierungsnetzwerke sind in eine (komplexe)
Lern- und Arbeitsumgebung einzubinden!
Ausgewählte Fragestellungen:
Welchen Stellenwert haben Qualifizierungsnetzwerke
in der Arbeitsumgebung von Lehrkräften?
Welche Formen der Verankerung können in Schulen
umgesetzt werden?
Welcher Veränderungen bedarf die Arbeitsumgebung
von Lehrkräften?
· Qualifizierungsnetzwerke bieten besondere
Potenziale zur Individualisierung, Situierung und
Kooperation!
Ausgewählte Fragestellungen:
Welche Kooperationsformen finden in Qualifizierungsnetzwerken
Anwendung?
Wie können die Potenziale ausgeschöpft
werden?
Wie können Potenziale durch die Akteure erkannt
werden?
Welche Sozialformen kommen in Qualifizierungsnetzwerken
zur Anwendung?
Wie kann eine Erfolgskontrolle von Qualifizierungsnetzwerken
eingerichtet werden?
· Qualifizierungsnetzwerke bedürfen einer
systematischen (Weiter-)Entwicklung und Implementation
- die Steuerung und Lenkung von Qualifizierungsnetzwerken
bereiten erhebliche Probleme!
Ausgewählte Fragestellungen:
Welche Formen des Managements (resp. der Pflege)
von Qualifizierungsnetzwerken sollen eingerichtet
werden?
Wie können Qualifizierungsnetzwerke eine Institutionalisierung
erfahren?
Welche Kontexte können beeinflusst werden?
Welche Kontexte können nicht beeinflusst werden?
5 Akteure in Qualifizierungsnetzwerken
Grundsätzlich können Personen, Abteilungen,
Organisationen etc. als Knotenpunkte in Netzwerken
fungieren. Das Agieren in Netzwerkstrukturen erfolgt
in der Regel kaum angeleitet, sondern muss selbsttätig
durch die betroffenen Akteure gestaltet werden. Damit
stellen sich im Gegensatz zu anderen Formen des Lernens
und Arbeitens neue Anforderungen an die einzelnen
Personen. Offen bleibt, ob die Gestaltung von Netzwerken
eine Professionalisierung einzelner Personen bedarf,
oder ob alle Personen in Netzwerken agieren müssen.
· Qualifizierungsnetzwerke werden durch
Interaktionen der Akteure mit Leben erfüllt!
· Qualifizierungsnetzwerke werden getragen
von selbst gesteuerten Lern- und Arbeitsprozessen!
· Akteure bedürfen Handlungsfreiräume
in Qualifizierungsnetzwerken und Umsetzungsfreiräume
in den jeweiligen Organisationseinheiten. - Im Anwendungszusammenhang
entscheidet sich die Kraft von Qualifizierungsnetzwerken!
Diese Thesen wurden im Workshop weitgehend bestätigt.
Dennoch stellen sich vielfältige Gestaltungsfragen.
Netzwerke lassen sehr unterschiedliche Interaktionsformen
zu, so z. B. face-to-face Kommunikation oder Formen
synchroner Kommunikation, Austausch von Informationen
per Newsletter oder Email, Verteilung von Texten.
Die Vor- und Nachteile bzw. Anwendungsformen einzelner
Interaktionsformen sind noch genauer zu bestimmen,
es können allenfalls aus anderen (sozialen) Netzwerken
Erfahrungen übertragen werden, ob diese auch
Gültigkeit für Lernprozesse in Qualifizierungsnetzwerken
besitzen darf zumindest bezweifelt werden. Ebenso
ist weiterhin klärungsbedürftig, welche
Kompetenzen Akteure besitzen sollten, um in Netzwerkstrukturen
agieren zu können, um diese als Lerngelegenheit
aufnehmen zu können. Damit rückt jedoch
auch die Frage in den Vordergrund, welche Lernpotenziale
ein Netzwerk bietet und wie dieses jeweils dargeboten
werden kann. Dies kann vermutlich nur durch die einzelnen
Akteure beantwortet werden und nicht in allgemeiner
Sicht.
6 Ausblick: Der Weg zur Realisation
Einmal mehr zeigt sich, dass es erhebliche Probleme
bereitet eine fruchtbare Idee in der beruflichen Bildung
zur Umsetzung zu führen. Auch wenn der Netzwerkansatz
keinesfalls als neu gekennzeichnet werden kann und
Netzwerke auch in der beruflichen Bildung in vielfältigen
Formen vorzufinden sind, scheinen einerseits ein theoretisch-konzeptionelles
Problem und andererseits ein praktisch-gestaltender
Problembereich vorzuliegen. Diese beiden Bereiche
sind nach meiner Auffassung auch nicht einfach zu
trennen, da sie sich wechselseitig bedingen. Auf theoretisch-konzeptioneller
Sicht zeigen die Fragestellungen, dass Netzwerkformen,
-potenziale und Handlungsformen der Akteure aus didaktischer
Sicht genauer zu bestimmen sind. In diesem Kontext
wäre ebenso zu fragen, ob es sich um ein Qualifizierungs-,
Bildungs- oder/und Lernnetzwerk handelt. Ebenso sind
Abgrenzungen zu Kooperationsformen in der beruflichen
Bildung oder komplexen Lehr-Lernarrangements herzustellen.
Aus praktisch-gestaltender Sicht sind Fragen der Umsetzung
einzelner Netzwerkformen, der Einrichtung von Netzwerken,
aber auch der Lebensdauer von Netzwerken genauer zu
bestimmen. Abschließend sollen vier Bereiche
aufgenommen werden, die im Rahmen der Gestaltung von
Netzwerken bedeutsam sind:
· Bestimmung der Ausgangsbedingungen
Es wurde deutlich, dass die Einrichtung von Netzwerken
nicht losgelöst von bestehenden Kooperationsformen
resp. Vernetzungsformen erfolgen kann. Daher ist
es notwendig, dass diese zu Beginn aufgenommen werden
und bei der Einrichtung bzw. Weiterentwicklung genutzt
werden. Gleichermaßen ist es wichtig, die
Voraussetzungen der Akteure zu betrachten, da es
um eine Vernetzung der Akteure geht. Besondere Bedeutung
haben die bisherigen Arbeitserfahrungen und -vorstellungen
der Akteure. Auch diese können nicht durch
Vernetzungsformen einfach umgestellt werden. Das
Agieren in Netzstrukturen kann einen schwierigen
Lernprozess für verschiedene Akteure darstellen.
· Schaffung einer Infrastruktur
Die Schaffung einer Infrastruktur sollte darauf
abzielen, die Verbindungen zwischen den Akteuren
herzustellen bzw. den Informationsfluss fließen
zu lassen. Neben der Bereitstellung und Einrichtung
einer informationstechnologischen Basis, gilt es
jedoch auch Netzwerke über traditionelle Interaktionsformen
zu fördern und diese zu ermöglichen. Dies
kann beispielsweise bedeuten, dass Zeitfenster zur
Zusammenarbeit geschaffen werden. Ebenso ist es
notwendig, räumliche Bedingungen herzustellen,
die eine Vernetzung ermöglichen.
· Integration in Aufbau- und Ablaufstrukturen
Qualifizierungsnetzwerke transportieren nicht automatisch
Informationen in andere organisatorische Bereiche.
Dies bedeutet, dass Qualifizierungsnetzwerke nicht
konträr zu Aufbau- und Ablaufstrukturen eingerichtet
werden können, sondern in diese integriert
werden müssen. Entscheidungen, Vereinbarungen
müssen auch Handlungsrelevanz gewinnen können
und nicht nur zwischen den verschiedenen Arbeitseinheiten
verhandelt werden dürfen. Auch wenn Aufbau-
und Ablaufstrukturen zu Beginn als Rahmenbedingungen
betrachtet werden können, sind diese auf Dauer
als gestaltbare Größen zu interpretieren,
die an die veränderten Strukturen durch die
Netzstrukturen anzupassen sind.
· Mix verschiedener Interaktionsformen
Auch wenn Netzwerkstrukturen durch neue Technologien
unterstützt werden, bedeutet dies nicht, dass
damit andere Interaktionsformen keine Bedeutung
mehr besitzen. Es geht darum, die verschiedenen
Interaktionsformen zu kombinieren und in einem Zusammenspiel
zu sehen und nicht darum einzelne Interaktionsformen
isoliert zu betrachten.
Literatur
Bullinger, H./ Nowak, J. (1998): Soziale Netzwerkarbeit.
Eine Einführung für soziale Berufe, Freiburg
i. B.
Castells, M. (2001): Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft.
Teil 1 der Trilogie Das Informationszeitalter. Opladen
2001.
Dobischaft, R. (1999): Reichweiten und Grenzen des
Beitrags von beruflicher Weiterbildung zum regionalen
Strukturwandel. Netzwerke zwischen Betrieben und überbetrieblichen
Weiterbildungsträgern - eine Allianz mit Zukunft.
In: www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1999/dobischat99_01.doc
(Stand 15. 06. 2002)
Dehnbostel, P. (2001): Netzwerkbildungen und Lernkulturwandel
in der beruflichen Weiterbildung. Basis für eine
umfassende Kompetenzentwicklung? In: GdWZ, Heft 3,
S. 104-106.
Diettrich, A./ Meyer-Menk, J. (2003): Berufliches
Lernen in Netzwerken und Kooperationen - Ansatzpunkte
zur Kompetenzerfassung und -zertifizierung. In: bwp@
Ausgabe Nr. 3, online unter:
http://www.bwpat.de/ausgabe3/diettrich_meyermenk_bwpat3.html
(Stand 29. 09. 2003).
Diettrich, A./ Jäger, A. (2002): Lernen in regionalen
Netzwerken - Konzeptionelle Überlegungen und
praktische Erfahrungen. Kölner Zeitschrift für
"Wirtschaft und Pädagogik", Heft 33,
S. 45-70.
Dilger, B./ Kremer, H.-H. (2001): Informationen zum
Modellversuch WISLOK, Wirtschaftspädagogische
Beiträge Paderborn Heft 3, Paderborn 2001 (vgl.
auch http://wiwi.uni-paderborn.de/wiwi1/index.html
)
Dubs, R. (2003): Editorial: Ermüdung und Gleichgültigkeit
im schulischen Alltag: Die Verantwortung der Politik
und der Wissenschaft. In: Zeitschrift für Berufs-
und Wirtschaftspädagogik, Heft 1, S. 3-9.
Faulstich, P./ Zeuner, C. (2001): Kompetenznetzwerke
und Kooperationsverbünde in der Weiterbildung.
In: Grundlagen der Weiterbildung, Heft 3, S. 100-103.
Gramlinger, F. (2002): Lernen in Netzen - Chancen,
Probleme, Potenziale. In: bwp@ Sonderausgabe Nr. 2a,
online unter:
http://www.bwpat.de/ausgabe2a/gramlinger_bwpat2a.html
(Stand 27. 06. 2002).
Hellmer, F./ Friese, Ch./ Kollros, H./ Krumbein, W.
(1999): Mythos Netzwerke. Regionale Innovationsprozesse
zwischen Kontinuität und Wandel. Berlin.
Jansen, D./ Schubert, K. (Hrsg.) (1995): Netzwerke
und Politikproduktion. Konzepte, Methoden, Perspektiven.
Marburg.
Jütte, W. (2002): Soziales Netzwerk Weiterbildung.
Analyse lokaler Institutionenlandschaften, Bielefeld.
Klimecki, R. G./ Thomae, M. (2000): Interne Netzwerke
zur Entwicklung organisationalen Wissens. In: Personal
Heft 11, S. 588-590.
Klimecki, R. G./ Thomae, M. (2002): Wissensmanagement:
Neue Herausforderungen für das Personalmanagement.
In: Bleicher, K./ Berthel, J. (Hrsg.): Auf dem Weg
in die Wissensgesellschaft. Frankfurt, S. 263 - 278.
Kremer, H.-H./ Sloane, P. F. E. (2001): Lernfelder
implementieren. Zur Entwicklung und Gestaltung fächer-
und lernortübergreifender Lehr-Lernarrangements
im Lernfeldkonzept. Paderborn.
Kremer, H.-H. (2003): Implementation didaktischer
Theorie - Innovationen gestalten. Annäherungen
an eine theoretische Grundlegung im Kontext der Einführung
lernfeldstrukturierter Curricula. Paderborn.
Lewin, K. (1982): Kurt-Lewin-Werkausgabe; Bd. 6 Psychologie
der Entwicklung und Erziehung (Hrsg.: Weinert, F.
E./ Gundlach, H.) Bern/ Stuttgart.
Schenk, M. (1995): Soziale Netzwerke und Massenmedien.
Untersuchungen zum Einfluss der persönlichen
Kommunikation. Tübingen.
Sloane, P. F. E. (1983): Theoretische und praktische
Aspekte der Zielbestimmung: eine Darstellung an Hand
der Zielbestimmung für die pädagogische
Weiterbildung von nebenberuflichen Lehrkräften
in der beruflichen Weiterbildung. Düsseldorf.
Wegge, M. (1996): Qualifizierungsnetzwerke - Netze
oder lose Fäden? Ansätze regionaler Organisation
beruflicher Weiterbildung. Opladen.
Weyer, J. (Hrsg.) (2000): Soziale Netzwerke. Konzepte
und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung.
München.
Winnefeld, F. u. Mitarbeiter (1957): Pädagogischer
Kontakt und pädagogisches Feld. Beiträge
zur pädagogischen Psychologie. Beiheft der Zeitschrift
Schule und Psychologie, Heft 7, München/ Basel.
Wriebe, C. M. (2001): Netzwerkstrategien als symbiotische
Kooperationen: eine konzeptionelle, effizienztheoretische
und kartellrechtliche Analyse. Frankfurt a. M.
|